


|

|
|
H.-G. Behr SÖHNE DER WÜSTE Kalifen, Händler und Gelehrte
"Aus der Geschichte können wir lernen, (Mas'udi: Muruju`l-Dhabab)
Copyright © 1975 by Econ Verlag, Wien und Düsseldorf Lizenzausgabe : Gustav Lübbe Verlag GmbH, Bergisch Gladbach
Printed in Western Germany 1978 Einbandgestaltung: Ralf Rudolph Titelfoto : ZEFA Gesamtherstellung: Ebner, Ulm ISBN .3-4o4-0o708-5.
|

| Vorwort |
|
Das erste, was ich über den Islam hörte, stammte von meinem Religionslehrer: "Der Islam ist ein Schwindel."
Als ich begann; meine Religionslehrer für Schwindler zu halten, begann daher auch mein Interesse an der Welt des Islam. Ich zog aus dem christlichen Abendland in das Morgenland des Halbmonds, zunächst als Tramp, und als solcher trampelte ich einige Jahre durch alle möglichen nahöstlichen Fettnäpfchen. Es wurde mir freundlicher verziehen als hierzulande, und so begann ich, die Welt des Islam zu lieben. Einmal kam ich auf diese Weise auch nach Peshawar, eine romantische Gebirgsstadt jenseits des Khaiber-Passes, schon im Pakistan und damals noch nicht von Hippies überlaufen. Dort starrte ich fasziniert auf einen kleinen Halbmond, aus Gold und uralt. Er lag in einer atemberaubend wackeligen Bretterbude mit der bunten Aufschrift "zum Markt der Welt" und wurde von einem äußerst zähen Trödler bewacht. Im Laufe des stundenlangen Feilschens fragte ich den Alten auch nach seinem Namen. "Mohammed", sagte er und richtete sich stolz auf, "wie der größte der Propheten." Da wollte ich wissen, warum Mohammed unbedingt der Größte sein solle. Der Alte legte seinen Kopf zurück und kniff die Augen zusammen. Dann nahm er einen tiefen Zug aus seiner Wasserpfeife und sagte ganz langsam: "Moses, Prophet, Gut. Jesus, Prophet, Gut. Buddha, Prophet, auch gut. Mohammed, Prophet und Geschäftsmann." Ich gab mich geschlagen, übrigens auch in Sachen Halbmond, ich hätte ihn zu gerne gehabt, aber er hing meiner Börse zu hoch. Von da an aber verschlang ich alles, was ich über die Welt des Islam erfahren konnte. Die Religion interessierte mich natürlich weniger ich hatte ja gerade eine überstanden als der tägliche Kram, der aus ihr entsteht. Mich faszinierten Allahs irdische Folgen, die wirtschaftlichen, politischen und kulturellen, und seine Spuren im täglichen Leben. Ich las mich durch alte Chroniken und staunte mich durch die Länder des Halbmonds, bis mir die Augäpfel Schmerzten. Zahllosen lieben Menschen habe ich zu danken ich möchte so gern dem unbekannten Bibliothekar ein Denkmal errichten,
möchte den Damen Carola Heldt, Brigitta Keil und Monika Polacz, Herrn Rainald Blanck und vor allem den Herren Eckhard Dück und Holger Schnitger-Hans danken, die mir ausdauernd geholfen haben, aber auch meinen vielen islamischen Gastgebern -, dass nun dieses Buch entstanden ist. Arabisten und Fachwissenschaftler mögen mir gnädig sein: Bei den Namen habe ich die wissenschaftlich exakte, aber unaussprechliche, Schreibweise durch eine phonetische ersetzt, viele historische Fachausdrücke durch die entsprechenden modernen, und das Vexierspiel alter Währungen habe ich in die Kaufkraft der D-Mark anno 1975 umzurechnen versucht. Auf diese Idee gebracht hat mich Mas`udi, der Chronist der goldenen Zeit des Halbmonds. Sein berühmter Gemeinplatz war für mich ein Fingerzeig, und die Geschichte des Islam ist seitdem für mich eine Quelle manchmal getrübten Vergnügens, ein abenteuerliches Spiegelkabinett unserer Gegenwart. Katmandu, Juli 1975 |
|
Kapitel 1. Die Kameltreiber
|
|
|
In der Ewigen Stadt Rom wird nebst anderen welthistorischen Kuriositäten auch der älteste Scheck der Welt verwahrt. Er ruht in der "Banco di Santo Spiritu" der "Bank des Heiligen Geistes", dem wohl mächtigsten Institut dieser unfrommen Branche. Die "Banco di Santo Spiritu" untersteht Seiner Heiligkeit dem Papst, besitzt zahllose Aktien von Autofabriken Fluggesellschaften, Lebensmittelfirmen, Bauunternehmen, höchstwahrscheinlich auch Anteile von Firmen der Rüstungsindustrie und mit Sicherheit den ältesten erhaltenen Scheck. Er stammt aus dem Jahr 748 und ist ein großes, wurmzerfressenes Stück Papier, auf dem in gewundenen Formulierungen ein Scheich Selim Mutalla bei Allah für 120 Goldstücke, zahlbar dem Überbringer, gutsteht. Der Scheck war damit auch im Rom jener Zeit gedeckt, denn an der "Banco di Santo Spiritu" hatte der Heilige Geist im Jahr 748 noch keinen Anteil - das Institut war nur eine kleine Zweigstelle der allmächtigen Bank des Islams, jener Weltreligion, die sich als einzige direkt aus einem Handelskonzern entwickelt hat, jener Weltmacht, die das Abendland formen half."Ex oriente lux", formulierten Gelehrte des Mittelalters: "Aus dem Osten kommt das Licht." Unsere Energiewirtschaft hat dem alten Slogan einen neuen, handfesten Sinn gegeben. Früher besagte er: Wer die Ursprünge europäischer Kultur und Zivilisation finden will, muss sie im Nahen Osten suchen. Wir danken den Arabern viel. Unser Weltwirtschaftssystem samt seinen augenblicklichen Krisen, unsere Marktwirtschaft und unser Bankwesen, unsere Mathematik und natürlich auch unser Zahlensystem. Außerdem unsere Universitäten samt der These von der Freiheit der Wissenschaften, die Grundlagen unserer Medizin, den Journalismus und die moderne Geschichtsschreibung. Das zivilisatorische Modell, das wir heute loben und an dem wir oft Verzweifeln der Kapitalismus, wurde in der Wüste entwickelt. Die Wüste beginnt zwei Flugstunden südlich von Rom, nach dem Mittelmeer und dem grün zerklüfteten Libanon. Aus einer Flughöhe von 11.000 Meter sieht sie tatsächlich Wüst aus - eine unendliche Fläche graubraun wie Tee mit Milch. Doch schon nach kurzer Zeit senkt sich das Flugzeug und die Wüste nimmt Formen an. Riesige Schatten verraten hohe Gebirge dazwischen krümmen sich ungeheure, versandete Täler,
und mit guten Augen kann man winzige, schwarze Punkte entdecken - die Zelte der Beduinen. Wenn die Maschine zum Tiefflug ansetzt, werden um die Zelte noch viele kleine Pünktchen sichtbar. Beim Brausen der Triebwerke geraten sie in hektische Bewegung: Kamele. In der Geschichte Arabiens haben Kamele stets eine bedeutende Rolle gespielt, steht in einem modernen Geschichtsbuch Arabiens, doch moderne Araber sehen es gar nicht gern, wenn man Kamele fotografieren will. Kamele gelten heute als Symbole der Rückständigkeit. Die Wüstensöhne Kuwaits zum Beispiel lassen sich am liebsten mit Fortbewegungsmitteln der Marke "Mercedes" fotografieren, und das schon zu einer Zeit, bevor sie als konsequente Neureiche nicht nur die Produkte, sondern auch etwas von der Produktion kauften. "Kamele sind out", scherzte selbst mein Taxifahrer auf dem Flughafen von Kuwait. In seinem vollklimatisierten Mercedes brauste er mit mir über eine schnurgerade, nagelneue Strasse in die Wüste. Eine halbe Stunde später blockierte ein gelangweiltes Kamelrudel die Piste. Am Straßenrand standen zwei chromblinkende Straßenkreuzer, dahinter sieben dunkle Zelte, und dort war die Zeit stehen geblieben. Als unser Wagen hielt, tauchten am Straßenrand einige Männer auf und sahen nicht gerade freundlich drein. Mein Fahrer kannte sie allerdings, und er ging mit ihnen zu einem Zelt in der Mitte der anderen. Nach einer Weile kam er wieder und holte mich. Einige filzige Fettschwanzschafe beschnupperten mich, und die Kamele sahen unglaublich arrogant auf mich. Als sich meine Augen an das Halbdunkel im Zelt gewöhnt hatten, sah ich einige ältere Männer. In der Mitte saß einer mit Burnus und einem langen, weißen Bart, an dem noch die Spuren etlicher Mahlzeiten hingen. Er verneigte sich im Sitzen und sagte etwas. Es musste eine alte Formel sein, denn der Alte sang mehr, als er sprach. Mein Führer übersetzte: "O Gast, der du gekommen bist, unser Zelt zu ehren; in Wahrheit sind wir die Gäste und bist du unser Hausherr." Mein Führer antwortete in derselben Tonlage, und dann durften wir uns setzen. Die Einrichtung des Zeltes war einfach ein gewebter Teppich, einige eingerollte Decken, etliche Blechbüchsen.
Zunächst wurden viele Fragen gestellt. Woher und wohin auf welchem Weg und warum und so weiter. Das Interesse der Runde an der Bundesrepublik verflog jedoch augenblicklich, als sie hören musste dass man dort nicht in Zelten lebe und wenn überhaupt dann höchstens im Urlaub. Dass sich Menschen freiwillig in das Gefängnis gemauerter Wohnungen begeben können ging einfach über ihr Begriffsvermögen. Da machte der Alte eine Handbewegung. Ein jüngerer Mann holte eine Blechbüchse und daraus nahm der Alte eine Handvoll graugrüner Bohnen. Er streute sie in eine kleine Pfanne, setzte sie auf ein winziges Feuerchen das in einem Tontopf vor dem Zelt gloste, rührte vorsichtig mit einem Stöckchen um, und bald duftete es herrlich nach Kaffee. In einem Messingmörser wurden die Bohnen nach einem ganz bestimmten Rhythmus zerstampft taktak taktaktaktaktak taktak. Das zeigt allen Leuten in der Nähe an dass hier Gäste bewirtet werden erklärte mein Führer. Aus einer schmutzigen Flasche goss der Alte etwas Wasser in einen Blechtopf. Als es kochte gab er das Kaffeepulver dazu, ließ das Ganze noch zweimal aufwallen und goss es schließlich in eine hohe Metallkanne mit sehr enger Tülle. In die hatte er zuvor umständlich eine Kardamomkapsel gesteckt. Nach vielen Verbeugungen durften wir das teuflisch starke Gebräu aus winzigen Schälchen trinken. Viel später wurden wir auch zum Essen eingeladen Hirsebrei mit einigen zähen Fleischstückchen und sehr, sehr fett. Wir aßen mit den Fingern, und die Hände mussten wir uns am Zeltvorhang abwischen. An dem hing bereits eine dicke Fettschicht - der Ehrenschild des Hausherrn Beweis seiner großen Gastfreundschaft. Nach der Mahlzeit wurden wir in ein anderes Zelt gebeten. Bei frischem Kaffee nestelten jüngere Männer einige Stoffbündel auf. Ein großer, klebriger Klumpen wurde mir zuerst gezeigt - Weihrauch. Dann folgten viele kleine Gegenstände: Silberschmuck kleine Kaffeetassen aus fein graviertem Kupfer große Kugeln aus Bernstein und Korallen und kleine Perlen aus dem persischen Golf. Für einen lächerlichen Betrag kaufte ich zwei kleine Armreifen aus Silber. Auf dem Heimweg sagte mir allerdings mein Führer dass der Beduine selbst daran mindestens 500 Prozent verdient hatte und er zeigte mir auch ungeniert, was dabei für ihn als Provision abgefallen war: eine zierliche Elfenbeinstatuette aus China.
Ich nahm das nicht einmal übel, sondern genoss einen ebenso kurzen wie überwältigenden Sonnenuntergang über der Wüste. Immer noch blockierten Kamele die Strasse, und nun warfen sie lange, bizarre Schatten. Die Kamele sind eigentlich Dromedare, einhöckerig sehr genügsam und unglaublich eigensinnig. Sämtliche dem Esel nachgesagten Untugenden übertrifft es mühelos, und dabei ist es schon wesentlich längere Zeit Haustier als das Langohr. Vor tausend Jahren galt der Wildesel noch als besonders edle Jagdbeute - das Kamel aber war damals schon zwei-ein-halb Jahrtausende gezähmt und in seiner Wildform nicht mehr anzutreffen. Von den Hengsten überleben nur wenige die Jugend. Bereits im zarten Alter werden sie zu Festbraten verarbeitet, und nur besonders zähe Jünglinge werden zur Aufzucht behalten. Die Dromedardamen aber liefern Milch und Wolle, ihre Exkremente Brennmaterial und deren Asche Wasch- und Putzmittel. Vor allem jedoch sind sie Transportmittel. Als Treibstoff genügt wenig Wasser - die meisten Autokühler verbrauchen mehr , und im übrigen fressen sie beinahe alles, sogar Lederriemen und die "Rosen von Jericho". Diese Rosen haben mit Rosen allerdings nichts gemein. Als graue struppige Bälle liegen sie im Sand herum ungefähr faust groß. Zerdrückt man sie mit der Hand, zerfallen sie zu Staub. Legt man sie aber in einen Teller mit nur etwas Wasser geschieht das "Wunder von Jericho": Der graue Ball wird dunkelgrün und entfaltet sich zu einer festen reich verzweigten Pflanze. Diese sondert nach einigen Stunden grünen Staub ab, aus dem neue Rosen werden. Die Natur hat es mit diesem Wunder nicht eilig. Manche Rosen werden jahrhundertealt. Der Wind bläst sie durch die Wüste. Die meisten werden gefressen und grünen nur im Magen der Kamele. Andere kommen zufällig einmal auf feuchteren Boden und vervielfältigen das Wunder. Dieses groß artige Naturmodell, mit dem Wüstenklima fertig zu werden, wurde in erstaunlich kurzer Zeit entwickelt: Die arabische Wüste gibt es erst seit dem Jungtertiär. Davor war Arabien ein Teil Afrikas und so fruchtbar, dass als Nebenprodukt des Lebens auch der Welt größte Erdölfelder entstanden.
Dann aber bekam die Verbindung einen Knacks. Ein 2.300 km langer Landstreifen brach als Rotes Meer ein. Die Ränder der Bruchstelle stülpten sich gleichzeitig zu Gebirgen auf. Nach einigen Jahrzehntausenden hatte die Halbinsel ihre heutige Gestalt. Wer sich Arabien vom Westen her nähert, gerät zuerst an die Bruchstelle, eine schmale Küste namens Tihama. Ihr glatter Rand bietet nur wenig Häfen Mokka vor allem, von alters her berühmt als Umschlagplatz abessinischen Kaffees, und Dschidda, den Vorhafen Mekkas. Berühmt ist die Tihama außerdem für ihr Treibhausklima und die lästigsten Fliegen der Welt. In arabischer Sprache heißen sie poetisch "Schosskinder des Satans", und der scheint dafür zu sorgen, dass ihnen nichts zuleide geschieht, denn sie mästen sich sogar mit DDT. Wer ihnen entkommen will muss ins Gebirge, und das ist unter den gegebenen Umständen sehr schweißtreibend. Das Gebirge heißt Sarat und kann es in jeder Beziehung mit den Alpen Europas aufnehmen. Die meisten Gipfel sind stolze Dreitausender, und der gewaltige Aufbau sorgt dafür, dass sich keine Regenwolke in das Hinterland verirrt. Die Westhänge des Gebirges sind von den ständigen Regengüssen völlig kahl gespült worden, nach Osten aber verirren sich nur wenige Rinnsale. Sie heißen dann Wadis, teilen sich in zahllose Nebenarme und versickern irgendwann im Sand. Wasser führen sie nur sehr selten aber immerhin bietet ihre Nähe etwas Grundwasser und davon lebt das Land. Das Land heißt Hidscha oder Hedschas, "die Schranke". Die Schranke ist ein wild zerklüftetes Hochland, auf dem hauptsächlich graue Disteln gedeihen. Dennoch heißt es "das grüne Arabien", denn hier liegen die meisten Oasen, wie Perlen an den Wadis aufgereiht. Nur 0,2 %, ganze zwei Tausendstel der Gesamtfläche Arabiens sind Ackerland doch davon liegen mehr als zwei Drittel in der schmalen Hidscha und hier ist auch die Heimat der Dattelpalme. Einen genügsameren Baum gibt es wohl kaum, und Arabiens Schöngeister nennen die schlanke Palme "wenig Nehmende, alles Gebende". Ihr Holz ist zwar schlecht, als Bau- und Brennmaterial aber unentbehrlich. Ihre Wedel dienen als Dachziegel, Sonnensegel, Fächer und Besen; aus ihren Fasern werden Taue gedreht und ihre Früchte werden nach über hundert Verfahren zubereitet, unter anderem auch zu einem mörderisch starken Schnaps. Im Schatten der Dattelpalmen leben Dreiviertel aller Araber.
Ihre Häuser haben sie meist an den Rand der Oasen gebaut, denn der Boden in der Mitte ist für Bauland zu kostbar. Dort liegen kleine, gut bewachte Gärten und die Brunnen, oft an die 25 Meter tief. Moderne Techniker können es nicht fassen wie die einfachen Wüstenbewohner so tief verborgene Wasseradern aufspüren konnten und dabei enthalten die meisten Brunnen nur salziges Brackwasser. Süßwasserbrunnen sind der größte Schatz und hier entstanden sogar regelrechte Städte. Doch auch die wurden bis in die jüngste Gegenwart von denen beherrscht die nicht in den Oasen wohnen: den Beduinen, den Herren der Wüste. In der Hidscha heißen die Beduinen auch "Herren der schwarzen Steine". Die schwarzen Steine Harra bedecken fast ein Fünftel der Hidscha und wurden vor undenklichen Zeiten von längst erloschenen Vulkanen ausgespuckt. Natürlich ziehen auch Beduinen nicht freiwillig in diese trostlosen Halden. Viel lieber "beschützen" sie die Oasen und nehmen dort, was sie brauchen. Da sie jedoch fast nie bezahlen und auch die Geduld arabischer Bauern nicht grenzenlos ist, werden sie oft als Räuber verjagt, und dann bleibt ihnen nur der Rückzug in die Harra denn dorthin wagt kein Oasenbewohner sie zu verfolgen. In den Harra hausen nämlich auch die Dschinnen unheilbringende Dämonen. Durstigen Wanderern gaukeln die Dschinnen gerne liebliche Blumengärten vor, bis ihnen die Ahnungslosen in die Harra folgen und dort gefressen werden. Eine Dschinn-Dame brachte es in diesem Gewerbe zu so großer Fertigkeit dass ihr Name Fata Morgana sogar zu einem wissenschaftlichen Begriff wurde. Daher ziehen auch die Beduinen nur selten über die "schwarzen Steine", sondern lieber zu den gelben, nach Osten in das Nedsch. Das Nedsch ist eine unendliche Hochebene, durchschnittlich 1.000 Meter hoch, und nach Osten hin, dem persischen Golf zu, sinkt sie allmählich ab. Hier ist die eigentliche Wüste, "das unbewohnte Viertel der Welt", fünf Sechstel der Halbinsel. Hier leben fast nur Beduinen und hier gelten noch immer ihre uralten Gesetze, herrscht der Stammesverband und im Stamm der Scheich.
Der alte Mann, dessen Gast ich sein durfte war ein Scheich, Oberhaupt eines Stammes. Seine Funktion ist erblich, doch außerdem existieren auch Formen direkter Demokratie. Bei wichtigen Entscheidungen muss stets der Ältestenrat befragt. werden, die Patriarchen aller dem Stamm angeschlossenen Sippen. Und jeder im Stamm spricht den Scheich nur mit seinem Vornamen an, als Gleichen unter Gleichen. Wichtig ist der Scheich nur als oberste Instanz bei Streitigkeiten innerhalb des Stammes. Bestiehlt ein Stammesmitglied ein anderes kostet das eine Hand. Diebstähle bei fremden Stämmen hingegen sind ein Kavaliersdelikt und Plünderungen bei Bauern und in Städten eine Selbstverständlichkeit. Auch bei Eheschließungen hat der Scheich das letzte Wort. Jeder Stamm zerfällt in Großfamilien Sippen. Dabei zählen angesehene Stämme oft zehnmal mehr Sippen als kleine, und der Scheich muss von allen die ärmeren Mitglieder aushalten. Geheiratet aber wird nur mit seinem Einverständnis und meist untereinander. Selbst Ehen mit Mitgliedern befreundeter Stämme sind selten, und diese systematische Inzucht hat dafür gesorgt, dass sich die einzelnen Stämme gründlich voneinander unterscheiden. Für alle aber gelten Kamele als Symbol des Reichtums. Hat ein Stamm genügend junge Männer und Kamele produziert, rüstet er eine Karawane aus. Nach einem ausgiebigen Abschiedsessen, ziehen dann die Jungen, mit mindestens einundzwanzig Kamelen, auf Handelsreise. Jener Scheich, bei dessen Stamm ich meine beiden Silberreifen kaufte, hatte gerade zwei Karawanen los geschickt, eine nach Süden und eine nach Osten. Das war nicht einmal viel, denn mein Scheich präsidierte nur einem kleinen Stamm, allerdings einem besonders ehrwürdigen wie mir wiederholt erklärt wurde: Der Scheich war ein direkter Nachkomme des alten Abraham. Später fand ich heraus dass alle Araber von Abraham abstammen. Denn er hatte ihre Vorfahren in die Wüste geführt und damit zu dem doch sehr strapaziösen Leben verurteilt. Da auch die Juden Abraham als Stammvater reklamieren, waren sich die Wissenschaftler lange darüber einig, der Patriarch könne nur eine Sagenfigur sein. Laut Bibel stammte Abraham aus Ur in Chaldäa.
Ur ist ein alt arabisches Wort und bedeutet Festung. Die Stadt Ur wurde auch in unserem Jahrhundert ausgegraben und erwies sich nicht nur als uralte Festung, sondern auch als Hochburg sumerischer Kultur als Hauptstadt eines Volkes das aus den Gebirgen des Osten gekommen war und seinen Fürsten nicht nur Prachtstücke der Goldschmiedekunst sondern auch rudelweise Menschenopfer ins Grab mitgab. Menschenopfer kannte Abraham aus Ur auch und die Bibel berichtet von seinem misslungenen Versuch, seinen eigenen Sohn zu Ehren Gottes zu schlachten. So hielt man Abraham lange Zeit, wenn schon für eine historische Figur, für einen sumerischen Fürsten oder Abhängigen. Da entzifferte der Deutsche Fritz Hommel einige babylonische Keilschrifttafeln. Sie erwiesen sich als eine Art Fremdenführer durch Ur in Chaldäa und enthielten auch eine Liste von elf Königen die dort zwischen 1952 und 1585 vor unserer Zeitrechnung geherrscht hatten. Und die Liste enthüllte eine bewegte Geschichte: Die drei ersten Königsnamen waren semitisch, dann folgten sieben sumerische Namen und am Schluss wieder ein semitischer. Die Namen der ersten drei Könige waren eine kleine Sensation: Der erste hieß "Iluma-ilum", "Gott ist wahrhaftig Gott" oder "Es gibt keinen Gott als Gott". Später wurde daraus "Allah-il-Allah" das Glaubensbekenntnis der islamischen Religion. Der zweite König lieferte mit seinem Namen die heute noch gängige arabische Beteuerung "Gott kann auf mich bauen", und der dritte König hieß "Freund Gottes" Damki_ilischu. Das aber Ist von alters her der Beiname Abrahams. Urvater Abraham hatte eine wilde Jugend. Schon sein Vater war von den Sumerern besiegt und verjagt worden und der Junge wuchs als Prinz im Exil auf. Später versuchte er, Ur zurückzuerobern und mit einem wilden Handstreich bekam er die Stadt tatsächlich in seine Gewalt. Halten aber konnte er sich nicht. Er wurde vertrieben und zog in die Wüste laut Bibel reich an Silber und Gold also höchstwahrscheinlich mit der Staatskasse. Abraham wurde Beduine: Hirt und Kaufmann. Was sollte er mit dem Gold sonst anfangen? Bereits um 1800 v. Chr., also zur Zeit Abrahams wurde quer über die Arabische Halbinsel reger Handel getrieben denn bereits das Gold Urs stammte von der Küste Afrikas. Spätestens Abraham dürfte System in das Leben der Wüstenbewohner gebracht haben,
denn bereits fünfzig Jahre später hatte sich die Stammesordnung in ihrer heutigen Form durchgesetzt. Und das Wüstenleben hatte goldenen Boden: Die Araber wurden ein überaus erfolgreiches Händlervolk. Um das Jahr 950 v. Chr. wurde eine arabische Dame in der Bibel als Königin von Saba aktenkundig. Leider wissen wir nicht allzu viel über sie. Dass sie mit einer großen Karawane nach Jerusalem zog, um ihre Schätze der Weisheit Salomons zu opfern, ist etwas unglaubwürdig. Es dürfte sich eher um eine Geschäftsreise gehandelt haben, und der berüchtigte weise König wird dabei die Königin von Saba kräftig übers Ohr gehauen haben. Andere Gelehrte vermuten, die Königin sei selbst Ware gewesen, ein Einstandsgeschenk für den Harem Salomonis und Grundlage künftiger Geschäftsverbindungen. Doch könnte die Königin auch eine wirkliche Stammesfürstin gewesen sein bei manchen Araberstämmen hatten durchaus die Frauen die Hosen an, und noch heute sind Beduinenfrauen emanzipierter als ihre Kolleginnen in den Städten und der Landwirtschaft. Sie gehen unverschleiert durch die Gegend, und nur wenn bedenkliche Fremde kommen, ziehen sie sich vorübergehend in die Zelte zurück. Von kurzen biblischen Streiflichtern abgesehen, liegt die Frühgeschichte Arabiens ziemlich im dunkeln. Erst mit dem Aufstieg des Römerreichs werden die Araber historisch genau erfassbar, und da hatten sie sich bereits ihren festen Platz in der Weltwirtschaft gesichert. Ihre kleinen Segelboote, Daus genannt, fuhren stets in Sichtweite der Küste bis Indien, trieben Handel mit Abessinien und kamen sogar bis Südafrika und um das Kap der Guten Hoffnung herum an die Goldküste Ghanas. Quer über ihre eigene Halbinsel hatten sie bereits alle Trampelpfade des Warenumschlags angelegt, die heute noch Arabiens Hauptverkehrsadern darstellen. Und an den Kreuzungspunkten der Karawanenstrassen waren regelrechte Städte entstanden, permanente Messestädte, arabisch Basar genannt. Hier wechselten die Luxusgüter der Römer ihre Zwischenhändler. Indische Elfenbein von denen einige Prachtstücke später in Pompeji ausgegraben wurden, Weihrauch und natürlich Gold, indische Edelsteine, Korallen und Perlen, und vor allem der begehrteste Stoff der Alten Welt - Seide. Diese zarten Gewebe waren ursprünglich chinesisches Staatsmonopol gewesen, doch die Inder waren durch Betriebsspionage hinter das Herstellungsgeheimnis des sündhaft teuren Stoffs gekommen.
Bin Nabob ehelichte eine chinesische Prinzessin die als private Mitgift die ersten Seidenraupen in ihrer Perücke außer Landes schmuggelte. So handelten die Araber bereits um das Jahr 0 unserer Zeitrechnung mit indischer Seide und verwickelten die auf chinesische Seide spezialisierten Perser in. einen bösen Preiskrieg. Aber auch ein wesentlich bedenklicherer Stoff ging durch ihre Hände und wurde in Rom bald unentbehrliches Requisit für offizielle und private Orgien: Opium. Und natürlich blühte auch der Menschenhandel. In Arabiens Basaren wechselten afrikanische Krausköpfe ihren Besitzer, wurden zarte Inderinnen und Inder verschoben, und Rom nahm alles ab. Die Basare standen jeweils unter der Schirmherrschaft eines Stammes, große sogar eines Stämmeverbandes, und da die Marktherren bei jeder Gelegenheit kräftig absahnten, wurden manche Stämme unerhört reich. Um das Jahr 250 n. Chr. erfanden arabische Handelsherren eine Spielart des Geschäftslebens, bei der man auf halsbrecherische Weise schnell ungeheuer reich werden konnte und die heute noch der beliebteste Tummelplatz wilder Spekulanten ist das Warentermingeschäft. Bezeichnenderweise wurde. es hauptsächlich von Astrologen betrieben, Und Tempel fungierten als Vorläufer unserer Börsenhallen. Für die Handelsherrn der Stadt Palmyra zahlte sich der Hazard aus - sie konnten sich es sogar leisten, als Baumaterial für ihre Häuser griechischen Marmor zu importieren. Der Boom Palmyras hatte nur einen Nachteil: Er war auf Gedeih und Verderb an die Konjunktur Roms gebunden. Und bald wollten auch die Römer auf dem Markt Palmyras ihre direkte Mitbestimmung durchsetzen. In dieser Situation kam es zu einem romantischen Skandal Königin Zenobia ließ ihren angeblich zu sehr von Rom abhängigen König umbringen und übernahm selbst die Geschäftsführung mit dem Programm "Los von Rom". Die Sache ging nicht gut aus. Zenobia endete in Rom, als Kriegsgefangene, und das einst so reiche Palmyra zerfiel zu einer romantischen Ruinenlandschaft. In unserem Jahrhundert erlebte die Geschichte übrigens ein ,pikantes Nachspiel: Eine französische Madame d'Andurain. war so begeistert von Zenobia, dass sie Palmyra zu neuem Leben erwecken wollte. Neben den ungeheuren Marmorruinen der alten Königin ließ sie einen nagelneuen Palast bauen, und dort herrschte sie als neue Herrin der Wüste.
Allerdings wollte die Dame ihrem historischen Vorbild bis ins Detail ähnlich werden, und so ließ auch sie eines Tages ihren Gemahl umbringen. Doch die Zeiten hatten sich geändert - Madame d'Andurain musste ihren Palast räumen. Sie charterte ein Segelboot und wurde wenig später von ihren Gefolgsleuten bei einer Meuterei den Haien verfüttert. Ihr Palast aber ermöglicht, die grandiosen Reste der alten Wüstenstadt relativ komfortabel genießen zu können, denn er wurde zu einem Touristenhotel demokratisiert. Das Ende Palmyras war auch das Ende der goldenen Zeit Arabiens. Das römische Wirtschaftssystem schlitterte in seine großen Krisen, und davon schlug jede auf den arabischen Markt nieder. In demselben Maß, in dem das Imperium Romanum provinzieller wurde, nahm auch der innerarabische Konflikt an Härte zu. Um das Jahr 270 n. Chr. wurde bei. einer nebensächlichen Stammesfehde auch die altehrwürdigste Instanz der Halbinsel in Schutt und Asche gelegt: der Basar von Meschkar. Hierher mussten alle Importgüter gebracht werden, die ihren Weg durch Arabien nahmen. Meschkar war ein Marktprüfungsamt. Sieben Tage lang wurden die Waren begutachtet und erhielten schließlich ein Gütezeichen. So vorbildlich war diese Einrichtung, Mes genannt, dass sie später von vielen Völkern gleich unter dem alten Namen übernommen wurde - auch unser Wort Messe ist eine Erinnerung daran. Mit dem Ende Meschkars hatte sich der arabische Handel selbst einen tödlichen Schlag zugefügt. Die Überlebenden Meschkars aber verließen die Trümmerstätte und siedelten sich weit im Süden neu an, in einem Dorf um einen Süßwasserbrunnen namens Semsem. Die Gewohnheit ihrer Messe versuchten sie auch dort am Leben zu erhalten, und damit rückte eine Ortschaft ins Blickfeld der Geschichte, die seitdem als Herz Arabiens gilt : Mekka.
Natürlich ist auch Mekka eine Gründung Abrahams. Der Patriarch soll in diese Gegend gekommen sein, als seine Frau Hagar gerade schwanger war. In glühender Sonnenhitze gebar Hagar ihren Sohn Ismael, und da weit und breit keine Wasserstelle zu finden war bereitete sich die junge Familie gottergeben aufs Verdursten vor. Endlich erschien jedoch ein Engel und zeigte einen Platz an dem Abraham einen Brunnen graben sollte.
Gehorsam begann Abraham zu buddeln, doch Wasser fand er nicht. Sechsmal lief. die arme Hagar von ihrem Lager zu der Baugrube, und sechsmal musste sie verzweifelt umkehren. Beim siebten mal aber erbarmte sich der Himmel, und aus der Erde entsprang der Quell Semsem "der Murmelnde". Als Dank für diese himmlische Gefälligkeit errichtete Abraham neben dem Brunnen zu Ehren Gottes ein würfelförmiges Gemäuer und nannte es Kaaba. Abrahams Gastspiel währte nur kurz, wenn man den sagenhaften Berichten trauen darf. Um den begehrten Platz an der süßen Quelle aber stritten hinfort alle möglichen Beduinenstämme, und bereits im dritten Jahrhundert nach Christus hatte sich Mekka zu einer ansehnlichen Handelsstadt entwickelt. Zahllose Götter dokumentierten ebenso viele Geschäftsverbindungen, und der aus Meschkar zugewanderte Stamm Dschorhem brachte auch noch die seinen mit. Gerade die islamischen Geschichtsschreiber legen Wert darauf, Mekkas Zustand vor Mohammed in den aller düstersten Farben zu schildern. Das Handelszentrum sei "ein Pfuhl des Lasters" gewesen und die Kaaba allein Heimstatt von mehr als 300 Göttern. Da auch wir aufgrund eines christlich erziehungsbedingten Vorurteils ein Ein-Gott-System für moralisch höherwertig halten als eine pluralistische Göttergesellschaft, fällt es daher schwer, der Zeit vor Mohammed gerecht zu werden. Mekka war eine "heilige Stadt", und das bedeutete damals wie noch heute im asiatischen Raum: Rechtssicherheit und Handelsfreiheit, etwa unserem mittelalterlichen "Burgfrieden" vergleichbar. Die Götter wachten darüber, dass auf dem Basar und um das Heiligtum die sonst üblichen Stammesfehden ruhten, und als äußeres Zeichen des Friedens waren an dem heiligen Platz alle Stammesgötter gleichberechtigt. Die meisten Götter Mekkas waren daher Schutzpatrone arabischer Stämme. Normalerweise reisten sie unsichtbar mit den Ihren - in der Kaaba aber hinterließen sie ihr Abbild, zum Zeichen, dass sie hier gewesen und auf dem Basar im Umkreis was mitzureden hatten. Ihr Gastgeber war Hobal, Gott der einstigen Herren Mekkas. Wir wissen nicht viel über ihn, aber die Silbe "bal" im Namen des Gottes lässt vermuten, dass hier einst Lieferanten der Phönizier waren. Hobal war Mondgott, "der erfrischende, tauspendende", und außerdem Inhaber einer Kuriosität,
die zu bestaunen Araber von weither kamen: Ihm gehörte ein echter Meteorit, glashart und pechschwarz, unter furchtbarem Gezisch vom Himmel gefallen. Mit diesem erstaunlichen Stein übertraf Hobal mühelos eine Kollegin, die ebenfalls aus Phönizien zugewandert sein dürfte. Sie hieß Ellat und war aus dem Schaum des Meeres geboren. Die Griechen haben sie als Aphrodite und die Römer als Venus adoptiert. In der Wüste aber verlor die Dame ziemlich bald ihre sinnlichen Eigenschaften. Zunächst änderte sie ihren Namen in Allah und dann sogar ihr Geschlecht. Um das Jahr 300 war aus der Dame ein Mann geworden. Doch die Geschlechtsumwandlung dürfte nicht ganz zur Zufriedenheit der Gläubigen ausgefallen sein bereits kurze Zeit später zog Allah auch seinen Körper aus und wurde eine unsichtbare Gottheit. Aber auch eine undefinierbare und damit eine ziemlich unbedeutende. Allah endete als Firmengott eines Handelsunternehmens, und in dieser Funktion hatte er zahlreiche, meist wichtigere Kollegen. Denn ein beachtlicher Teil der Götter Mekkas repräsentierten ausschließlich Firmen und Geschäftsverbindungen, etwa unseren heutigen Warenzeichen vergleichbar. Manche von ihnen waren weit gereist. Da gab es beispielsweise Siwaa, einen tanzenden Mann in einem Schlangenkreis. Er war aus Indien eingewandert, hieß dort Schiwah und war eine uralte Gottheit aller germanischen Völker. Die Griechen führten ihn als Zeus und die Germanen Mitteleuropas als Ziu. Auch der Gott Wedd zu Mekka hatte einen germanischen Verwandten ebenfalls einäugig und mit dem Namen Wotan. Sie wurden höchstwahrscheinlich von arabischen Indien Fahrern adoptiert und unterschieden sich durch ihre handfeste Körperlichkeit gründlich von ihren arabischen Kollegen, die überwiegend in Sternen verehrt wurden als Orientierungshilfen in der Wüste. Alle Götter aber sorgten für den Umsatz Mekkas denn ihre imponierende Versammlung war ein gewaltiger Anreiz, Mekka zu besuchen - in Form einer Pilgerreise, bei der man auch seine Geschäfte erledigen konnte. Unser christliches Mittelalter hat diese heidnische Tradition kräftig fortgeführt. Jede Stadt sammelte eifrig "Heiligtümer", Knochen und sonstige Hinterlassenschaften aller möglichen Heiligen, die in prunkvollen Schreinen verwahrt und fallweise hergezeigt wurden.
Solche "Heiltumsfahrten" brachten oft über hunderttausend Gläubige auf die Beine, da sie stets mit einem kräftigen Sündennachlass verbunden waren. Als Zehrgeld nahmen die frommen Pilger meist gefragte Waren ihrer Heimat mit, um sie am heiligen Ort zu verhökern. Dadurch entstanden im Dunstkreis der Frömmigkeit blühende Märkte, deren jämmerliche Reste noch heute in den Devotionalienständen süddeutscher Wallfahrtsorte fortleben. Nebenbei besorgten die Pilger auch die sozialen Aufgaben der heiligen Städte. Wer die Götter besuchte, musste ihnen auch eine Kleinigkeit opfern, meist Lebensmittel für die Armen. Und da auch die frömmsten Pilger nach wochenlanger, frauenferner Reise auf gewisse körperliche Bedürfnisse nicht verzichten mochten, hatten auch manche alleinstehende Damen des Ortes einen Nebenverdienst. Mekka beispielsweise konnte seinen Besuchern bereits im Jahr 300 mit 74 Massagesalons dienen. Zu jener Zeit war aus dem Handelsknotenpunkt ein gut funktionierender Stadtstaat geworden. Der Kämmerer verwaltete den Schlüssel der Kaaba und somit die Staatsbank. Er hieß von Amtswegen Hedschajet. Der Rekadet war Inhaber der Gastgewerbekonzession. Der Liwa kommandierte die Polizei und die Armee in Friedenszeiten, stand aber in Kampfzeiten unter dem Kommando eines eigens ernannten Generals um Militärdiktaturen vorzubeugen. Reisende Händler wurden gleich zweimal zur Kasse gebeten: Ein Marktbeamter kassierte im Namen der Stadt Platzmiete, ein weiterer im Namen der Hausbesitzer "Schattenmiete". Und dann gab es auch noch den Sakajet, den "Becherbewahrer". Er war für die Wasserversorgung der Stadt verantwortlich und unterstand wie seine Kollegen dem Redwet, dem Stadtparlament. Die Wirklichkeit war natürlich lange nicht so schön wie die Verfassung. Dafür sorgte schon das arabische Stammesbewusstsein. Mekkas Verhängnis war, dass sich stets mindestens zwei Stämme "um Amt und Ehren" bewarben und keiner mit dem anderen teilen wollte. Seit dreißig Jahren schon prügelten sich die aus Meschkar zugewanderten Dschorhem mit den ursprünglich weiter im Süden lebenden Chossaa um die Ehrenämter der Stadt. Sie hätten es auch tatsächlich geschafft, dem Gemeinwesen den Garaus zu machen, wäre nicht ein von beiden Seiten akzeptierter "heiliger Mann" auf die Idee gekommen, vier "heilige Monate" einzuführen, in denen nur Geschäfte gemacht werden durften.
Dschorhem und Chossaa akzeptierten diese Regelung - sonst wäre ja auch von Mekka nichts übriggeblieben, um das sich hätte streiten lassen. Am meisten hatte bei den Streitigkeiten die Wasserversorgung gelitten. Als die Chossaa wieder einmal die gesamte Macht übernahmen, schütteten die Dschorhem den berühmten Brunnen Semsem zu. Wahrscheinlich haben sie ihn auch gründlich verunreinigt, denn die Chossaa verzichteten darauf, den kostbaren Süßwasserquell wieder freilegen zu lassen. Mekkas Trinkwasser bestand von nun an aus einer übelriechenden, salzigen Brühe, die höchstens als Kaffee genießbar war. Im Jahr 350 brachte eine Karawane der Dschorhem aus Indien nicht nur kostbares Elfenbein, sondern auch die Pocken mit. Für die Chossaa erwies sich nun als segensreich, dass sie mit den Dschorhem prinzipiell keinen Verkehr hatten nur Dschorhem starben, und die Chossaa konnten unangefochten die Staatsämter zu Erbpfründen erklären. Die übrigen Bürger Mekkas waren froh dass auf diese Weise der permanente Bürgerkrieg sein Ende fand, und tatsächlich herrschte für die nächsten hundert Jahre in Mekka Ruhe und Ordnung. Natürlich waren nicht alle Mekkaner mit der Alleinherrschaft des Stammes Chossaa einverstanden. Durch die Erblichkeit der Staatsämter war der Kreis der Spitzenverdiener ziemlich beschränkt und daher gab es sogar in ihrem eigenen Stamm so etwas wie Klassengegensätze und Klassenhass. Und dass die überlebenden Dschorhem auch ziemlich unzufrieden waren braucht gar nicht erst gesagt zu werden. Mekkas oberste Zwanzig zeigten ihre menschlichen Schwächen ganz offen. Ebu Gabschan zum Beispiel, der Finanzminister, hatte ein öffentliches Verhältnis mit dem Alkohol. Eines Abends und während eines langen Saufgelages erzählte ihm ein Gast aus dem Stamm Dschorhem von einem besonders guten, Schlauch Schiraz-Wein der in seinem Keller lagere. Der Gast hieß Kossa, zu deutsch "der Ehrgeizige", und muss ein hervorragender Erzähler gewesen sein, Ebu Gabschan nämlich lief das Wasser im Munde zusammen und er wollte unbedingt von dem Wundergetränk kosten.
Kossa aber war auch ein hervorragender Kaufmann er reizte den Preis so lange, bis ihm Ebu Gabschan sein Staatsamt für den Weinschlauch versprach. Kossa ließ sich das schriftlich geben und rannte los. Noch am selben Abend wurde der Schlauch bis auf den letzten Tropfen geleert, und am nächsten Morgen marschierte Kossa mit der Urkunde zur Kaaba und verlangte die Schlüssel zur Staatskasse. Gleichzeitig rannte Ebu Gabschan mit brummendem Schädel zum Gericht und klagte auf Nichtigkeit des Saufhandels. Kossa jedoch hatte als umsichtiger Geschäftsmann auch die Richter geschmiert, und so entschieden die nach den strengen Bräuchen ehrbarer Kaufleute: Gemachte Geschäfte gelten, Reklamationen werden nicht entgegengenommen. Natürlich langte Kossa als Finanzminister tüchtig in die Staatskasse. Das war riskant, denn alljährlich gab es die Hadsch, die Bußreise aller Stadtverordneten: Gemeinsam, leichtbeschuht und unbewaffnet mussten alle Stadtväter siebenmal den Weg Hagars zu Abrahams Brunnen laufen. anschließend war Buchprüfung. Für die Hadsch des Jahres 451 ließ sich Kossa krank melden. Die Stadtväter witterten Unrat und beschlossen, die Bücher ganz besonders genau zu prüfen. Zuvor aber mussten sie das fromme Rennen machen. Sie beeilten sich natürlich und schwitzten bereits kräftig, als sich Kossa doch noch zu ihnen gesellte überraschend und mit einem halben Hundert finsterer Schlägertypen. Daraufhin rannten die Stadtväter erst recht verließen die vorgeschriebene Route und kurz darauf auch die Stadt und wurden nimmer gesehen. Am selben Abend noch hielt Kossa vor der Kaaba eine flammende Rede. Nach der langen Diktatur der Chossaa versprach Kossa eine Rückkehr zur Demokratie. Er selbst wolle dabei mit gutem Beispiel vorangehen sagte er, und: "Bis zur demokratischen Reife der Stadt opfere ich mich daher und übernehme die schwere Last aller Ämter auf meine schwachen Schultern." Die Mekkaner waren von so viel Opfermut durchaus beeindruckt und nannten ihn von nun an Koreisch, den Sammler. Als Diktator erwies sich der Sammler durchaus fortschrittlich. Er legte größten Wert darauf, die Papierform der Demokratie zu wahren. Sogar ein Rathaus ließ er erbauen, und dort residierte tatsächlich ein gewählter Stadtrat. Männliche Bürger Mekkas durften ab dem vierzigsten Lebensjahr dabei mitwirken, Verwandte Koreischs hingegen ohne Rücksicht auf Alter und Geschlecht.
Überhaupt war Koreisch ein vorbildlicher Familienvater. Seine eigene Nachkommenschaft teilte er nicht in Sippen auf, wie bis her üblich war, sondern gleich in Stämme, und denen hinterließ er bei seinem Tod im Jahr 470 nicht nur sämtliche. Ämter der Stadt, sondern auch die vier wichtigsten Basarstrassen erworben aus privatisierten Mitteln der Staatskasse. Vielleicht hätte Koreisch seine Söhne doch nicht zu Stämmen erklären sollen. Da jeder von ihnen Scheich wurde, fehlte von nun an in seiner Nachkommenschaft eine Oberste Instanz zum Schlichten von Streitigkeiten. Bereits unter den Söhnen des Diktators brach ein Bruderzwist aus, der sich mit arabischer Hartnäckigkeit von Generation zu Generation vererben und bis in die Gegenwart die Geschichte des Nahen Osten verhängnisvoll bestimmen sollte. Die Stammväter des arabischen Zwistes heißen Abd-Schems und Haschem und waren Zwillinge. Will man arabischen Chronisten glauben, hatte Allah sämtliche Konflikte zwischen ihnen vorprogrammiert, denn "zwischen den beiden Brüdern floss schon vor der Geburt Blut" - sie kamen als siamesische Zwillinge zur Welt, an der Stirn zusammengewachsen und erst ein griechischer Arzt konnte sie in einer langwierigen Operation trennen. Von nun an stritten die beiden Brüder darum, wer der Ältere von ihnen sei eine lebenswichtige Frage, entschied sie doch die Erbberechtigung. Stammvater Koreisch drückte sich um die Entscheidung und enterbte beide. Natürlich fanden sich Abd-Schems und Haschem mit dieser salomonischen Lösung nicht ab, und nach dem Tod des Patriarchen kam es zur ersten handfesten Auseinandersetzung. Ihre Mutter konnte noch einmal Frieden stiften. Abd-Schems erhielt das Verteidigungsministerium und Haschem die Wasserversorgung samt der Gastgewerbekonzession. Daraufhin schworen die beiden einander Liebe und Brüderlichkeit "solange das Meer Wasser genug hat ein Wollflöckchen zu befeuchten, solange die Sonne den Berg Tahir bescheint solange Kamele durch die Wüste ziehen und Menschen in Mekka wohnen". So lange dauerte der Frieden nicht. Haschem verstarb schon ziemlich bald und hinterließ nur einen einzigen Sohn namens Abdel Mutalib. Ein Sohn ist kein Sohn, sagt ein altes arabisches Sprichwort und Abdel Mutalib galt nicht einmal als kein Sohn.
Zu allem Unglück war er Albino von Geburt an weißhaarig und rotäugig und da half auch nicht, dass er sich die Haare pechschwarz färben ließ. Außerdem war Abdel Mutalib so sanftmütig dass es bereits an Idiotie grenzte Widerspruchslos ließ er sich von den Erben Abd-Schems seine ererbten Ämter abnehmen. Der einzige Protest kam von seiner Mama, einer stolzen Beduinentochter aus Yasrib. Sie mobilisierte ihre Verwandtschaft, die geschlossen nach Mekka marschierte. Dadurch kam Abdel Mutalib wieder zu Amt und Würden - die Achtung der Mekkaner erwarb er sich auf diese Weise natürlich nicht. Für sie blieb der schwarz gefärbte Albino eine Spottfigur. Dass auch er nur einen einzigen Sohn hatte, galt den zeugungsfreudigen Arabern als öffentliches Eingeständnis von Potenzschwäche, und völlig lächerlich machte er sich, als er mit diesem Sohn begann, nach dem lange verschütteten Brunnen Semsem zu suchen. Niemand wusste mehr, wo der schon längst zur Sage gewordene Brunnen lag, und daher brauchte Abdel Mutalib für Spott nicht zu sorgen, als er im Umkreis der Kaaba zu buddeln begann. Zunächst brauchte er sich über Mangel an Publikum nicht zu beklagen, doch als er schon drei Monate lang vergeblich Löcher gegraben hatte, wurde den Mekkanern die Sache zu langweilig, und nur noch gelegentliche Lästerer sorgten bei der Graberei für etwas Abwechslung. Der schlimmste hieß Omaja und war der älteste Sohn des Abd-Schems. Geh lieber nach Hause und mach deiner Frau mehr Kinder, damit du genügend Nachkommen für die Fortsetzung deiner Buddelei findest, rief er eines Tages. Da tat Abdel Mutalib einen verzweifelten Schwur: Wenn mir Gott noch zehn Söhne schenkt, werde ich einen von ihnen Gott Hobal zum Opfer bringen. Fast im selben Augenblick stieß sein Spaten auf Metall. Abdel Mutalib und sein Sohn Abu Talib buddelten fieberhaft - aus der Erde kam eine Rüstung, einige Schwerter, und plötzlich glänzte es golden. Abdel Mutalib hatte einen Schatz gefunden: zwei Gazellen aus reinem Gold. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer durch Mekka. Bereits wenig später war der Platz vor der Kaaba schwarz von Menschen, und als nun Abdel Mutalib mit seinem Spaten gar etwas feuchte Erde aufwarf, begann an Ort und Stelle ein Volksfest - der heilige Brunnen Semsem war gefunden. Abdel Mutalibs Freude darüber war nicht ungetrübt: Die Brut des Abd-Schems machte ihm den Schatzfund streitig.
Gutmütig, wie Abdel Mutalib war, bot er sich an, darum zu losen. Er legte drei Steine in einen Tontopf: Einen für die Kaaba, einen für seine habgierige Verwandtschaft und einen für sich selbst. Gott Hobal gewann die goldenen Gazellen, Abdel Mutalib die Waffen, und die Abd-Schems gingen leer aus. Zwei Tage später jedoch waren die goldenen Gazellen aus der Kaaba verschwunden. Abdel Mutalib brauchte nicht lange zu suchen: Er fand sie im Haus seines Cousins Omaja. Das aber war nun nicht einmal ein schlechter Scherz: Nach dem strengen Gesetz der Wüste wurde dem Dieb eine Hand abgehackt. Abdel Mutalib aber ließ auf dass sich derlei nicht wiederhole, die Gazellen einschmelzen und zu Türbeschlägen der Kaaba umarbeiten. Zur Verschönerung des Bauwerks opferte er auch die von ihm gefundenen Waffen - sie wurden das erste feuerfeste Portal der heiligen Staatsbank. Überhaupt war dieses Ereignis der Wendepunkt im Leben Abdel Mutalibs. Er hatte den Respekt der Mekkaner gewonnen und da Omaja nach der kriminellen Tat natürlich auch von Ehrenämtern ausgeschlossen war - auch das Verteidigungsministerium. Und dieses nutzte er so klug, dass er schon nach wenigen Jahren wie sein Urgroßvater Koreisch alle Ämter in seiner Hand vereinigen konnte. Auch im Privatleben bewies Abdel Mutalib von nun an unerhörte Energie. In nur zehn Jahren gebar seine Frau elf weitere Söhne, und dann erinnerten ihn seine Verwandten aus der Sippe Omaja an seinen Eid, den er einst bei der Brunnensuche getan hatte. Bei aller Macht konnte sich auch Abdel Mutalib nicht leisten, Gesicht zu verlieren. Schweren Herzens schrieb er die Namen seiner zwölf Söhne auf Holzklötzen, füllte sie in einen Tontopf und begab sich damit vor den schwarzen Stein des Gottes Hobal an der Kaaba. Vor einer Unmenge schadenfroher Mekkaner schüttelte er zaghaft den Topf und heraus fiel das Klötzen Abdallah. Natürlich hatte Abdel Mutalib nicht ernsthaft vor, ein eigenes Kind zu schlachten, und so zog er mit Abdallah vor die Stadt zu einer Höhle. Dort residierte eine uralte Dame namens Sidschah als hoch bezahlte Staatsprophetin. Sidschah hörte sich die traurige Geschichte an, dann fragte sie: "Was kostet auf dem Basar ein Totschlag?" "Zehn Kamele".
"Das ist eine Verhandlungsbasis für Gott. Gehe hin und stelle auf eine Seite den Todgeweihten, auf die andere zehn Kamele. Dann wirf das Los. Fällt es auf den Jüngling, ist er gerettet, wenn nicht, stelle weitere zehn Kamele dazu und lose weiter jeweils um zehn Kamele bis das Los auf Abdallah fällt". Abdel Mutalib tat wie geheißen. Sein Sohn kam ihm dabei teuer zu stehen ganze hundert Kamele. Sie wurden vor der Kaaba geschlachtet und zu "Götterspeise" verarbeitet, zu Festbraten für die Mekkaner. Die entdeckten dabei allerdings einen bitteren Nachgeschmack: Die Angelegenheit war ein himmlischer Präzedenzfall, und von nun an kostete ein Totschlag hundert Kamele. Dieser horrende Preis erschien den ehrbaren Mekkanern weniger als Anzeichen für eine Wertsteigerung menschlichen Lebens, sondern eher als ein schlimmes von Inflation.
Die ganze Geschichte wirft ein bezeichnendes Licht auf den Zustand Arabiens in jener Zeit. Menschenopfer waren auf der Halbinsel gut zweitausend Jahre lang nicht einmal Diskussionsgegenstand gewesen. Den letzten diesbezüglichen Versuch soll ja Abraham mit seinem Sohn Isaak unternommen haben, und von da an wuchs Gras über den grausigen Brauch. Tieropfer waren natürlich üblich und hatten durchaus auch eine soziale Funktion - zum anschließenden Opfermahl wurden ja nicht nur die eigenen Familienangehörigen sondern auch die stets um die Tempel herumlungernden Sozialfälle eingeladen. Dabei aber gebratene Familienangehörige zu servieren, war undenkbar. Dass sich jemand zu Mekka im Jahr 550 n. Chr. wieder ernsthaft den Kopf über derlei zerbrach war daher ein durchaus ernstes Zeichen von moralischem und kulturellem Verfall. Die Ursachen dafür lagen in der ersten großen Weltwirtschaftskrise die unsere Geschichtsbücher registrieren. Das Imperium Romanum war nicht nur die absolute Großmacht im Mittelmeerraum, sondern auch für die gesamte Wirtschaft der Alten Welt bestimmend. Der Außenhandel des Reichs war offiziell Staatsmonopol, und daher bedeutete jede Kriegserklärung der Römer auch den Wirtschaftskrieg. Tatsächlich wurden viele Siege der Cäsaren nicht auf dem Schlachtfeld errungen sondern durch Boykott.
In den Grenzorten saßen sogenannte Pragmatiker, Außenhandels-Konzessionäre, die direkt dem Außenministerium unterstanden und deren Geschäftsverbindungen nach Osten bis China und Ceylon reichten. Sie besorgten auch den einige Jahrhunderte dauernden Kampf zwischen Persien und dem Imperium. Nur Wolle und das unentbehrliche Erdöl für Lampen und Militär durften die persische Grenze passieren der Indien- und Chinahandel aber wurde über Arabien abgewickelt, ein Grossteil des Afrikageschäfts auch und damit war die Halbinsel reich geworden. Nun aber zerfiel das Imperium, und der Sturz Roms wirkte selbst im fernen China wie ein Erdbeben. 391 wurde das Christentum Staatsreligion, und Priester begannen die Beamtenschaft zu unterwandern. Leider verstanden sie weder von Verwaltung noch von Wirtschaft auch nur etwas und das musste bereits zur Katastrophe führen. Den völligen Zusammenbruch der Wirtschaft und des Reichs besorgten allerdings germanische Stämme die von den Hunnen bedrängt aus den Weiten Russlands in Richtung Westen zogen die Nordgrenzen des Reichs verunsicherten und schließlich überrannten. Das Jahr 476 markiert das amtliche Ende des Imperiums: Ein Germanenhäuptling namens Odoaker besetzte den Thron der alten Kaiserstadt Rom, und von dem einstigen Weltreich blieb als kläglicher Rest der Ostteil mit der neuen Hauptstadt Konstantinopel. Am schlimmsten traf die ganze Entwicklung die arabische Halbinsel. Innerhalb eines Jahrhunderts wurde ihr Lebensstandard um ein gutes Jahrtausend zurückgeworfen. Wirtschaftlich autark war Arabien nie und daher selbst bei Grundbedarfsgütern auf Außenhandel angewiesen. Die einzigen Waren arabischer Herkunft waren ausgesprochene Luxusgüter: Gold, Perlen, Korallen, Kunsthandwerk, und davon kann man in Notzeiten nicht leben. Der Getreidebedarf war bei römischen Händlern gedeckt worden, und so führte das Ende des Imperiums in Arabien zu einer grauenvollen Hungersnot. Während um das Jahr 200 die Gesamtbevölkerung der Halbinsel etwa drei Millionen Menschen zählte betrug sie um 550 nicht einmal mehr eine Million. Die einst hochentwickelte Rechtspflege war wieder auf den Stand der Blutrache gesunken und auch sonst konnte von Lebensqualität keine Rede mehr sein. Das Mekka Abdel Mutalibs konnte über dreihundert leerstehende Häuser aufweisen und nur noch etwa 10.000 Bewohner.
Dennoch galt es im arabischen Raum jener Zeit als bedeutende Großstadt und wurde damit eines der Ziele abessinischer Expansionspolitik. Abessinien war ein christliches Land. Seit im römischen Restreich Christen herrschten, wollte der Negus seine Geschäfte direkt und ohne Umweg über arabische Zwischenhändler abwickeln. So planten die Abessinier ernsthaft Arabien in eine Kolonie umzuwandeln. Zunächst stürzten sie das Herrscherhaus von Jemen. Dessen Könige waren seit Jahrhunderten jüdischen Glaubens und daher guten Christen ohnedies ein Gräuel. Als nun einige Christen den Basar der jemenitischen Hauptstadt Sanaa plünderten und deshalb vor Gericht gestellt werden sollten griff Abessinien ein: General Abraha landete mit beinahe 10.000 Mann an der arabischen Küste und führte Jemen heim in das große Reich des "wahren Gottes". Kurz darauf besetzten abessinische Truppen auch die Hafenstädte Mokka und Dschidda. In Sanaa aber erbauten sie eine große Handelsniederlassung in Form einer Kirche. Sie sollte der Kaaba Konkurrenz machen, doch als das christliche Gemäuer knapp nach seiner Fertigstellung bis auf die Fundamente abbrannte, war ein christlicher Kreuzzug gegen das heidnische Mekka fällig. Vor der Kaaba veranstaltete Abdel Mutalib Kriegsrat. Allen Mekkanern war klar, dass sie gegen die abessinische Armee keine Chance hatten. So entschied Abdel Mutalib, da die Kaaba Sitz der Götter sei, solle sie gefälligst von ihren Hausherren verteidigt werden. Um den Rest der Stadt sei es jedoch nicht schade. Noch am selben Tag zogen die Mekkaner mit Sack und Pack davon und verschanzten sich in den Bergen. Die Abessinier waren zu diesem Zeitpunkt nur eine Tagesreise entfernt. Ihr Reiseführer war ein Scheich aus der Nachbarschaft Mekkas namens Abu Regal. General Abraha hatte ihm als Dank für die Gefälligkeit den Statthalter Posten in Mekka versprochen und zum Zeichen dieser Würde ritt Abu Regal bereits in einem versilberten Gehäuse auf einem Elefanten daher. Das war allerdings nichts gegen den Aufzug Abrahas: der thronte in einer goldenen Kiste auf einem schneeweißen Elefanten. In Mogammis, drei Reitstunden vor Mekka, erkundigte sich Abraha wieder einmal nach dem Weg. Abu Regal in seinem silbernen Käfig antwortete nicht. Besorgt ließ Abraha das Gehäuse öffnen - Abu Regal War tot. Schon am Vorabend hatte er über Übelkeit geklagt, und so nahm Abraha an, sein Führer sei durch einen Agenten Mekkas vergiftet worden.
Er ließ seine Armee halten und befahl, den Verräter in einem Ehrengrab beizusetzen. Das Grabmal steht heute noch und wird von sämtlichen Mekka pilgern als das eines Teufels gesteinigt. Es ist eine schlicht gemauerte Säule mit einem primitiv eingekratzten Kreuz. Der Begräbnisritus selbst dürfte allerdings nicht ganz christlich gewesen sein - im Grab Abu Regals wurden später zwei goldene Gazellen gefunden ähnlich jenen, die Abdel Mutalib im Brunnen Semsem ausbuddelte und daraus können wir auf einen altarabischen Kult schließen oberflächlich mit einem Kreuz garniert. Noch während Abu Regal in die Grube gelegt wurde, stellte sich heraus, dass die Mekkaner an seinem Tod unschuldig waren: Im Lager brachen die Pocken aus. Die Seuche traf die Armee mit der Wucht einer Explosion. Fast alle Soldaten erkrankten gleichzeitig, und als einer der ersten starb General Abraha, noch in seinem goldenen Käfig auf dem weißen Elefanten. Einige Tage später konnten die Mekkaner in ihre unversehrte Stadt zurückkehren. Was sich ereignet hatte konnten sie nur als Wunder auffassen, und als Wunder wurde die Tragödie der abessinischen Armee auch kolportiert. Siehst du nicht, was der Herr getan hat mit dem Besitzer des Elefanten? Wie seine Truppen in den Wahnsinn rannten? Er sandte wider sie der Vögel dichte Scharen. Er bewarf sie mit Steinchen aus gebranntem Ton und sie flogen wie Spreu im Winde davon. So beschrieb rund sechzig Jahre später ein Enkel Abdel Mutalibs das Ereignis. Man sollte ihm diese ungenaue Beschreibung einer Seuche nicht übel nehmen - Mohammed verstand nicht viel von Medizin. Abessiniens Traum von der Großmacht war damit zu Ende, die Krise Arabiens und besonders von Mekka jedoch noch lange nicht. Mit dem Basar um die Kaaba ging es weiter bergab und um das Jahr 580 zählte Mekka nur noch sechs große Handelshäuser und etwa 40 Kleinbetriebe. Daneben waren fast 70 % aller Mekkaner arbeitslos und konnten auch nicht von Ackerbau leben. Die Schuld daran sahen viele Bürger Mekkas interessanter weise in der Führungsschwäche Abdel Mutalibs. Auf dem Papier war er zwar Diktator doch in Wahrheit reichten seine Machtbefugnisse nicht sehr weit. Er konnte sich nicht einmal gegen die Clans in Mekka durchsetzen und daher war auch eine konzertierte Aktion zur Konjunkturbelebung zuviel von ihm verlangt.
Die Besitzenden in der verarmten Handelsstadt schworen natürlich freie Unternehmertum und auf die freie Marktwirtschaft, das die pluralistische Gesellschaft. Die Arbeitslosen Mekkas aber sehnten sich nach einem starken Mann. Das haben Wirtschaftskrisen so an sich.
|
|
Mohammed Mehr Profit als Prophet
|
|
|
Der von der Vorsehung auserwählte Retter wurde am 20. April des Jahres 571 geboren. Bereits seine Geburt war eine Elementarkatastrophe - zumindest behaupten dies seine Jünger. In derselben Sekunde nämlich soll ein Erdbeben den persischen Kaiserpalast zerstört haben, der berühmte See von Sawa zu einer Wüste ausgetrocknet sein, und Wolkenbrüche sollen die Wüste Samawa in einen See verwandelt haben. Auch im Familienkreis ereignete sich Ungewöhnliches. Amina, die Mutter, gab angeblich folgendes zu Protokoll: "Als die Zeit meiner Entbindung nahte besuchten mich Afia, die Ziehmutter von Moses, sowie seine Schwester Maria samt einigen Engeln. Sie reichten mir einen Trank, der aussah wie Milch und süßer war als Honig. Dann öffnete Gott meine Augen und ich sah drei Fahnen - im äußersten Osten, im äußersten Westen und die dritte auf der Kaaba. Als dann Mohammed geboren wurde, erstrahlte ein Licht über die Erde, dass ich sogar die Schlösser von Damaskus hell erleuchtet sehen konnte. Eine Wolke senkte sich hernieder und eine Stimme rief: ‚Zieht für Mohammed einen Kreis um die Welt und stellt ihn über alle Engel, Geister Menschen und Tiere. Gebt ihm Adams Gestalt Seths Wissen, Noahs Tapferkeit, die Liebe Gottes zu Abraham, Ismaels Beredsamkeit, Isaaks Schönheit Lots Weisheit, Jakobs Fröhlichkeit, Moses Stärke, Hiobs Geduld Jonas Demut Josuas Kriegskunst, Davids Stimme, Daniels Frömmigkeit, Johannes Standhaftigkeit und Jesu Enthaltsamkeit.‘ Dann hob sich die Wolke und ich erblickte drei Männer, einen mit einer Silberkanne, den anderen mit einem Waschbecken aus Smaragd, den dritten mit einem Seidentuch und einem Siegel. Sie wuschen Mohammed siebenmal, dann drückten sie das Siegel des Prophetentums in seinen Rücken und hüllten ihn in das Seidentuch. Daraufhin entwickelte sich der Knabe natürlich prächtig. Als er zum ersten Mal gestillt wurde rief er: `Gott ist der Größte, gepriesen sei er des Morgens und des Abends es gibt nur einen Gott, heilig, heilig.´ Menschenaugen schlafen, aber er schläft und schlummert nicht. Mit drei Monaten konnte Mohammed stehen mit Vieren an der Wand lang, mit Fünfen frei mit sechzehn schon sehr schnell und mit sieben Monaten gar auf der Strasse laufen.
In seinem achten Monat konnte Mohammed sich verständlich machen, einen Monat später schon richtig sprechen, und in seinem zehnten Lebensmonat war der Prophet ein Meister im Bogen schießen." Natürlich war alles ganz anders. Mohammeds Vater war jener Abdallah, dessen Leben Abdel Mutalib von den Göttern mit hundert Kamelen freigekauft hatte. Ob sich diese Investition gelohnt hat, darf bezweifelt werden selbst die wohlwollendsten Chronisten können von Abdallah nur berichten, dass er schön gewesen sei, und das ist auch für arabische Verhältnisse zu wenig. Als fürsorglicher Familienvater hatte Abdel Mutalib, kaum war er Mekkas unumschränkter Herrscher geworden, jeden seiner Söhne mit einer ganzen Basarstrasse ausgestattet. Für seinen Lieblingssohn Abdallah suchte er außerdem noch eine Braut mit besten Geschäftsverbindungen aus – Amina Tochter des angesehensten Handelshauses in Yasrib, dem heutigen Medina. Doch Abdallah war kein Geschäftsmann. Wie er dieses für damalige Zeiten ungeheure Kapital durchbringen konnte wissen wir nicht nach einem Jahr bereits wurde die Basarstrasse unter Abdallahs Gläubiger verteilt. Dieser Überfluss an Mangel von Geschäftsgeist erzürnte sogar den geduldigen Papa und er ließ seinem missratenen Lieblingssohn per Anschlag an der Kaaba mitteilen, dass mit einer Unterstützung von seiten der Familie nicht mehr zu rechnen sei. Daraufhin reiste der jugendliche Pleitier zu seinem Schwiegervater und versuchte, ihn anzupumpen. Was bei dieser Gelegenheit in Yasrib verhandelt wurde wissen wir nicht. Nur: Kurz darauf starb Abdallah, und der Schwiegervater brachte den Göttern ein Sühneopfer dar. Daraus lässt sich mit ziemlicher Sicherheit schließen dass auch der Clan in Yasrib jede Unterstützung verweigerte und Abdallah in einem Anfall von Verzweiflung Selbstmord beging. Das Sühneopfer sollte die schwiegerväterliche Familie von jeder Schuld an dem bedauerlichen Vorfall reinwaschen. Zwei Monate später wurde Mohammed geboren. Kostkind bei Beduinen Amina die junge Witwe und Mutter besaß zu diesem Zeitpunkt als gesamtes Vermögen ein kleines Haus eine abessinische Sklavin und fünf Kamele, nach einigen Berichten auch eine Handvoll Schafe.
Das hätte für ein einfaches Leben durchaus ausreichen können, doch Amina war viel zu aristokratisch erzogen, um sich auf kleinem Fuß zurechtzufinden. Zumindest sämtliche Statussymbole wollte sie wahren, und dazu gehörte, das eigene Kind auf keinen Fall selbst zu stillen. Noch heute geben vornehme Mekkanerinnen ihre Neugeborenen zu Beduinensippen. Das Wüstenklima sei gesünder, meinen sie, und haben damit sicher recht. Damals wie heute dienten in vielen arabischen Städten die Strassen auch als Kanalisation, und so kursierten im einstigen Mekka nicht nur alle möglichen exotischen Waren, sondern auch mal die Pocken mal Pest, fallweise Typhus und Cholera, und nur eines von drei Kindern in Mekka überlebte damals sein erstes Lebensjahr. Wer sich's daher leisten konnte, ließ seine Kinder in der bakterienärmeren Wüste aufwachsen, wobei vornehme Damen als Zusatzargument noch erwähnten dass auf diese Weise ihre Brüste länger straff blieben. Die weniger eitlen Beduinenfrauen machten daher ihre Brüste zu Goldgruben. Zweimal im Jahr kamen sie nach Mekka zum "Markt der vollen Brüste". Im Frühling und im Herbst hockten sie je drei Tage lang unter gelben Sonnensegeln vor der Kaaba und zeigten ihre Milchvorräte, und Abdel Mutalibs Polizei sorgte dafür, dass nur Familienväter und -mütter diese Attraktion bestaunen durften. Amina hatte bei ihrer Suche nach einer Amme ausgesprochenes Pech. Als der Prophet geboren wurde, schloss der Frühjahrsmarkt gerade seine Pforten, und Amina musste daher bis zum Herbst ihren Kleinen selbst stillen. Die junge Mutter hielt das für eine derartige Schande, dass sie allen Bekannten erzählte, ihre uralte und kinderlose Sklavin leiste in Wahrheit die Ammendienst. Dann kam der Herbstmarkt, und Amina hatte nicht das nötige Geld. Als der Markt zu Ende ging saßen nur mehr zwei Frauen auf dem weiten Platz: vor den Segeln Amina mit ihrem Mohammed, unter den Segeln Halima aus dem Stamme Saab. Ihre Brüste waren zu klein gewesen, und sie wusste, dass ihr Mann sie furchtbar verdreschen würde, wenn sie ohne Säugling nach Hause käme. Genau zum Sonnenuntergang, also buchstäblich in letzter Minute wurden die beiden Frauen handelseins. Halima nahm ein trächtiges Kamel in Zahlung und zog mit Mohammed in die Wüste. Die tüchtige Amme In der Folgezeit entwickelte die Frau mit den kleinen Brüsten großen Geschäftsgeist In der ahnungslosen Amina hatte sie aber auch eine ideale Partnerin gefunden. "Der Knabe entwickelt sich prächtig", erfuhr die Mutter, "und trinkt leider aus meinen Brüsten das Doppelte der vertragsmäßig vorgesehenen Menge. Um Nachzahlung wird daher gebeten". Schweren Herzens ging daraufhin Amina ihren Schwiegervater um Kredit an. Einen Monat später trank der Prophet bereits das Vierfache der menschenüblichen Milchmenge und nach zwei Jahren waren bereits sämtliche Verwandte Aminas um Kredit angegangen worden. Dann tauchte plötzlich Halima selbst in Mekka auf: Sie hänge so an dem Knaben dass sie ihn sicherheitshalber gar nicht erst mitgebracht habe. Außerdem sei er noch lange nicht entwöhnt und brauche ihre Mutterbrust noch mindestens drei Jahre. Amina glaubte das Ammenmärchen und verpfändete ihr Haus. Kurz darauf bekam es jedoch Halima mit der Angst zu tun: Ihr Ziehkind wurde immer häufiger von Krämpfen befallen. Mohammed begann plötzlich zu brüllen. Schaum trat aus seinem Mund, und schließlich lag er da, steif wie ein Brett und scheinbar tot. Halima aus dem Stamme Saab hatte natürlich keine Ahnung von Epilepsie und glaubte böse Dämonen hätten von dem Kleinen Besitz ergriffen. Schleunigst brachte sie ihn zurück nach Mekka. Vor dem Stadttor suchte Halima noch schnell ein stilles Plätzchen auf. Als sie ihre Röcke gerichtet hatte, war ihr Ziehkind verschwunden. Daraufhin rückte die Amme ohne Mohammed bei der Mutter an. Die rannte zu ihrem Schwiegervater und Abdel Mutalib ließ durch seine Polizei die ganze Stadt absuchen. Erst spät am Abend wurde Mohammed gefunden, schlafend unter einem Baum am anderen Ende der Stadt. Nun gab es eine hässliche Szene. Halima wurde der Vernachlässigung ihrer Sorgfaltspflicht beschuldigt. Da schrie die Beduinenfrau es sei doch einfach unzumutbar einen von bösen Geistern besessenen Bankert aufzuziehen. Das empörte wieder Abdel Mutalib und er ließ die Amme aus der Stadt prügeln. Erst später bemerkte Amina, dass bei dieser Gelegenheit auch ihr letzter Schmuck mitgegangen war. Nach all dem was bekannt ist, darf angenommen werden, dass sich Halima mehr um ihr Geld als ihr Ziehkind gekümmert hat,
und Wissenschaftler in unserem Jahrhundert haben sorgfältig alle möglichen Schäden untersucht, die bei derart vernachlässigt aufgewachsenen Menschen auftreten können. Auch die rosigst gefärbte Lebensbeschreibung des Propheten liefert Psychologen anschauliches Illustrationsmaterial, welche psychischen Schäden in Mohammeds frühkindlicher Phase angerichtet wurden. Zärtlichkeiten dürfte der Kleine kaum empfangen haben, und seine Anfälle dürften hierin ihre Ursache haben: litt der Prophet unter - mühelos als Anfälle von Epilepsie erkennbaren - Visionen, beruhigte er sich immer erst, wenn er von einer seiner Frauen auf den Schoss genommen und wie ein Kind gestreichelt und geschaukelt wurde. Zum Orgasmus kam er nur, wenn er an den Brüsten einer Frau saugen durfte, aber gleichzeitig haue er bis an sein Lebensende gespannte Beziehungen zum anderen Geschlecht, die auch seine Anhänger nur als Hassliebe beschreiben können. Nur zwei Arten von Frauen reizten den Propheten - wesentlich ältere und skandalös jüngere. Die einen dienten als Mutterersatz, die anderen behandelte er wie kleine Kinder. Seine Lieblingsfrau Aischa, deren wesentlichste Mitgift eine Kollektion Puppen war, nahm er vier Ehejahre lang nur auf den Schoss und erzählte ihr Geschichten, ehe er sich an seinem fünften Hochzeitstag zu einem Beischlaf entschloss. Dass Mohammed eine gestörte Beziehung zu seinem Unterleib hatte, erhellt auch eine Episode aus seinem fünfunddreißigsten Lebensjahr. Da bauten die Mekkaner wieder einmal die von einem Regenguss zerstörte Kaaba auf. Auch Mohammed werkte mit, nackt wie alle anderen. Da ertönte eine Stimme von oben: Mohammed, bedecke deine Scham! Und von Stund an wurde der Prophet niemals mehr nackt gesehen. Ob die Stimme von Gott kam oder von einem Freund oder einfach aus der Einbildung Mohammeds, wurde nie geklärt, aber noch heute ist strenggläubigen Muslims strengstens verboten, in Augenschein zu nehmen, was den Mann von der Frau unterscheidet. Berühren darf man diese Körperteile notfalls - betrachten aber nie. Und auch der einfache Geschlechtsverkehr besudelt den menschlichen Körper ebenso schrecklich wie ein Mord : in beiden Fällen ist eine rituelle Waschung des gesamten Körpers nötig. Was sich für Muslims als Propheten- und somit Gotteswort dar stellt, bezeichnen Psychiater gemeinhin als Sexualkomplex, erworben in der frühkindlichen Phase.
Amerikanische Wissenschaftler haben in unserem Jahrhundert Kinder untersucht, die unter der Jugend des Propheten vergleichbaren Umständen aufwuchsen Heimkinder, Kinder bei Adoptiv- und Zieheltern, wobei die Knaben mehr Umgang mit Frauen als mit Männern hatten. Das statistische Material erhellt auch einige Charakter- Merkmale des Propheten: Von den 594 erfassten Jugendlichen zeigten 85 % ein übersteigertes Geltungsbedürfnis. Die meisten träumten von Führerrollen und mehr als die Hälfte von ihnen brachte es später durch Ellbogentaktik zu einem Erfolg im Geschäftsleben der mit ihrer Ausgangsposition in keinem Einklang stand. Allerdings: 43 % der Untersuchten scheiterten und fast 30 % gerieten später hoffnungslos in die Kriminalität. Von den Erfolgreichen zeigten wiederum 85 % ein sehr unter durchschnittlich entwickeltes Sexualleben. - Auch an Mohammed, der lange vor der Pille lebte, fällt auf dass er mehr Frauen als Kinder hatte. 69 % der untersuchten Jugendlichen waren bisexuell, 28 % der Befragten ausschließlich homosexuell. Was diesen Punkt betrifft, hat Mohammed selbst eine Faustregel aufgestellt, die heute noch von westlich unbeleckten Muslims eingehalten wird und sich auch als Maßnahme der Familienplanung bewährt hat: Einen Knaben fürs Vergnügen, eine Frau für die Nachkommenschaft. Auch Propheten haben klein angefangen Nach allen Erkenntnissen der modernen Psychologie hatte also die "Nährmutter des Propheten" keinesfalls jene segensreiche Wirkung, die ihr in alten arabischen Chroniken so gerne nachgesagt wird. Als sie mit ihrer letzten unschönen Szene vom Schauplatz der Geschichte abtrat, ließ sie ein knapp dreijähriges krankes und höchstwahrscheinlich verhaltensgestörtes Kind zurück, mit dem nun eine durch totale Weltfremdheit ausgezeichnete Mutter fertig werden musste. Ihre gesamte Habe zu diesem Zeitpunkt waren vier Kamele und die nun schon uralte Sklavin, sowie das kleine Stadthaus, auf dem riesige Schulden lasteten. Doch Amina hatte ihren aristokratischen Dünkel aufgegeben, sie machte nun keine Schulden mehr und kam mit dem Vorhandenen aus.
Als Mohammed vier Jahre alt war, schrieben seine Verwandten alle bisher gegebenen Kredite als Verluste ab, die Familie war somit schuldenfrei und machte auch keine neuen mehr. Dass Mohammed einmal Kaufmann werden sollte, stand schon lange fest. Von seiner Mutter lernte er lesen, schreiben und rechnen, und als er sechs Jahre alt war, sollte er der mütterlichen Sippe in Yasrib vorgestellt werden. In Yasrib, dem heutigen Medina, lernte der Kleine auch all den Luxus kennen, den sich erfolgreiche arabische Geschäftsleute leisten konnten. Bis in sein hohes Alter erzählte der Prophet von den Vasen aus römischem Glas und den Schalen aus chinesischem Porzellan, die er dort bestaunen durfte. Doch sein Großvater besaß nicht nur diesen Stadtpalast mit drei Innenhöfen, sondern auch eine Gartenvilla mit einem Wassertank, der auch als Swimmingpool benutzt wurde. In diesem Planschbecken dessen Reste - eine kleine Pfütze - noch heute von Pilgern verehrt werden lernte der Kleine schwimmen. Eine seltsame Kunst für einen Wüstenbewohner, doch offensichtlich hatte die Sippe vor, den Propheten dereinst im Überseehandel einzusetzen. Einige Judenjungen belachten seine ersten Schwimmversuche. Das vergaß ihnen Mohammed bis an sein Lebensende nicht. Ein halbes Jahr später brach Amina mit Mohammed und ihrer Sklavin wieder nach Mekka auf, in einer Karawane ihres Schwiegervaters Abdel Mutalib. Schon bei der Abreise fühlte sie sich unwohl. Einen Abend später, bei Abwa, musste sie schließlich vom Kamel. Am nächsten Abend war Amina tot. Sie wurde an Ort und Stelle begraben und Barakat, die alte Sklavin brachte Mohammed nach Mekka, zu Abdel Mutalib. Dieser königliche Kaufmann war nun schon über achtzig, aber noch immer äußerst abenteuerlustig. Als Inhaber des größten arabischen Karawanenunternehmens versuchte er nun, was keiner zuvor gewagt hatte: direkte Handelsverbindungen zu anderen Großmärkten unter Ausschaltung des Zwischenhandels. Kaum war Mohammed in seinem Haus, nahm er den Jungen zu seiner bisher weitesten Expedition mit - nach Sanaa in Südjemen. Drei Wochen war die Karawane unterwegs, ängstlich alle Städte umkreisend, die das Niederlagsrecht hatten, wo also sämtliche Waren hätten verkauft und erneut eingekauft werden müssen.
Das Wagnis lohnte sich: die Karawane brachte bisher nie gesehene Goldschätze nach Mekka, und Abdel Mutalib verkaufte sie zu marktüblichen Preisen. Sein Profit war diesmal zehnfach so hoch. Mohammed hatte allerdings nichts davon - von der langen Wüstenreise hatte er ein Augenleiden bekommen und musste zu einem christlichen Mönch in Behandlung gegeben werden. Erst nach einem halben Jahr war er soweit wiederhergestellt dass er zurück nach Mekka und dort in die Geheimnisse der Buchführung eingeweiht werden konnte. Ein Jahr später starb Abdel Mutalib, mindestens zweiundachtzig Jahre alt. Seine Söhne konnten sich nicht einigen, die Firma gemeinsam weiterzuführen, und das war auch das Ende des bis dato größten Handelsunternehmens in Arabien. Erster der Branche wurde nun der Clan in Yasrib. Mohammed hatte auch davon nichts. Mit dem Tod Aminas waren sämtliche Familienbande abgebrochen, und der Kleine kam mit einem Teil der Erbmasse zu seinem ältesten Onkel, Abu Talib. Der war ebenfalls Kaufmann, jedoch ohne das umfassende Talent seines Vaters. Auch nach der Erbschaft war sein Unternehmen nur das dritte Haus am Platz, und die Ehrenämter die Abu Talib von seinem Papa geerbt hatte wusste er nicht umsatzfördernd anzuwenden. Noch weniger konnte er mit Mohammed anfangen. Er schickte den Jungen auf Karawanenreisen mit. Da musste der Junge darauf achten, dass an den Rastplätzen keine Kaffeetassen vergessen wurden. Bei einer dieser Reisen so berichtete der Prophet seien sie von einem christlichen Mönch namens Bahira bewirtet worden, und der habe Abu Talib darauf aufmerksam gemacht, dass aus Mohammed einmal noch etwas ganz Besonderes Würde. Spätere Geschichtsschreiber meinten, Mohammeds erste Begegnung mit dem Eingott-System sei durch diesen legendären Bahira vermittelt worden. Eine etwas kühne These - Bahira hieß in Wahrheit Georgios und war kein Mönch, sondern ein ehemals syrischer Kaufmann und betrieb nun an der Karawanenstrasse ein Rasthaus. Seine christliche Bildung wird nach dem was wir von ihm wissen, das landesübliche Maß nicht überschritten haben, war also höchstwahrscheinlich eine Mischung aus christlichen Brocken in einer bunten Soße arabischen Aberglaubens und wir können annehmen, dass ihm der Kleine einfach leid tat der da still und bescheiden darauf wartete die Tassen ausspülen und verpacken zu dürfen.
Das immerhin konnte Mohammed, und ausschließlich zu diesem Zweck borgten ihn der Reihe nach sämtliche Onkels bei seinem Ziehvater aus. Und bei diesen Gelegenheiten lernte der künftige. Prophet sämtliche Handelsplätze Südarabiens kennen. Als Mohammed zwanzig war, erlebte Mekka einen saftigen Skandal. Ein den Koreischiten befreundeter Kaufmann fühlte sich von seinem Zulieferer übervorteilt und weigerte sich, die bereits empfangene Ware zu bezahlen. Es kam zu einem Raufhandel zwischen den Koreischiten und dem Konkurrenzstamm, und das mitten im Messemonat wo dergleichen strengstens verboten war. Da sie zur unpassenden Zeit ausgetragen wurde hieb die Massenkeilerei später "der lasterhafte Krieg". Mohammed soll, eigenem Bekunden nach, tapfer mit gerauft haben. Hier hat der Prophet allerdings schon wieder die Wahrheit retuschiert. Selbst seine parteilichsten Freunde konnten sich nur daran erinnern dass der zwanzigjährige Jungkrieger nur danebengeschossene Pfeile einsammelte, und Abu Talib schickte Mohammed kurz darauf wegen Feigheit vor dem Feind in die Wüste als Schafhirt. Vier Jahre hütete Mohammed die Schäfchen seines Onkels, und dabei zeigte sich erstmals sein kaufmännisches Talent. Bevor er die Tiere auf den Markt trieb, gab er ihnen reichlich Salz zu lecken. Anschließend ließ er sie nach Herzenslust trinken. Dadurch sahen seine Schäfchen fetter aus und verkauften sich so gut, dass Abu Talib seinen Neffen am Reingewinn beteiligte. Mit vierundzwanzig hatte Mohammed von diesen kleinen Gaunereien genug. Immerhin besaß er nun ein kleines Kapital, nach heutiger Kaufkraft etwa eintausend Mark, und nun wollte er auch Kaufmann werden. Dasselbe wollte auch Sa-ib, ebenso alt und genauso unternehmungslustig. Sa-ib brachte ebenfalls tausend Mark in die Firma ein, und dafür kauften die beiden in Mekka ägyptisches Leinen schlechtester Qualität und fuhren damit auf den Jahrmarkt von Hajascha sechs Tagereisen südlich. Tatsächlich wurden die beiden ihren Ramsch los, und das imponierte sogar Hakim, einem entfernten Cousin des Propheten. Der war nämlich weniger erfolgreich gewesen. Er war im Auftrag seiner Tante nach Hajascha gekommen, mit Leinen allerbester Qualität, und darauf blieb er sitzen. Mohammed war schon längst ausverkauft, als Hakim Dach seinem Cousin rufen ließ. Mohammed besah das reiche Lager, und gegen eine fette Beteiligung betätigte er sich erneut als Verkäufer.
Am Abend war Hakims Stand leer. Gleichzeitig bekam Mohammed Streit mit seinem Partner. Sa-ib fand, ein ehrbarer Kaufmann dürfte doch nicht auch noch die Geschäfte der Konkurrenz besorgen, und das frischgegründete Unternehmen ging unter Wüsten Schimpfworten aus dem Leim. Hakim aber zeigte sich dankbar. Kaum war er wieder in Mekka, stellte er den Nothelfer seiner Tante vor, der Dame Kadidscha. Kadidscha galt als die faszinierendste Frau Mekkas. Sie war bereits vierzig Jahre alt und absolut keine Schönheit mehr, doch sie hatte beträchtliche Reize. Als entfernte Nichte Abdel Mutalibs war sie in zarter Jugend einem angesehenen Kaufmann angetraut worden, den sie bald als Witwe betrauern durfte. Kurz darauf vermählte sie sich mit einem noch reicheren Kaufmann. In die Ehe brachte sie einen Sohn und eine Tochter mit, nicht jedoch die Firma ihres Ersten die führte sie selbst und zwar als Konkurrenzunternehmen. Nebenbei gebar sie noch einen Sohn und noch eine Tochter. Dann aß ihr Gemahl Fische, die den Weg von Dschidda nach Mekka nicht gut überstanden hatten, und Kadidscha war schon wieder Witwe. Kaum vom Begräbnis zurück vereinigte sie die Firmen ihrer verewigten Männer und nannte sie "Islam", zu deutsch "Bekenntnis", sinngemäß "Treu und Glauben". In Mekka schlug die Nachricht dieser Fusion wie eine Bombe ein. Damit hatten die Kaufleute nicht gerechnet - "Islam" war mit einem Schlag das größte Handelsunternehmen der arabischen Welt mit zweitausend Kamelen, fünfzehn Lagerhäusern und über fünfhundert Angestellten. Damit verglichen wirkte selbst Abu Talibs Betrieb wie ein Tante-Emma-Laden, und Kadidscha machte sich daran, ihre Konkurrenz in einem gnadenlosen Preiskrieg zu zermalmen. Bei ihr machte es die Masse und sie konnte sich's leisten, ihre Konkurrenten so lange zu unterbieten bis diese ihre Firmen freiwillig an die streitbare Dame verkauften. Zwölf mittelgroße Handelshäuser hatte der "Islam" bereits geschluckt, als Kadidscha Mohammed in ihrem Büro empfing. Mohammed empfahl sich als unternehmungslustiger junger Mann.
Im Hof stapelten Lagerarbeiter gerade einen größeren Posten indische Seide. Er sollte nach Medina gebracht werden, zu syrischen Aufkäufern. Kaum hatte Mohammed dies gehört, bot er sich an, die Fracht direkt nach Damaskus zu bringen und dort mit doppeltem Profit zu verkaufen. Derlei hatte Kadidscha noch nie versucht - Medina war bisher die Nordgrenze ihrer Expansionsversuche gewesen. Mohammeds Plan klang abenteuerlich, aber vernünftig. Außerdem wollte er's für nur 50 Prozent des über das Handelsübliche hinausgehenden Profits tun. Kadidscha willigte ein, und eine Woche später zog Mohammed mit zweihundert Kamelen Richtung Syrien. Medina und alle anderen Handelsplätze umging er in weitem Bogen, und damit auch die Umsatzsteuer. In Damaskus trat er als christlicher Kaufmann auf, mietete eine Lagerhalle und unterbot seine Konkurrenz auf so unchristliche Weise, dass er für einen heimlichen Juden gehalten wurde. Nach Mekka aber brachte er sage und schreibe zweitausend Prozent Profit mit das machte der Direktexport. So etwas hatte auch Kadidscha noch nicht erlebt. Bei der Abrechnung entfielen auf Mohammed rund 200.000,-- Mark heutiger Kaufkraft, und damit, sagte Mohammed, wolle er sich nun selbständig machen. Das wollte nun Kadidscha keinesfalls. Doch Mohammed erklärte, ein Angestelltenverhältnis, und sei es als Generalbevollmächtigter, fände er unter seiner Würde. Kadidscha beriet sich mit ihrer Sekretärin. Kurz darauf klopfte das Mädchen, Nafisa hieß es, an Mohammeds Türpfosten und kam auch gleich zur Sache: "Mohammed, warum heiratest du nicht? " "Ich habe nicht die Mittel dazu", Sagte der und zählte weiter die soeben vereinnahmten Goldmünzen. "Wenn dich nun aber eine reiche Frau heiraten wollte, die zu gleich schön und von hoher Abkunft ist?" Schon am nächsten Abend fand die Hochzeit statt, und Abu Talib, der die Talente seines Ziehsohnes so fahrlässig verkannt hatte verkündete als Zeremonienmeister sichtlich bewegt: "Lob sei Gott, der uns aus dem Geschlecht Abrahams und dem Stamme Ismaels geboren werden ließ, der uns zu den Hütern der Kaaba bestellte, zu den Herrschern der Welt macht und unseren Reichtum beschützt.
Dieser mein Neffe Mohammed, arm an irdischen Gütern, doch aus dem edlen Stamme der Koreisch, wird Kadidscha heiraten. Dies ist bei Gott eine wichtige Kunde und ein großes Geschäft". Das war es. Ein strahlendes Paar gaben die beiden keinesfalls ab - sie gerade vierzig und er noch nicht ganz fünfundzwanzig. Den Basar aber verdunkelten sie wie Gewitterwolken. Kadidscha plus Mohammed - da konnte man nur noch huldigen und abwarten. Ganz Mekka beeilte sich, den Frischvermählten zu gratulieren. Mohammed war gerührt. Am Morgen nach der Hochzeitsnacht erklärte er feierlich, seine Firma wolle zunächst kein anderes Unternehmen in Mekka schlucken. Das war auch wirklich nicht nötig - schon nach einem Jahr besaß der Islam eigene Niederlassungen in Medina, Südjemen, Mokka und sogar in Damaskus. Auch eine kleine Reederei hatte Mohammed gegründet. Zwanzig kleine Segelschiffe wagten sich stets die Küste im Blickfeld bis nach Indien. An ihrer Mastspitze flatterte die grüne Fahne der Firma Islam. Als Mohammed siebenundzwanzig war landete er einen besonderen Coup. Hindu - Handwerker in Nordindien schnitzten für den arabischen Kaufmann zweitausend kleine Elfenbeinkreuze die dann in Damaskus an Christen verscheuert wurden. Mohammeds Reingewinn: das Einhundertsechzigfache der Gesamtunkosten. Davon musste der erfolgreiche Jungmanager allerdings zwölf Prozent Provision an den Mann zahlen von dem er den Tipp hatte. Der hieß Werka ben Naufal und war ein Schwager Kadidschas, samt der Firma ihres ersten Gatten in die Familie gekommen und als Ratgeber eigentlich unbezahlbar. Naufal beherrschte Persisch, Hebräisch, Griechisch und Latein in Wort und Schrift und erledigte daher die gesamte Auslandskorrespondenz des Unternehmens. Vor allem aber war er Christ und hatte sogar die Bibel ins Arabische übersetzt. Christi Zieht hin in alle Welt jedoch nahm er nicht als Aufforderung zur Mission, sondern eher als göttlichen Ratschlag zur Umsatzsteigerung und mit diesem Onkel als Berater konzentrierte sich Mohammed auf die Christen als erklärte Zielgruppe seiner Marktpolitik. Auch für andere Handelshäuser in Mekka fielen dabei einige Brocken ab. Christen gab's fast überall - in Abessinien in Ägypten und erst recht in Europa. Diesen Markt konnte Mohammed unmöglich allein bewältigen. Vor allem Abessinien und Ägypten überließ er gerne Kollegen vorausgesetzt dass sie sich bei ihm mit indischen Kruzifixen Madonnenbildern aus Byzanz und Reliquien aus Rom eindeckten.
Mekkas Großhändler waren begeistert, und im Überschwang der Gefühle wollten sie sogar ein Kreuz in die Kaaba hängen. Davon aber riet Mohammed ab dann würden ja auch christliche Kaufleute zur Messe nach Mekka strömen, vielleicht gar versuchen den Reibach selbst zu machen und bei der bekannten Profitsucht der Christen wäre dies das Ende von Mekkas freier Marktwirtschaft. Da fanden die Mekkaner, Mohammed habe weise gesprochen, und verliehen ihm den Titel Amin, "der Zuverlässige". Einige Jahre später machte sich Mohammed als weiser Mann erneut zum Stadtgespräch von Mekka. Ein schwerer Wolkenbruch hatte die schon etwas baufällige Kaaba zum Einsturz gebracht, und jeder Bürger Mekkas hatte beim Wiederaufbau Hand angelegt. An der Ostecke einen Meter fünfzig hoch, hatten sie ein Loch gelassen für den berühmten schwarzen Stein. Der war schließlich die Hauptattraktion der Kaaba, von Gott dem Abraham geschenkt oder nach anderer Version vom Himmel auf die Erde gefallen als da oben einige Engel gerade ihre Raufhändel austrugen. Vom Himmel gefallen war der Stein tatsächlich - ein Meteorit, an Struktur und Farbe völlig ähnlich jenen Kieseln, die jüngst unter Milliardenaufwand vom Mond geholt wurden. Um dieses "Gotteswerk aus Luft und Feuer" zu sehen, strömten jährlich Tausende zur Messe und daher stritten sich nun die Sippenbosse der vier angesehensten Stämme Mekkas um die Ehre diesen umsatzfördernden Brocken einmauern zu dürfen. Schon hatte jede Partei Steine genug gesammelt, um eine richtige Schlacht beginnen zu können. Da kam Mohammed, und er beruhigte die Kampfhähne mit einer salomonischen Lösung. Der Stein wurde auf ein Seidentuch aus dem Warenlager seiner Firma gelegt, dann fasste jeder Sippenboss einen Zipfel an und als der Stein in der richtigen Höhe war, nahm sich Mohammed die Ehre ihn einzumauern. Erst hinterher dämmerte den Vieren, dass ihnen ein Fünfter die Schau gestohlen hatte aber da saß Mohammed schon längst wieder in seinem von Leibwachen gesicherten Kontor. Mohammed hatte nämlich Geschäftssorgen während sein Ansehen in der Bürgerschaft Mekkas stieg sanken erstmals in der Geschichte der Firma Islam die Umsätze. Schuld daran waren die Juden. Wer von wem das Handeln gelernt hat die Araber von den Juden oder umgekehrt , war schon zu Mohammeds Zeiten ebenso unbeantwortbar wie die berühmte Frage, ob Henne oder Ei zuerst auf der Welt war. Höchstwahrscheinlich waren beider Lehrmeister die Phönizier die erste Handelsnation der Geschichte, ein Völkergemisch in dessen Stammbaum auch Araber und Juden aufscheinen. Jedenfalls saßen die Juden schon an allen Orten, wo auch Mohammed seine Profite machen wollte. In Palästina gab es kaum welche die alten Römer hatten dort mit den Juden so lange Scherereien gehabt bis Titus mit dem renitenten Volk kurzen Prozess machte. Jerusalem wurde zerstört und über den Tempelplatz der Pflug geführt. Wer das Massaker überlebt hatte, wurde in die entlegensten Provinzen des Römischen Reiches deportiert. Als Displaced Persons blieb dort den Juden nur der Handel und schon nach kurzer Zeit revanchierten sich die zwölf Stämme Israels bei der römischen Armee: Sie wurden deren wichtigste Lieferanten. Mit den Christen gab es ab und zu Schwierigkeiten, vor allem im vorderasiatischen Raum. Die Araber waren schon damals Meister der Gräuelpropaganda und ließen keine Gelegenheit aus, ihren christlichen Kundschaft klarzumachen dass ein guter Christ sich doch unmöglich bei Gottesmördern eindecken dürfe. Was sie verschwiegen: dass viele der heidnischen, also unbelasteten Araber nur Strohmänner jüdischer Unternehmen waren. Denn eines hatten die Juden den mit vielen Göttern in friedlicher Koexistenz lebenden Arabern voraus: eine einheitliche Religion und dementsprechend ein straffes Zusammengehörigkeitsgefühl. Jüdische Handelshäuser gab es in Indien ebenso wie in Damaskus und Mekka aber auch in Rom und Byzanz. Und als Mohammed mit seinem System der Direktimporte begann, entschloss sich auch die jüdische Konkurrenz zu engerer Zusammenarbeit und war plötzlich preiswerter, als der Islam Je sein konnte und wollte. Im Jahr 618, Mohammed war gerade 39 Jahre alt gründete in Damaskus eine Sippe aus dem Stamm Benjamin ein neues Handelshaus. Sein Name war lateinisch "Fides", zu deutsch "Treue" und sein Zweck eindeutig: Handel mit Waren aller Art,
betrieben ausschließlich von Angehörigen des Stammes Benjamin und die waren nun wirklich über die ganze damals bekannte Welt verstreut. Vor allem aber und erstmals in der Wirtschaftsgeschichte gab es einen feststehenden Profitsatz: jeweils fünfzig Prozent. So wenig hatte noch kein ehrbarer Kaufmann zu nehmen gewagt, doch die Bescheidenheit zahlte sich aus. Schon nach einem Jahr musste Mohammed seinen Laden in Damaskus dichtmachen. Wie Kadidscha mit diesem Rückschlag fertig wurde, wissen wir nicht. Offensichtlich hatte sie sich zu diesem Zeitpunkt schon lange aus dem Kontor zurückgezogen. Sie hatte Mohammed vier Töchter geboren, zuletzt Fatima, und angeblich auch sechs Söhne die aber alle bereits im Babyalter gestorben sein sollen. Dass ihr dabei nicht viel Zeit für die Firma blieb, ist einzusehen. Kadidscha wird also das Haus gehütet haben, das nicht viel anders ausgesehen haben dürfte als andere Stadthäuser vornehmer Mekkaner jener Zeit und konservativer Araber heute: möglichst große Räume mit kleinen Fenstern und Holzläden davor, sparsam eingerichtet wie ein großes Beduinenzelt, mit schwarzroten Teppichen und vielen Kissen. Das gefiel natürlich auch den Katzen, die Mohammed so sehr liebte dass stets ein rundes Dutzend durch das Haus schnurrte, und die Kadidschas Bett in kühlen Nächten besetzt hielten. In der Öffentlichkeit ging Kadidscha stets verschleiert wie alle anderen Frauen der Araber und zuvor schon der Phönizier. Da soll doch einer was gegen den Schleier sagen – "Er erspart Kosmetik langwieriges Umziehen und blödes Gegaffe, wenn ich auf die Strasse gehe. Und überdies kann ich alle Leute sehen während ich selbst nicht gesehen werde. Da kann ich auch verschrumpelt und alt sein solange ich noch halbwegs Figur habe, kann mich niemand von einem knusprigen Mädchen unterscheiden erzählte mir einst eine vornehme Araberin und trauerte der guten, alten Schleiermode nach. Der Schleier als Zeichen "weiblicher Freiheit" war noch nie Gegenstand westlicher Erörterungen obwohl unsere Maskenbälle und die einst so beliebten Domino-Umhänge genau denselben Zweck hatten. Von Kadidscha jedenfalls ist bekannt, dass sie den Schleier zu schätzen wusste, und erst recht in der Zeit der Geschäftskrise, wo sie auf der Strasse gewiss genug schadenfrohe Bürger getroffen hätte.
Auch Mohammed zog sich etwas zurück, und da er keinen Schleier zur Verfügung hatte, ging er vorzugsweise in die Wüste. Auf dem Berg Hara hatte er von seinem Großvater Abdel Mutalib eine komfortable Höhle geerbt, und dort verbrachte Mohammed bald ebensoviel Zeit wie in seinem Büro. Mit dem Auto braucht man heute ungefähr zwanzig Minuten von Mekka bis zu diesem Berg, mit dem Kamel wird die Reise zu Mohammeds Zeiten gut eineinhalb Stunden gedauert haben. Dafür bot der Berg Hara eine schöne Aussicht auf die Karawanenstrasse von Dschidda nach Mekka, außerdem noch einen der sehr seltenen Süßwasserbrunnen und vor allem das Gefühl exklusiver Einsamkeit. Mekkas Reiche wussten so etwas zu schätzen. Wo immer in Mekkas Umgebung eine Höhle zu finden war wurde sie in Beschlag genommen - Höhlen waren kühl und solide man konnte sie mit Teppichen auslegen und Nischen in sie meißeln lassen, und vor allem unterschieden sie sich von den ordinären Beduinenzelten wie ein Chalet heutzutage von einem Campingplatz. So gefragt waren Höhlen bei Mekkas Reichen, dass drei Baumeister zu Mohammeds Zeiten voll damit beschäftigt waren der Natur nachzuhelfen, wo sie keine Spalte offengelassen hatte. Ob Mohammeds Höhle eine natürliche oder eine künstliche war, wissen wir nicht. An ihrer Stelle ragt heute ein Betonturm in den Himmel, der jährlich frisch gestrichen wird, und das gesamte Plateau des Berges ist zubetoniert. Die Felsen wurden ebenfalls kräftig angeknabbert, aber nicht vom Zahn der Zeit, sondern von souvenirwütigen Pilgern, die dem weichen Sandstein mit Brecheisen und Taschenmessern zu Leibe rücken. Auch die Aussicht ist lange nicht mehr das, was sie einmal war: Die Mina-Ebene, zu Mohammeds Zeiten ein spärlich grünes Steppenland mit der alten Karawanenstrasse nach Dschidda, ist heute ein trostloses Feld aus geborstenen Hammelknochen. Jeder Mekka-Pilger, der etwas auf sich hält muss hier ein Schaf für die Armen opfern. Doch die auf Öl gebettete arabische Wohlstandsgesellschaft hat mehr Schafe und Fromme als Arme und so wurde die Mina-Ebene ein riesiges absurdes Schlachthaus. Der gottgeweihte Platz stinkt gotteserbärmlich und im heiligen Monat Ramadan wenn Mekkas Schafhändler Hochkonjunktur haben sind zwei Bulldozer voll damit ausgelastet die herumliegenden Kadaver einzubuddeln.
Schuld daran ist ein Ereignis das sich an einem Tag im Monat Ramadan des Jahres 611 zutrug, in Mohammeds vierzigstem Lebensjahr. Der Handelsherr hatte wieder einige Zeit in seiner Höhle verbracht. Ob in Gebet und Meditation wie manche Gelehrten behaupten, ist nicht erweisbar. Auf dem Berg wachsen heute noch kleine verkrüppelte Hanfpflanzen, und da sie bestimmt auch schon damals dort gediehen, kann es durchaus gewesen sein, dass Mohammed davon genascht hat - auf jeden Fall kam er am Abend ziemlich atemlos bei Kadidscha an. Er war schweißüberströmt, gleichzeitig aber zitterte er am ganzen Körper. "Wickelt mich ein! Deckt mich zu", schrie Mohammed und: "Ich fürchte für meine Seele". Ob Mekkas erfolgreichster Unternehmer das erlitten hatte, was heutige Rauschgiftkonsumenten "Horrortrip" nennen oder ob er einen Rückfall in die epileptischen Anfälle seiner Kindheit durchmachte - auf jeden Fall rannte Kadidscha nach sämtlichen im Haus herumliegenden Decken. Es half nichts. Erst als sie ihren Gatten auf ihren Schoss setzte und wie ein kleines Kind wiegte, beruhigte er sich ein wenig. Nach einiger Zeit versuchte Mohammed, wieder zu sprechen. Dabei soll er folgendes gestammelt haben: Steh auf Bedeckter, und predige und verherrliche deinen Herrn. Reinige deine Kleider und meide jede Schandtat, und sei nicht in der Absicht freigebig, dadurch mehr zurückzuerhalten. Nun war auch Kadidscha davon überzeugt dass ihr Gemahl sehr, sehr krank sein müsse. Geben, ohne zurückzuerhalten. . . bisher waren Mohammeds einzige Ausgaben Investitionen gewesen, und eben dieser Mohammed stammelte soeben von furchtbaren Höllenqualen und einem grässlichen Endgericht das ausgerechnet über ehrbare Unternehmer hereinbrechen würde. Schnell ließ sie ihren Schwager holen, den gelehrten und christlichen Werka ben Naufal. Der besah sich den Fall und meinte, da könne nur Gott zugeschlagen haben. Von Stund an war Mohammed von Kontakten mit höheren Wesen überzeugt. Werka, der gelernte Christ, konnte sogar einige der "unbegreiflichen Stimmen" identifizieren, vor allem den Erzengel Gabriel, der in Zukunft zum Botenjungen zwischen Gott und seinem Propheten wurde. Vor allem aber beschlossen die drei Mohammeds Visionen in Mekka und vor allem in der Firma geheimzuhalten.
Das fehlte ja gerade noch: ein Kaufmann mit weltweiten Kontakten, der zusätzlich noch einen heißen Draht zum Unfassbaren hatte. Doch so einfach ging die Sache nicht ab. Schon nach kurzer Zeit erlitt Mohammed einen neuerlichen Anfall. Kadidscha bemühte sich zwar nieder, die Halluzinationen ihres Angetrauten mit warmen Decken zu ersticken, doch es half nicht: "Verhüllter, steh in der Nacht zum Gebet auf... denn tagsüber hast du zuviel anderweitige Beschäftigung. Gedenke des Namens deines Herrn, sondere dich ab von irdischen Gedanken und weihe dich ihm ganz." Und wieder folgte ein entsetzlicher Angsttraum voller grässlicher Höllenstrafen. Doch die Qual hatte auch ein Gutes, denn nun erfuhr Mohammed, wer Gott wirklich war - Allah, der schon längst gestaltlose Schutzgeist der Kaaba, der allerdings in Mekka noch immer eine bedeutende Rolle spielte, als Schutzpatron der Firma Islam.
Wir können Mohammeds Visionen auch durchaus von einem praktischen Gesichtspunkt her sehen: Allah war der Hausgott des Islam - Konzerns, und eben dieser Gott verkündete seinem Manager. Es gibt keinen Gott außer Allah. Dieser Gott befahl dem Konzernherrn, alle anderen Götter schonungslos zu vernichten zufälligerweise aber waren diese anderen Götter die Schutzpatrone der Konkurrenzfirmen. Wollte Mohammed das Monopol? Mit der freien Marktwirtschaft hatte er schließlich schlimme Erfahrungen gemacht. Auf jeden Fall war Mohammed überzeugt: Es gibt keinen Gott als Allah und Mohammed ist sein Prophet. Mit der Zeit war dies auch Kadidscha. Nur Werka ben Naufal, der weise alte Mann, riet Mohammed, diese himmlische Erleuchtung vorläufig für sich zu behalten. Es könnte sonst Arger geben. So kümmerte sich Mohammed die nächsten drei Jahre tagsüber um die Bilanzen und nachts um Allah. Nur die engsten Hausgenossen wussten von dem Doppelleben, mit dem verglichen die Geschichte von Dr. Jekyll und Mr. Hyde geradezu trivial anmutete: tagsüber harter Konzernmanager und nachts schweißtriefender Prophet. Am meisten imponierte dies Ali, einem Sohn Abu Talibs den Mohammed in sein Haus genommen hatte, um seinem Ziehvater die Kosten zurückzuerstatten, die dieser einst mit Mohammed hatte.
Mit zehn Jahren war Ali zu Kadidscha und Mohammed gezogen. Ein Jahr später begannen die Visionen, und das beeindruckte den Kleinen natürlich sehr. Drei Jahre später starb Werka ben Naufal, und nun entschloss sich Mohammed, seine Erkenntnisse aller Welt zugute kommen zu lassen. Als anständiger Araber fing er damit bei seiner Sippschaft an. Die Koreischiten hatten sich im Wohlstand kräftig vermehrt. Obwohl Mohammed nur die Familienchefs des Clans zu einem Gastmahl geladen hatte, fielen gleich vierzig im Haus ein. Der vierzehnjährige Ali fungierte als Kellner, es gab Hammelbraten mit Joghurt. Nach gut arabischem Brauch wurde lange und ausgiebig getafelt. Beim Dessert wollte Mohammed seine Lehre verkündigen, doch sein Onkel Abu Leheb schien Lunte gerochen zu haben. Ehe der Prophet noch seinen Mund auftun konnte, erhob sich der resolute alte Herr und meinte, es sei ja schon so spät geworden, dass es unhöflich sei, die Sippe länger aufzuhalten, und die Verwandtschaft begab sich schnell nach Hause. Was blieb dem Propheten übrig, als das Gastmahl am nächsten Abend zu wiederholen? Schließlich wollte er seine Lehre loswerden. Sicherheitshalber ließ er diesmal nur halbe Portionen auftragen, und daher war es noch ziemlich früh am Abend, als Mohammed anhub: "Ich weiß keinen Araber, der seinem Volk Besseres gebracht hat, als ich euch bringe. Ich bringe euch das Gute dieser und der anderen Welt. Gott befahl mir, euch zu rufen. Wer von euch will mein Wesir sein der Lastträger meines Amtes, mein Bruder, mein Anwalt und Gehilfe?" Die Verwandtschaft schwieg und wusste nicht, was sie von dem Theater halten sollte. Nur der kleine Ali rief: "Ich will deinen Feinden die Zähne brechen, die Augen ausstechen, den Bauch aufschlitzen und den Pimmel abschneiden! Ich will dein Wesir sein." Da umarmte Mohammed den Kleinen und ernannte ihn zu seinem Wesir, Tränen in den Augen. Die übrige Verwandtschaft lachte schallend auf. So betrunken hatten sie Mohammed noch nie erlebt, und bevor er noch weiter entgleiste, verdrückten sie sich lieber. Dass Mohammed an jenem Abend nüchtern war merkten die Koreischiten erst, als sie einige Zeit später zu einem Picknick auf den Berg Ssafa eingeladen wurden.
Auch dort besaß Mohammed eine Wochenendhöhle, und die Sippschaft war mit Kind und Kegel an den Platz geströmt, wo es was umsonst geben sollte. Das Fest endete mit einer allgemeinen Verstimmung. Mohammed begann wieder zu predigen, und diesmal war er nicht zu stoppen. So viel wirres Zeug auf einmal hatte noch kein Koreischit gehört: dass sie alle ihre gutgehenden Firmen aufgeben und allein der Oberhoheit Allahs unterstellen sollten, dass sie bei Verweigerung dieser Fusion nach ihrem Tod in siedendem Schwefel gekocht würden, dass sie ihre Seelen von Allah kaufen sollten und Mohammed zu ihrer aller Chef wählen . . . Abu Leheb riss als erstem die Geduld. Er fand, das ganze Picknick sei reine Zeitverschwendung, und empfahl allgemeinen Aufbruch. Doch so einfach ließ Mohammed seine Gäste nicht abziehen. Vor versammelter Verwandtschaft beschimpfte er seinen Onkel: "Verdorben sind die Hände Abu Lehebs! Nichts wird ihm sein Reichtum nützen! In der Hölle wird er braten und seine Frau wird das Feuerholz sammeln, einen Strick um ihren Hals! Dann verkündete Mohammed den entsetzten Koreischiten noch Schrecklicheres: In Zukunft werde er seine Lehre öffentlich verkünden allen Menschen, und das ausgerechnet vor der Kaaba. Das aber fürchteten die Koreischiten mehr als alle Höllenqualen dass ihr stolzer Stamm durch ein ausgeflipptes Familienmitglied lächerlich gemacht würde. War Mohammed in Zahlungsschwierigkeiten geraten und wollte er auf diese Weise Geld erpressen? Nein, der Prophet lehnte dankend ab. Auch ein Rudel Ärzte, von besorgten Verwandten engagiert, musste unverrichteter Dinge vor der Haustür umkehren. Der Prophet sei beschäftigt. Das war Mohammed. Zunächst entwarf er ein neues Firmenstatut. Ab sofort wurden sämtliche Finanzangelegenheiten wieder von Kadidscha wahrgenommen. Alle Angestellten hatten fünfmal am Tag zu Allah zu beten und wer sich als Handelspartner ebenfalls zu Allah bekannte, erhielt Rabatt. Vor allem aber führte Mohammed eine Pensionsversicherung ein - jeder Beschäftigte musste zehn Prozent seines Gehalts in eine "Armenkasse" liefern aus der er im Alter wieder versorgt werden solle. Wie Mohammeds Untergebene diese Neuerungen aufnahmen ist nicht berichtet. Furore jedoch machten die Auftritte des Propheten vor der Kaaba.
So etwas hatte es in Mekka noch nicht gegeben: ein erfolgreicher Firmenboss, der sich täglich zwei Stunden vor die Kaaba stellt und dort von Nächstenliebe und Höllenqualen erzählt. Diese Show erregte mehr Aufsehen als heutzutage die Auftritte fanatischer Jesus-People in den Fußgängerzentren unserer Geschäftsstädte. In Mekka gab es kein Fernsehen kein Theater und nicht einmal einen Zirkus. Wer was erleben wollte, musste schon zu Mohammed gehen. Schnell wurde er zum Stadtgespräch von Mekka. Was war mit ihm los? War er ein Dichter geworden? Ein Zauberer oder einfach verrückt? Gegen letzteres sprach dass er ja bisher durchaus vernünftig gehandelt hatte in jedem Sinn des Wortes. Vielleicht war doch etwas dran, dachten einige nicht sehr begüterte Mekkaner und wurden Gläubige der Firma Islam. Eigentlich: Gläubiger, denn Mohammeds Forderungen waren klar und einfach - ein Zehntel des Barvermögens in die Armenkasse dafür die Aussicht auf Altersversorgung. Außerdem: Sämtliche Bedarfsgüter dürfen ebenfalls nur von Gläubigen bezogen werden, also von Angehörigen des Unternehmens. Jeder andere Einkauf war Sünde, und darauf stand die Hölle. Und da sich der "Islam" noch in seiner Kampfzeit befand, waren die Preise etwas überhöht. Dafür aber wurde Qualität geliefert und im Jenseits ein Himmel der sich von gut arabischen Bordellen nur dadurch unterschied, dass die ewigen Freuden nicht in stickigen Kammern sondern ewig grünen Gärten und nicht von fetten Huren sondern von knusprigen Huris verabreicht wurden. Die Umsätze der Firma Islam stiegen dadurch allerdings nur unbedeutend Mekkas Reiche hielten sich fern und die mickerigen zehn Prozent Bargeld aus dem Mittelstand machten das Kraut nicht fett. Dafür kamen die vielen Ungläubigen voll auf ihre Kosten Mekka ergötzte sich an dem Hickhack der nun zwischen Mohammed und seiner Verwandtschaft anhub. Fein waren die Sitten der feinen Leute in Mekka damals nicht. Da predigte Mohammed eines Tages vor der Kaaba und wunderte sich dass seine Zuhörer immer laut loslachten sobald er sich umdrehte. Der alte Onkel Abu Leheb hatte den Rücken des Propheten mit Scheiße beschmiert . . . Andere Koreischiten versuchten es mit gutem Zureden. "Mohammed", fragte einer, "bist du besser als dein Vater Abdallah?
Mohammed schwieg diplomatisch. Bist du besser als dein Großvater Abdel Mutalib? Wieder schwieg der Prophet schließlich wollte er keine Toten beleidigen. Damit aber musste er sich sagen lassen: Wenn du also durch dein Schweigen zugibst, dass du nicht besser bist als sie, dann lass dein Gequassel und bete zu allen Göttern wie sie. Die vielen Götter - für die Koreischiten bedeuteten sie die Vielfalt des Marktes! Wer würde nach Mekka zur Messe kommen, Wenn dort nur ein einziger Schutzgott einer einzigen Firma verehrt werden dürfte? Vor allem aber erkannten sie: Mohammed wollte die freiheitliche Grundordnung Mekkas zerstören das System der freien Marktwirtschaft durch ein Monopol ersetzen, in dem sie höchstens als Kleinaktionäre fungieren dürften. Und Mohammed tat ihnen den Gefallen und bestätigte dies. Damit war der Tatbestand des Hochverrats gegeben, und darauf stand Steinigung, zumindest aber Berufsverbot. Von Abu Talib, dem Obersten Gerichtsherrn, forderten die Koreischiten, er solle Mohammed vor Gericht stellen lassen. Doch der Ziehvater des Propheten, im Konflikt zwischen Grundgesetz und Familiensinn, entschied sich für letzteren und stellte Mohammed - als nicht voll zurechnungsfähig, aber voll geschäftsfähig unter seinen persönlichen Schutz. Der gewohnte Kleinkrieg ging weiter. Seine Firma vergaß der Prophet in dieser Zeit keinesfalls. Schließlich war der Islam noch lange keine Religion, sondern eher eine ausgefallene Methode, die Firma zu vergrößern und sich eine treue Stammkundschaft zu sichern. Nur : Wer zum Islam gehörte war nicht etwa ein schlichter kaufmännischer Angestellter, sondern auch ein Gläubiger, und dementsprechend missionarisch zäh trat Mohammeds Belegschaft nun auf den Märkten auf. Vor allem aber, und das erfüllte die Koreischiten mit größter Sorge, vergrößerte Mohammed sein Unternehmen rapide. Im Jahr 616, ein Jahr nachdem er sich als Prophet geoffenbart hatte, gründete er eine Tochtergesellschaft im wahrsten Sinn des Wortes - seine älteste Tochter sollte samt Gatten und acht weiteren Gläubigen nach Abessinien auswandern und dort ein Handelshaus gründen.
Geschäftszweck: Tausch indischen und europäischen Flitterkrams gegen Gold, Edelsteine und vor allem gegen Kaffee. Da aber traf er gerade seinen Onkel Abu Leheb an dem empfindlichsten Geschäftsnerv. Abu Leheb war nämlich außerdem Arabiens mächtigster Kaffeeimporteur, und seine Lagerhallen in Mokka waren so berühmt, dass das Getränk nicht nach seinem Ursprungsort, sondern nach seinem Verteilerplatz benannt wurde. Abu Leheb bot Mohammed Geld und versuchte, die soeben abgereiste Karawane mit der falschen Nachricht zurückzuholen, er habe sich mit Mohammed versöhnt - es half nichts, und Abu Leheb entschloss sich zu Rationalisierungsmassnahmen: Um seinen Profit zu halten, ließ er nun auch in Arabien große Kaffeepflanzungen anlegen und so ging "der Flammenvater" nicht nur als schlimmster Feind des Propheten in die Geschichte ein sondern auch als der Mann, der den Kaffeestrauch nach Arabien brachte. Viel geholfen hat ihm das allerdings nicht. Die Firma Islam erreichte beim Negus, dass Abu Leheb nicht mehr mit Kaffee beliefert wurde. Wie viel Bestechungsgeld der Prophet bei dieser Gelegenheit an den christlichen "Löwen von Juda" überwiesen hat, ist nicht bekannt. Gelohnt aber hat sich diese Investition - noch ehe Abu Lehebs Kaffeestauden ihre ersten Früchte trugen, war Abu Leheb pleite und musste Plantagen und Lagerhallen für ein Spottgeld verkaufen. An Mohammed! Aber auch in seiner Heimatstadt vergrößerte sich der Konzern. Ein Jahr nach der Abessinien-Geschichte brachten zwei angesehene Koreischiten ihre Unternehmen in die größere Firma ein oder, wie es nun hieß: Sie bekehrten sich zum Islam. Derlei Bekehrungen hatten ihre Vorteile - sie ersparten die eigene Ausrüstung von Karawanen, den Unterhalt von eigenen Stapelplätzen und verringerten das Geschäftsrisiko. Mohammed garantierte einen Mindestumsatz und gewährte großzügigen Gläubigenrabatt. In der Geschichte des Islam wird berichtet, dass Mohammeds Onkel Hamsa sich zu diesem Schritt nur entschloss, weil er nicht mehr mit ansehen konnte, wie unartig sich andere Koreischiten dem Propheten gegenüber benahmen, wenn der vor der Kaaba predigte. Omar ben Chattab, ein hochangesehener und äußerst streitbarer Karawanenführer, soll von seiner Schwester angeworben worden sein.
Wie dem auch sei: Plötzlich hatte Mohammed wieder ein Haus in Damaskus dank Hamsa - und Omars fünf Karawanen-Trupps auf den südlichen Handelsstrassen zur Disposition. Auf dem Basar von Mekka bewirkte diese Nachricht ein Erdbeben zwei Koreischiten-Stämme beeilten sich, auch ihre Firmen in den Islam ein zubringen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Die übrigen Koreischiten beschlossen, für die freie Marktwirtschaft zu kämpfen und koste es auch Umsatzprozente. Mit einer feierlichen Urkunde wurde der Boykott gegen den Islam beschlossen. Keinerlei Geschäfte mit Angehörigen des Islam und erst recht keine Heiraten, die zu Fusionen führen könnten. Abu Talib musste die Eselshaut persönlich an der Kaaba anschlagen. Doch so war Mohammed nicht Kleinzukriegen. Der Islam kontrollierte bereits einen Grossteil des Außenhandels, da machte es nichts aus, dass rabiate Koreischiten islamische Stände in Mekka umwarfen sobald sie aufgestellt wurden - der Reibach wurde anderswo gemacht. In Mekka aber versiegte der Nachschub an exotischen Gütern. Mohammed ließ sie, ohne Umweg in die Zentrale gleich nach Damaskus oder Abessinien transportieren, und damit sank auch das Interesse vieler Handelsreisender an der Messestadt. Das aber hatten die Koreischiten nicht gewollt, und bald schon erkannten einige Einsichtige, dass dieser Schuss nach hinten losgegangen war. Der Handelskrieg währte drei Jahre genauso lange brauchten die Koreischiten bis ihre Vernunft über ihren arabischen Stolz gesiegt hatte. Und dann war da immer noch diese Urkunde an der Kaaba, die ohne erheblichen Gesichtsverlust nicht entfernt werden konnte. Doch da half Allah. Nach längeren Geheimverhandlungen berief Abu Talib eine Bürgerversammlung ein ob sich der Islam und die noch zahlungsfähigen Koreischiten nicht lieber doch wieder vertragen wollten? Ja, schon, aber die Urkunde... Da meinte Abu Talib: "Bringt sie doch herbei. Mohammed hat mir gesagt, ihm habe heute nacht ein Engel mitgeteilt, sie sei von Würmern zerfressen worden". Und tatsächlich - an der Kaaba hing von der ganzen, großen Eselshaut nur noch ein schmaler Streifen mit den Anfangsworten: "Im Namen Allahs –". Sogar die Namen der Konkurrenzgötter hatten die himmlischen Würmer zernagt.
Damit stand dem Frieden nichts mehr im Wege, und die Messe von Mekka konnte wieder erblühen. Das war auch aller höchste Zeit, selbst für die Islam, die eigentlich den längeren Atem gehabt hatte. Im gleichen Jahr nämlich war der lange kalte Krieg zwischen dem Oströmischen und dem Persischen Reich urplötzlich zu einem heißen geworden. Persische Truppen marschierten nach Damaskus und vertrieben die dortige oströmisch-griechische Garnison ohne große Mühe. Sämtliche arabische Firmen, die mit Byzanz gutgestanden hatten, wurden von der persischen Konkurrenz übernommen, und dazu gehörte auch die Niederlassung Mohammeds. Der Prophet tröstete sich und seine KG über diese Katastrophe mit der dreißigsten Sure des Korans: "Die Römer in Syrien sind zwar besiegt, aber in absehbarer Zeit werden Sie wieder siegen. Allah bestimmt Vergangenheit und Zukunft". Schließlich war dem Ereignis auch die Konkurrenzfirma Fides zum Opfer gefallen, dieser unangenehme, jüdische Konkurrent, und die Fides erholte sich von diesem Schicksalsschlag nie wieder. Der Islam beerbte sie entgegen seiner Gewohnheit, mit Juden keine Geschäfte zu machen, erwarb der Prophet die Lagerhallen der Fides in Alexandria, und nun musste er zwar mit ägyptischen Zwischenhändlern arbeiten, blieb aber immerhin im Europageschäft. Während ganz Arabien über die Wirtschaftskrise jammerte, konnte der Islam seine Umsätze um zwanzig Prozent erhöhen. Dass sich der Prophet mit seinen hemdsärmeligen Geschäftsmethoden in Mekka keine Freunde machte, dürfte verständlich sein. Mekka hatte damals annähernd zehntausend Einwohner, und alle litten unter der schweren Zeit. Dass da Mohammed und seine zweiundneunzig Gläubigen im Ausland Profit machten, schmerzte tief. Der entscheidende Kampf war gewissermaßen vorprogrammiert, der von Abu Talib sorgsam überwachte Frieden mehr als trügerisch. Im Jahr 620 im neunundvierzigsten Lebensjahr des Propheten, starb Abu Talib, zuletzt nahezu uneingeschränkter Manager Mekkas und Mohammeds Protektor. Das war schlimm, sehr schlimm. Doch es kam noch schlimmer: drei Tage nach Abu Talib starb auch Kadidscha, die bis zuletzt die Finanzangelegenheiten des Konzerns mit starker Hand geführt hatte. Für Kadidscha fand sich bald Ersatz.
Abu Bekr, ein betagter Kaufmann und mit Mohammed seit fünf Jahren fusioniert, übernahm die Buchführung. Kein Ersatz fand sich für Abu Talib die Koreischiten, froh über den Tod des Patriarchen, beschlossen eine Rückkehr zu demokratischen Verhältnissen. In Zukunft sollte ein Ältestenrat die Geschicke der Stadt lenken, und darin saßen zwar Mohammed und Omar und Abu Bekr, aber auch zwölf Angehörige der Konkurrenz. Mohammed bekam den frischen Wind voll zu spüren und beschloss, sich samt seiner Firma Islam aus dem Staub zu machen. Doch wohin? Eine Messestadt musste es auf jeden Fall sein, möglichst also ein Kreuzungspunkt zweier Handelsstrassen. Zuerst dachte der Prophet an Taif, östlich von Mekka. Mit kleinem Gefolge und großen Plänen reiste er dorthin. Doch die Stadtväter von Taif hatten Bedenken - ihnen war klar, dass Mohammed mit seinen berüchtigten Geschäftsmethoden diesen kleineren Markt sofort und total beherrschen würde, und darauf verzichteten sie dankend. Unverrichteter Dinge kehrte der Prophet nach Mekka zurück und konnte der Vollversammlung seiner Gläubigen in Mekka nur berichten dass er unterwegs einige unsichtbare Dschinnen bekehrt habe. In Mekka spitzte sich die Situation mittlerweile zu. Für die Frühjahrsmesse des Jahres 621 wurde dem Islam nur ein Drittel der benötigten Ausstellungsfläche zugestanden, und da half kein Protest. Grollend verließ Mohammed das von seinem Großvater erbaute Rathaus, mit ihm Omar und Abu Bekr. An dem so beengten Messestand aber kam der Prophet mit einigen Aufkäufern aus Yasrib ins Gespräch. Auch die klagten über die Juden, und dafür hatte der Prophet immer ein offenes Ohr. Schrecklich wie es in Yasrib zuging: Die jüdischen Händler hatten sich mit zwei Araberstämmen verbündet und machten nun den rein arabischen Firmen das Leben schwer. Auch Mohammed hatte mit den Juden seine Erfahrungen gemacht seine ersten übrigens in Yasrib bei seinem Großvater mütterlicherseits... eigentlich sei er ja der Stadt Yasrib ebenso verbunden wie der Stadt Mekka, und dass seine ersten großen Fischzüge gerade dieser Stadt etwas Umsatzsteuer entzogen haben, sei ja nicht so schlimm. Nun sei der Islam ja eine viel größere Firma, mit viel, viel mehr Umsatzsteuer..., aber wenn er die einer Stadt einbringen wolle, müsse ihm auch die Stadt dafür was bieten.
Beispielsweise die oberste Gerichtsbarkeit. Und feierlich versprach der Prophet. in diesem Falle nicht nur zum Wohl seiner Firma, sondern auch auf alle Fälle immer gegen die Juden zu entscheiden. Die Delegation aus Yasrib hörte aufmerksam zu. Das Steueraufkommen lockte, und schließlich war in der Vergangenheit der oberste Richterposten schon für weniger Geld verkauft worden. Die ehrenwerten Kaufleute aus Yasrib schieden mit dem Versprechen, sich die Sache gründlich zu überlegen. |
|
Allahs Räuberbande
|
|
|
Ein Medina kommt selten allein
Alle Wege führten nach Medina, zumindest zu Mohammeds Zeiten. Medina heißt "Stadt", und das wollten genau hundert Dörfer der Halbinsel sein. Als Stadt galten bereits einige Lehmhütten am Rand einer Oase, vorausgesetzt, in ihrer Mitte verlief eine Strasse mit den Schuppen ortsansässiger Krämer und der Karawanserei. Die war ein Hof mit hohen Sicherheitsmauern, der Rastplatz reisender Händler. Kam eine Karawane in Sicht, bildete die Kaufmannschaft des jeweiligen Medina ein Empfangskomitee. Weit vor der Stadt wurden die Fremden begrüßt und mit starker Eskorte zur Karawanserei geleitet, "in den gastfreundlichen Schutz raubsicherer Mauern". Vor allem schützten die Mauern den Profit ortsansässiger Krämer. Nur Kaufleute durften in das Geviert und kein Käufer erfuhr je, was woher kam und wie viel beim Wiederverkauf verdient wurde. Die Handelsspannen jener Zeit waren beachtlich das Gastmahl für die Fremden war auf jeden Fall mit drin und auch die Benutzungsgebühr für die Karawanserei. Die war von Medina zu Medina verschieden und ergab sich aus der Zahl der Abnehmerläden. Außerdem musste eine Abgabe für sämtliche mitgebrachte Waren bezahlt werden - ein Preis für die Sicherheit die Medina so bot. Vielen Medinas auch das nicht: Sie führten die Niederlagspflicht ein. Sämtliche Waren mussten in der Karawanserei an ortsansässige Großhändler verkauft werden und wurden manchmal auch großzügig ihren ursprünglichen Transporteuren zurückverhökert. Manche Karawanenherren fanden, derlei Sicherheitskosten seien wesentlich größer als das Risiko, beraubt zu werden. Lag auf ihrem Weg ein Medina ohne lohnenswerten Umsatz, mieden sie die Karawanserei und kampierten lieber auf freiem Feld. Das sahen natürlich die Kaufleute Medinas nicht gern, und bald organisierte jedes Medina eine "Karawanen-Schutzpolizei". Deren Aufgabe war alle Karawanen zu plündern die sich nicht freiwillig zu ähnlichem Zweck in die sicheren Mauern begaben. Dieses Medina-System bewirkte natürlich dass sich alle Waren auf ihrem Weg von Medina zu Medina ungebührlich verteuerten und Arabiens Außenhandel oft nicht konkurrenzfähig war. Um das Jahr 620 verbündeten sich daher einige Medinas zu einer Art Sanierungswerk.
Kleinere Medinas auf den großen Handelswegen sollten einfach per Karawanenschutzpolizei ausradiert werden. Zweifelhaften Ruhm erlangte das Bündnis von Mekka und Taif. Beide Städte waren für arabische Verhältnisse Giganten und ihr Bund eine Ungeheuerlichkeit - als würden hierzulande und heutzutage die größten Kaufhauskonzerne gemeinsam eine Rockerarmee mieten, um die letzten Tante-Emma-Läden zerschmeißen zu lassen. In Taif trafen vier Strassen aufeinander: Eine führte nach Süden in den Jemen und von dort zu den beiden Hafenstädten Aden und Dhofar. Eine zweite Strasse führte östlich nach Muskat dem berühmten Stapelplatz exotischer Gewürze. Eine weitere Strasse führte nach Persien. In Nischapur, gut 5.000 km von Taif, teilte sie sich in die zwei berühmtesten Trampelpfade der Alten Welt - in den Landweg nach Indien, den schon Alexander der Grosse langmarschiert war, und in die Seidenstrasse, die über Samarkand und Tibet zum fernen China führte. Nach Norden aber führte kein Weg an Mekka vorbei. Über den Hafen Dschidda wurde der Ägyptenhandel abgewickelt, und eine Küstenstrasse führte über Palästina nach Damaskus. Nach Damaskus gab es auch noch eine andere Route, etwas weiter östlich und auf der anderen Seite des Küstengebirges. An der lag, 380 km nördlich und damals zehn Tagereisen von Mekka, die Ortschaft Yasrib-Medina. Und dem Städtchen galt das Bündnis der Giganten. Denn auch Yasrib lag am Knotenpunkt einer Persien-Strasse. Die war sogar zwölf Tagreisen kürzer als die Taifs und somit eine ernsthafte Konkurrenzroute auf dem Weg nach Alexandria. Es fiel den Stadtvätern von Taif nicht schwer, die Koreischiten von der Gemeinsamkeit ihrer Interessen zu überzeugen. Auf dass, in Zukunft der gesamte Ost-West-Handel über Taif und Mekka trabe, eine stattliche Garnison nach Bedr gelegt wurde. Dort kamen über eine schmale Passhöhe die Karawanen aus Yasrib auf die Alexandria-Strasse und wurden nun so kräftig zur Kasse gebeten, dass der kürzere Weg der teurere war. In Mekka meinten allerdings Kenner des Städtchens Yasrib soviel Aufwand sei doch gar nicht nötig gewesen. Man hätte es ruhig den Bürgern von Yasrib überlassen sollen, ihre Stadt kaputtzumachen. Tatsächlich war die Situation in Yasrib katastrophal.
Die Stadt war genaugenommen ein kleiner Haufen Oasen, um die sich schon die Kameltreiber der Vorzeit geprügelt hatten. Aus dem Süden waren zwei miteinander versippte Stämme namens Chadresch eingewandert, und aus dem Norden vier jüdische Stämme. Als sie gemeinsam eine Karawanserei gebaut hatten, konnte der Kampf beginnen. Zunächst siegten die Südaraber. Als sie aber dann so richtig verdienten, heuerten die Juden einige benachbarte Araberstämme an. Die sorgten dafür, dass sich die Chadresch aus dem Geschäftsleben zurückzogen, und blieben selbst gleich als Karawanenschutztruppe im Ort. Die Chadresch aber vermehrten sich in der erzwungenen Ruhepause so kräftig dass sie im Jahr 621 die absolute Bevölkerungsmehrheit stellten. Nach einer Serie von Massenprügeleien erbauten sie in Yasrib eine zweite Karawanserei, und zwischen den beiden Börsen herrschte von nun an kalter Krieg. Das war eine Sache für den Propheten. Um die Wirtschaftsstruktur der Aus und Chadresch zu verbessern, bot er ihnen die Übersiedlung des Islam nach Yasrib an. Das bedeutete für die Stadt Umsatzsteuer in einer noch nicht einmal erträumten Höhe. Als Gegenleistung verlangte der Prophet einen fünfundzwanzigprozentigen Steuernachlass, das Amt des Stadtrichters, die Börsenhoheit und natürlich auch das Kommando über die Karawanenschutztruppen. Die Sippenbosse aus Yasrib schauderten. Mohammeds Vorschlag bedeutete das Ende der Stammesdemokratie. Von der wollten sie sich nicht trennen, und die Verhandlungen waren eigentlich schon gescheitert, als Mohammed ein weiteres Angebot machte: Die Bürger von Yasrib sollten ihm nur vier Jahre Zeit geben. Dann sei ihr Medina judenfrei. Vor allem aber würde dann die Strasse von Muskat nicht mehr nach Taif führen, sondern nach Yasrib, im Klartext: der Indienhandel. Da entschieden sich die Bürger. von Yasrib per Volksentscheid für die Abschaffung der Demokratie. Viele Geschichtsschreiber werfen ihnen deshalb noch heute staatsbürgerliche Charakterlosigkeit vor, doch haben auch schon andere Völker in Krisenzeiten ganz demokratisch die Diktatur gewählt.
Im Januar 622 kam eine Delegation von dreiundsiebzig Mann und zwei Frauen aus Yasrib zu Mohammed und akzeptierte alle Bedingungen. Im Kontor der Firma Islam kam es zu einer bewegenden Versammlung. Es ging ums Geschäft, und das wurde Religion. In einer dramatischen Rede erklärte Mohammed seiner Gemeinde, dass sie von nun an für Allah Prophet und Profit kämpfe und zu diesem Zweck ganz Arabien den Krieg erkläre. Die Gläubigen wollten den totalen Handelskrieg, und alle riefen: "Wir schwören es". Dann ernannte der Prophet noch zwölf Jünger als Organisations- und Verwaltungsmanager. Am nächsten Morgen zogen die Delegierten in kleinen Gruppen nach Yasrib heim. Mohammed aber begann die Übersiedlung seiner Firma vorzubereiten. Eine Beschreibung aus jener Zeit schildert den Propheten als Mann von mittlerer Statur, dem man seine fünfzig Jahre weiß Gott nicht ansah. Er legte größten Wert auf schlichte, aber perfekte Kleidung und roch stets meterweit nach Moschus, dem Luxusparfüm der Alten Welt. Seine Fingernägel waren sorgfältig manikürt und drei Zentimeter lang - das Statussymbol eines Reichen, der nie auf Handarbeit angewiesen war. Seine angegrauten Schläfen färbte er pechschwarz und seine Wimpern tuschte er mit persischer Schminke. Die meiste Pflege aber widmete er seinem Bart, der im Mekka seiner Zeit bereits sprichwörtlich war und auch heute noch strenggläubigen Muslims einige Male pro Tag in den Mund gerät. Sein Privatleben wurde von zwei Geschäftsverbindungen verschönt. Die eine hieß Suda und entstammte einem Handelshaus mit Zweigstelle in Taif. Drei Monate nach dem Tod Kadidschas hatte Mohammed die "allseits Runde" geehelicht, als er mit dem Islam nach Taif übersiedeln wollte. Als dieses Projekt scheiterte konnte er auch mit Suda nicht mehr viel anfangen, und wir hören in Zukunft nicht mehr viel von ihr. Die andere Dame seines Haushalts aber hieß Aischa und war die jüngste Tochter Abu Bekrs. Bei ihrer Hochzeit war die strahlende Braut ganze sieben Jahre alt und ihre Aussteuer waren siebzehn Puppen aus aller Herren Länder darunter eine chinesische aus Elfenbein. Mekkas feinere Kreise zerrissen sich das Maul über diese seltsame Verbindung.
Dabei war die Jugend der Braut weniger skandalös als der Tatbestand der Polygamie. Die nämlich gab es auf der arabischen Halbinsel bisher nur bei ärmeren Leuten. Wer sich's von denen noch leisten konnte, nahm oft eine unversorgte Schwester der Frau als Sozialmassnahme mit in den Haushalt. Im Falle Mohammeds galt daher die Vielehe als standeswidriges Verhalten, und schlimmer noch wurde die Kleidung der Damen beurteilt: Der Prophet wünschte seine Gattinnen nur in weiten, roten Pluderhosen und durchsichtigen Hemdchen zu sehen. Weitgereiste Mekkaner kannten dieses Kostüm als Berufskleidung billiger Straßendirnen in Damaskus und lästerten dementsprechend, bis der Prophet seine Gattinnen nur noch dichtverschleiert auf die Strasse ließ. Im übrigen aber wurde Mohammed durchaus ernst genommen. Vorbei waren die Zeiten, wo man ihn mit Schuljungenmethoden lächerlich zu machen versuchte. Der Islam war, wenn schon nicht als Religion, so doch als Konzern durchaus ernst zu nehmen, und Multis bekämpft man nicht mit Zungezeigen. Das Unternehmen mit der grünen Flagge war das größte am Platz, und die daraus üppig fließenden Umsatzsteuern ließen die Stadtväter alle übrigen Spinnereien des Propheten wohlwollend tolerieren. Seine Freunde hatte der Prophet allerdings unter den Handwerkern. Die einen sahen in ihm den Vorkämpfer des Mittelstandes und genossen seine Rangeleien mit den als Preisdrückern verhassten Großhändlern, und die anderen dankten ihm fette Aufträge. Viele von ihnen hatten sogar ihre gewohnten Schutzpatrone aufgegeben und sich zu Allah "bekehrt". Den Entschluss, nach Medina zu übersiedeln, nahmen ihm aber alle übel und am meisten der Stadtrat, der darin zu Recht eine Provokation sah. Die geheime Versammlung im Haus des Propheten war bereits am nächsten Tag Stadtgespräch von Mekka, und vor allem die Koreischiten fanden, man müsse nun dringend etwas gegen die nackte Macht des Kapitals unternehmen. Zunächst gründeten sie eine Art Kartellamt. Das stellte bereits nach kurzer Überprüfung fest, der Islam sei eine Firmenkonzentration, die mit den Spielregeln der freien Marktwirtschaft schon lange nicht mehr zu vereinbaren sei. Verordnet wurde eine Kapitalsentflechtung - die Firmen Kadidschas Abu Bekrs und Omars seien auszugliedern und erneut in selbständige Unternehmen umzuwandeln.
Der Prophet nahm diesen Befehl ebenso ernst wie Großkonzerne des späteren Industriezeitalters. Ehe noch der Beschluss Gesetzeskraft erlangte waren die betreffenden Firmen heimlich, still und leise nach Yasrib-Medina übersiedelt. Mohammeds Lage in Mekka wurde dadurch allerdings sehr unangenehm. Nach geltendem Recht wurde dieser Coup als Hochverrat angesehen. Außerdem hatte der Prophet in seiner Arbeitsüberlastung vergessen die Steuern zu bezahlen, und bereits auf Steuerhinterziehung stand in Mekka Acht und Bann. Der Rechtsweg zu solchen Maßnahmen jedoch war langwierig. Zunächst musste dafür ein einstimmiger Beschluss der Ratsversammlung vorliegen. Am 21. August 622 kam es in dem von Mohammeds Großvater erbauten Rathaus zu einer denkwürdigen Sitzung. Einziger Tagesordnungspunkt: Der Islam. Eine Minderheit stimmte gegen die Anklageerhebung, und erst als sie aus dem Saal geprügelt war herrschte Einstimmigkeit für die Eröffnung des Verfahrens. Einige Koreischiten beschlossen das Verfahren abzukürzen. Ein unbekannter Kaufmann aus Nedsch, der seitdem von Muslims für den leibhaftigen Teufel gehalten wird, riet, Mohammed aus Zeit- und Kostenersparnisgründen gleich zu erschlagen. Außerdem bestand Fluchtgefahr - stets warteten im Hof des Hauses Mohammed zwei gesattelte Kamele mit allem nötigen Gepäck. In der Nacht des 22. August trafen sich zwei Dutzend Koreischiten vor dem Haus des Propheten. Sorgsam besetzten sie sämtliche Eingänge. Dann klopften sie. Ein alter Diener öffnete und wurde noch im selben Augenblick gefesselt und geknebelt. Dann stürmten fünf Koreischiten mit gezückten Dolchen in das Schlafzimmer Mohammeds, rissen die grüne Bettdecke hoch und... in dem Bett lag Ali, nun schon ein junger Mann mit gepflegtem Bärtchen. Mohammed war rechtzeitig gewarnt worden und saß längst in der Wochenendhöhle Abu Bekrs auf dem Berg Thaur, zwei Reitstunden weiter. Die enttäuschten Koreischiten mussten sich damit begnügen, Ali ein zusperren - "wegen groben Unfugs". Auf Abu Bekrs besorgte Fragen nach dem Verbleib des Propheten wussten sie keine Antwort. Daraufhin und weil gerade Freitag war, begab sich Abu Bekr ebenfalls zu seiner Wochenendhöhle. In der Legende lesen sich diese Vorgänge natürlich ungleich dramatischer.
Ganze Armeen sollen den Propheten verfolgt haben, und in Abu Bekrs Höhle sei er nur deshalb nicht aufgespürt worden, weil sich schnell eine brütende Taube davor legte, eine Spinne ihr Netz zog und seine Verfolger daraufhin die Höhle für unbewohnt hielten. Ein anderes Mal soll sich ein gedungener Mörder in letzter Sekunde bekehrt haben. Der Fluchtweg des Propheten war mit Wundern gepflastert. Die Wahrheit ist sehr viel prosaischer. Höchstwahrscheinlich hat sich Mohammed sogar noch einmal nach Mekka gewagt und am hellen Tag, zur Siestazeit, Abu Bekr besucht. Aischa, seine damals neunjährige Gemahlin, berichtet jedenfalls in ihren Memoiren über den Tag nach der turbulenten Nacht: Der Prophet besuchte uns sonst immer morgens oder abends. An diesem Tag aber kam er wahrend der stärksten Hitze, und mein Vater sagte gleich da muss etwas Bedeutendes vorgefallen sein. Hatte Abu Bekr am Vormittag als er sich so teilnahmsvoll im Rathaus nach Mohammeds Verbleib erkundigte, wirklich nicht gewusst wo Mohammed geblieben war? Jedenfalls packte nun auch Abu Bekr seine Sachen, und die beiden verließen endgültig Mekka. Nach einer höchstwahrscheinlich ziemlich geruhsamen Flucht erreichten sie am 1. oder 12. September Yasrib. Über den genauen Ankunftstag streiten sich die Gelehrten, und das schon seit Mohammeds Zeiten. Der Prophet soll sich nämlich noch fünf Tage in Kuba erholt haben, einem kleinen Dorf auf halbem Weg. Dort, so wird berichtet, habe er neue Gläubige geworben und seine erste Predigt gehalten. Wie dem auch sei - auf jeden Fall hatte der Prophet seine Fluchtzeit nicht müßig verbracht. Nach Yasrib brachte er nicht nur seine Firma Islam mit sondern auch eine Religion gleichen Namens, und beide Unternehmen waren so innig miteinander verbunden, dass nicht einmal mehr der Teufel eine Sollbruchstelle hatte finden können. Mit der endgültigen Übersiedlung - auf arabisch "Hidschra" nach Medina legte die Firma Islam neue Geschäftsbücher an und die Religionsgemeinschaft Islam begann eine neue Zeitrechnung. Für beide war der 13. September 622 Stichtag. Mohammeds Ankunft in Medina war ein überwältigendes Ereignis. Man merkte, dass hier ein Freund empfangen wurde, dessen Hauptverdienst darin bestand, den eigenen Feinden unbequem zu sein.
Solschenizyns Ankunft im freien Westen war publizistisches Pfuschwerk im Vergleich zu dem Empfang, den Yasrib Mohammed bereitete. Schon eine Tagreise vor der Stadt wartete ein Komitee, und nun hatte der Prophet Gelegenheit alle Verfolgungen denen er ausgesetzt war, breit zu schildern. Yasribs Bürger schauderten über die Blutgier der Mekkaner. Da störte nur wenig, dass drei Tage später Ali eintraf, den die Koreischiten freigelassen hatten. Natürlich war Ali durch ein Wunder entkommen. Typisch für die Grausamkeit der Mekkaner war ja auch dass sie dem Propheten seine Gattin Suda nachschickten die er in der Eile vergessen hatte. Zweihundert Bürger von Yasrib geleiteten ihren neuen Ehrenbürger in die Stadt und sollen sich gegenseitig so mit ihrer Gastfreundschaft überboten haben, dass der Prophet entschied, sein Kamel möge entscheiden. Das kluge Tier ging gerade vor dem schönsten Haus der Stadt in die Knie. Die Juden von Medina aber beobachteten das Prophetentheater mit Misstrauen. Da half nicht viel, dass Mohammed schon am Tag nach seiner Ankunft ihrer Börse seinen Besuch abstattete. Der Prophet sagte ihnen viel Freundliches. Abraham sei ihrer aller gemeinsamer Stammvater gut das wussten sie. Und dass eine Religion bei möglichen Interessenkonflikten stets eine ideale Klammer sei wussten sie aus eigener Erfahrung schon längst. Dass ein unsichtbarer Gott den man auch nicht darstellen durfte, in solchen Fällen seine Vorteile hat, war auch bekannt. Und dass Jerusalem der Mittelpunkt der Welt sei, erst recht. Was wollte Mohammed also von ihnen? Sollten sie mit dem Islam fusionieren? Das kam nicht in Frage. Sie betrieben ihre eigenen Geschäfte und ihre eigene Religion. Außerdem erklärten sie, ihre Bibel sei in manchen Dingen doch anderer Ansicht als Mohammed und da es vom Buch der Bücher auch in Yasrib ein Exemplar gab, wurde dies dem Propheten zum Studium überlassen. Der einzige greifbare Erfolg war nach dreimonatigen Verhandlungen zwischen Juden und Arabern dass der Markt von Medina geteilt wurde: In Zukunft besorgten die Araber den Ost- und die Juden den Westhandel. Dass dies keine Lösung auf Dauer war, war allen Beteiligten klar. Mohammed hatte bei diesen Verhandlungen, fanden einige Chadresch, keine sonderlich gute Figur gemacht.
Die Juden waren in Medina geblieben und hatten nun sogar das Monopol auf den profitablen Westhandel. Vor allem aber befremdeten die neuen Sitten, die der Prophet einzuführen gedachte. Einigkeit macht stark, und Versammlungen stärken die Einigkeit. Zu diesem Behuf verordnete Mohammed Gebete, fünfmal täglich. Das heißt: Gebete hießen diese Übungen nur, weil kein passenderer Ausdruck dafür greifbar war. Auch gymnastische Übungen gehörten dazu, und das Ganze bildete ein Fitness-Programm für Geist und Körper, wie es heute noch Angehörigen eines großen Elektronik-Konzerns in den USA zuteil wird: Dort erhält jeder Angestellte von der Firma ein Gesangbuch mit Hymnen auf die Arbeitsbedingungen und Auszügen aus der Firmengeschichte. Der Bürotag beginnt mit fünf Kniebeugen, den Kopf einem Schild mit dem Firmensymbol zugewandt "THINK!" - "Denke!" -. Dann verliest der Abteilungsleiter ein Kapitel Firmengeschichte, und Chorgesang beschließt die Feier. Zwar kostet das täglich zehn Minuten bezahlte Bürozeit, doch dafür genießt auch die aller unterste Hilfssekretärin das stolze Gefühle, zur großen Familie zu gehören. Gerade die unteren Chargen des Konzerns protestierten 1973 wütend, als diese Unglaublichkeit abgeschafft werden sollte. Die Zeitgenossen der Propheten konnten sich für derlei Übungen weit weniger begeistern. Vor allem empfanden sie als reine Zeitverschwendung, gleich fünfmal beten zu müssen. Selbst Mohammeds eigene Betriebsangehörige waren zum Gebets-Streik entschlossen, als der Prophet sein schwerstes Geschütz auffuhr: Allah persönlich. Mit aufgerissenen Augen Mündern und Ohren lauschten die Bewohner von Yasrib, was der Kaufmann ihnen erzählte: "Einst schlief ich im Heiligtum der Kaaba als mich Gabriel weckte: "Steh auf, Mohammed, und folge mir." Dann rief Gabriel Michael, er solle mir eine Tasse Wasser aus dem Brunnen Semsem bringen. Gabriel spaltete mir die Brust, zog das Herz heraus, wusch es und goss mit drei Tassen Wasser Glauben Wissenschaft und Weisheit ein. Das war die zweite himmlische Herzoperation im Leben des Propheten - die erste hat ja angeblich bei seiner Geburt stattgefunden. Danach führten die beiden Engel Mohammed vor die Kaaba, und dort wartete bereits der Borrak,
das ungewöhnlichste Reittier aus der Hohen Schule der Phantasie: "mit Menschengesicht und Elefantenohren, dem Hals eines Kamels, dem Leib ein es Pferdes, dem Schweif eines Maulesels und den Hufen eines Stiers. Gabriel erklärte, auf diesem Wundertier sei schon Abraham bei gelegentlichen Ausflügen zur Kaaba geritten. Diesmal aber ging es nach Jerusalem, denn dort, vom alten Tempelplatz aus, führt die Strasse zum Himmel, die Stufen abwechselnd von Gold und Silber, die Gebäude auf einer Seite aus Smaragd, auf der anderen aus Rubin. Hier nahm mich Gabriel auf seine Schwingen und flog mit mir zum Tor des Paradieses auf". Im ersten Himmel traf Mohammed Adam. Der saß zwischen zwei Toren. Wenn er in das rechte schaute, strahlte sein Gesicht, beim linken Tor aber wurde es traurig. Natürlich: Links war das Tor zur Hölle, und dort herrschte jene ewige Wüstenhitze, die auch heute noch selbst im kühlen Norden ansässigen Christen das Gewissen heiß macht. Rechts aber erwarteten Christus samt Johannes den Propheten im zweiten Himmel. Im dritten Himmel traf Mohammed einen Verwandten, Jusuf, den schönsten Mann Arabiens und der Welt. Die oberen himmlischen Etagen aber waren Bekannten aus dem Alten Testament vorbehalten: Im vierten Himmel hockte Enoch, im fünften Aaron, im sechsten sein Bruder Moses und im siebten Himmel schließlich thronte Abraham. Der Prophet muss dies alles sehr plastisch geschildert haben, denn die Vorstellung von einem himmlischen Hochhaus ging später sogar in christliche Redewendungen ein. Auch heute fühlen wir uns manchmal wie im siebten Himmel ab und zu auch wohl "wie in Abrahams Schoss". Doch Mohammed wollte noch höher hinaus. Über allen Himmeln nämlich erhob sich ein Lotosbaum. Aus dessen Wurzeln entsprangen vier Quellen: Wein, Honig, Milch und Kristall. Gabriel holte drei Becher, aus Diamant, Saphir und Rubin den ersten mit Honig, den zweiten mit Milch und den dritten mit Wein gefüllt. Und Mohammed erzählte: "Ich kostete aus dem ersten und trank aus dem zweiten. Da fragte mich Gabriel, warum ich nicht aus dem dritten tränke. Ich sagte, mein Durst sei gestillt. Da jubelte Gabriel: "Gott sei gelobt dass du in der Wahl deines Getränks die wahre Natur des Islam für dein Volk ergriffen." Damit war Wein für Muslims tabu und ist es bis auf den heutigen Tag geblieben.
Wein und alkoholische Getränke überhaupt sind sündhaft, basta. Die wahren Gründe dafür aber sind durchaus irdisch und haben mit römischer, persischer und christlicher Politik weit mehr zu tun als mit Gabriel als himmlischem Kellermeister. Für die Juden des Alten Testamentes war Wein aller Laster Anfang. Angeblich hat Noah das Rauschgift aus der Traube entdeckt, gleich nach der Sintflut, und als er dann mit dickem Kopf dalag, gab es Streit unter seinen Söhnen über die Frage, ob Betrunken sein lächerlich oder bedauernswert sei. Die Bibel entschied für bedauernswert und verurteilte den spottsüchtigen Sohn zum Stammvater aller Neger. Nach dem Untergang von Sodom und Gomorra spielte Wein wieder eine Rolle. Lots Töchter, samt Papa mit heiler Haut und sonst nichts davongekommen, bekamen Angst, ihre Sippe würde nun aussterben. Sie setzten ihren Papa unter Alkohol um sich im Zuge der bekannten Enthemmungserscheinungen neue Stammhalter machen zu lassen. Die Römer sahen die Alkoholfrage wesentlich nüchterner und machten Wein zu einem der Fundamente ihres Weltreichs. Sie erkannten, dass Rauschmittel gefügig machen und ließen den Wein in Strömen fließen. Wenn ihre eroberten Völker auch nichts zu lachen hatten - zu trinken hatten sie immer. Dafür sorgten schon die zahllosen Weingärten die römische Legionäre in allen Provinzen des Imperium anlegten, vom Rheinland bis nach Persien. Der Wein dämpfte den Freiheitsdrang und hob das Vermögen der staatlichen Weinhändler. Diese Verquickung von Macht- und Rauschpolitik machte Schule bis in die jüngste Vergangenheit. Kaum hatten die Engländer Indien erobert, zwangen sie das Riesenland zum Einkauf riesiger Whiskymengen. In China griffen sie gleich zu härteren Drogen: Im berühmten Opiumkrieg 1856 wurde der Kaiser gezwungen, das bis dahin nur medizinisch bekannte Rauschgift unbegrenzt als Genussmittel in sein Land strömen zu lassen, und auf die chinesische Volksmoral wirkte das Opium schlimmer als einst das Feuerwasser auf die Indianer. So wurde die Opiumpfeife in China Symbol britischer Kolonialpolitik, ähnlich wie es der Weinbecher in den Zeiten römischer Weltherrschaft war.
Zur Zeit Mohammeds allerdings hatten die Römer nicht mehr viel davon. Zwar wurde immer noch überall kräftig gebechert, doch den Nutzen davon hatte die persische Staatskasse. Die römische Weinindustrie war mit dem römischen Weltreich verfallen. Der Ärger mit Germanen an der Nordgrenze und mit Persern im Süden hatte die Weingärten verwildern lassen, und in die solcherart entstandene Marktlücke flossen nun persische Kreszenzen. Am berühmtesten wurde Wein aus Schiraz, dunkel wie Gold, süß wie die Sünde und schwer wie ein Vorschlaghammer. So berühmt war das Gesöff, dass Stecklinge der gesegneten Pflanzen in weit entlegene Gebiete der damaligen Welt geschmuggelt wurden, auch nach Spanien, wo sich ein Ort gleich selbst Schiraz nannte und tatsächlich auch ein vergleichbares Gebräu zustande brachte. Später wurde aus dem spanischen Schiraz die Stadt Jerez, aber was dort gekeltert wird lässt sich auch heute noch als Sherry im jeder Weinhandlung sehen. Die persischen Weinhändler zur Zeit des Propheten hatten noch keine Konkurrenzsorgen mit diesem falschen Schiraz. Echter gefragt, und den lieferten sie nach Rom, Alexandria Sherry war und Konstantinopel, vor allem aber auch in die besseren arabischen Häuser. Der Prophet hasste die Perser als Konkurrenten auf dem Weg zur Handelsweltmacht. Daher verordnete er seinen Gläubigen einen Boykott selbstverständlich unter himmlischem Ehrenschutz. Mohammed hatte auch noch andere Gründe für sein Alkoholverbot: Er grenzte sich und seine Gläubigen damit wirkungsvoll vom Christentum ab, denn auch die Christen hatten schon sehr früh Stellung zum Alkoholismus bezogen. Beim letzten Abendmahl soll Christus so berichten die Evangelien, sein Glas gehoben und gesagt haben: "Das ist mein Blut." Seitdem gehört Wein zum christlichen Gottesdienst, als Blut Gottes, und außerhalb der Kirche sollte ein anständiger Christ nichts trinken - wer möchte denn schon ein Gottesblutsäufer sein? Mit dieser Einstellung widerstanden die Frühchristen einige Jahrhunderte römischer Verführung in fanatischer Nüchternheit, und nur in ihren eigenen Gottesdiensten wurde ihnen ein Schluck des sagenhaften Rauschgifts gegönnt. Mit dem Weinverbot aber war ab sofort jede Teilnahme an einem christlichen Gottesdienst für Muslims verboten und damit die Gefahr vermieden, Gläubige an den Konkurrenzglauben zu verlieren. Himmelfahrt mit irdischen Folgen. Mohammed war ein guter Psychologe. Er hatte seine genauen Vorstellungen, wie diese Welt zu laufen hätte, selbstverständlich nach seinem Kommando, aber er wusste auch, diese Vorstellungen schmackhaft zu machen. Er verlangte schließlich sehr viel: Unterwerfung unter seine Politik Und Aufgabe ebenso vieler lieb gewordener Laster wie Geschäftsverbindungen. Dazu reichte seine persönliche Autorität bei aller sachlichen Argumentation nicht aus. Im Verhältnis zum irdischen Lohn waren die vom Propheten geforderten Opfer einfach, zu groß. Erst das Talent, mit dem der Prophet Himmel und Hölle so plastisch auszuschmücken verstand fesselte seine Anhänger endgültig an ihn. Wir waren nun am himmlischen Zelteingang angelangt er zählte Mohammed, genau über der Kaaba, die nach seinem Vorbild erbaut ist. Würde ein Stein des Himmelstors zur Erde träfe die Kaaba. Siebzigtausend Engel gehen täglich fallen - er durch dieses Tor und keiner kehrt je wieder zurück. Gabriel ließ mir den Vortritt, denn ich bin bei Gott mehr angesehen als er, und wir kamen an einen goldenen Schleier. Die Engel sangen: "Es ist kein Gott als Allah." Und hinter dem Vorhang erklang Seine Stimme: "Ich bin Allah. Es ist kein Gott als Ich." Dann sangen die Engel: "Mohammed ist Sein Prophet." Allah bestätigte auch dies. Dann hoben mich Engelshände empor, durch siebzigtausend Schleier des Lichts und der Finsternis, jeder ein Jahrtausend dicht. Nun kam ich an ein grünes Geländer mit grünen Kissen überstrahlt von smaragdenem Licht heller als tausend Sonnen. Und ich betete an, denn die größte Nähe zu Gott ist in der Anbetung. Da wurde mir alles geoffenbart, Vor allem aber: das tägliche Gebet, die Schlussverse der Zweiten Sure und die Verzeihung aller Sünden meiner Gläubigen, den Götzendienst ausgenommen. Das Gebet ward für fünfzig Mal pro Tag festgesetzt. Erschrecken unter den Gläubigen. "Da stieg ich herab zu Moses und beriet mich mit ihm. "Bitte um Nachlass", meinte Moses. Und so ging ich hoch und erreichte eine Ermäßigung auf fünfundvierzig. Wieder ging ich zu Moses... . Nach vierundzwanzig Auf- und Abstiegen hatte Mohammed seinen Gott auf fünf Gebete pro Tag heruntergehandelt, und damit waren die Bewohner von Medina nun zufrieden.
Immerhin lauten die Schlussverse der Zweiten Sure: Der Prophet glaubt an das, was ihm offenbart wurde, und die Gläubigen glauben an Allah und seine Engel, seine Bücher und an seinen Propheten. Fünfmal täglich bestieg nun ein treuer Gefolgsmann Mohammeds einen Schemel vor dem Tor des Hauses und rief laut, was die Engel vor Gottes Thron gesungen hatten: "Auf zum Gebet, zum Guten auf!" der erste Muezzin der Geschichte. Mohammed aber holte zunächst seine schon lange fällige Hochzeitsnacht mit Aischa nach. Er war nun schon vierundfünfzig Jahre alt und Aischa immerhin schon neun. In ihren Memoiren berichtet Aischa: "Ich schlief gerade in einer Hängematte zwischen zwei Palmen als mich meine Mutter holte, mir das Gesicht wusch und mich in das Zimmer des Propheten führte, wo außerdem noch viele Jünger versammelt waren. Meine Mutter setzte mich auf Seinen Schoss, alle beglückwünschten mich und zogen sich dann zurück." Der Tag dieses Abends war bereits ein denkwürdiger gewesen: Abdallah ben Selam, der Vorsteher der jüdischen Börse von Medina, hatte sich zum Islam bekehrt. Drei Fragen hatte der gewiefte Börsianer dem Propheten gestellt: "Woran liegt es, ob ein Kind mehr dem Vater oder der Mutter ähnlich wird?" Mohammed überlegte und sagte: "Das liegt daran, wer von beiden im Augenblick der Zeugung mehr Begier empfindet." "Wie wird sich der Weltuntergang ankündigen?" "In einem verheerenden Brand, der vom Osten nach Westen fortschreitet." Daraufhin fuhr Selam seine kniffligste Frage auf: "Was ist die Lieblingsspeise im Paradies?" Der Prophet überlegte eine Weile. Auf jeden Fall musste es etwas sehr Exotisches sein, etwas, das man in der Wüstenhitze Medinas nie bekommen kann. Und so sagte er: "Fischleber". Denn er wusste, dass der Fisch nicht nur vom Kopfe her stinkt, sondern zuallererst von den Eingeweiden, und seit die Welt bestand, hatte sich noch nie ein frischer Fisch von der Küste nach Medina verirrt. Was der Prophet nicht wissen konnte: der auf Öl gebettete Wohlstand des heutigen Arabien macht's möglich, dass auch die Bürger von Medina paradiesisch schmausen dürfen. Auf den Basaren Medinas wird heute tiefgekühlte Fischleber begeistert gekauft, und es ist fast schon eine Sünde, sie nicht probiert zu haben.
Das Zeug schmeckt zwar nicht besonders und, nach arabischer Art zubereitet, überhaupt nicht paradiesisch, eher scharf wie die Hölle - aber der Prophet hat es nun einmal zum Grundnahrungsmittel des Paradieses erklärt, und dagegen hilft kein Einwand. Vor allem aber: diese Antwort überzeugte den jüdischen Börsenchef, obwohl er Mohammeds Behauptung nicht nachprüfen konnte. Er bekehrte sogleich auch einen Teil der Geschäftsführung - die formelle Einheit Medinas war hergestellt, und der Prophet feierte das Ereignis mit einer ausgiebigen Hochzeitsnacht. Am nächsten Morgen erlebte Medina seinen Propheten überaus tatkräftig. Kaum hatte er seine Gläubigen im Hof sein es Hauses zusammengetrommelt setzte er seine bedeutendste Miene auf: "Nun, Muslims gilt es, den Worten Taten folgen zu lassen. Eine gewaltige Armee unserer Feinde zieht von Syrien nach Mekka, mit Gold und Waren überreich beladen. Wollen wir den Ungläubigen all das gönnen?" Natürlich wollten die Gläubigen nicht. Schon lange ärgerten sie die prächtigen Karawanen, die von Mekka nach Syrien und von dort wieder schnurstracks nach Mekka zogen ohne in Yasrib-Medina auch nur einen Silberling Wege- und Schutzgeld zu hinterlassen. Auf die Idee, solches durch direkten Straßenraub zu unterbinden waren sie vielleicht auch schon gekommen. Nur: Getraut hatte sich das bislang noch keiner. Schließlich waren die Koreischiten dafür bekannt, dass ihre Karawanen nicht nur besonders kostbar, sondern auch besonders gut bewacht waren. Nun erklärte Mohammed den Straßenraub zum gottgefälligen Werk und rüstete selbst die Streitmacht zum "ersten heiligen Krieg". Sehr prächtig war die Truppe ja nicht - dreißig Firmenangestellte, die schon aus Mekka mitgekommen waren, unter dem Kommando von Mohammeds Onkel Hamsa. Außerdem so an die hundert Zaungäste aus Medina die das Theater unbewaffnet verfolgen wollten. Frohen Mutes zog der Haufen der Karawane entgegen - sprach es nicht für die Weitsicht des Propheten und für ein geradezu überirdisches Informationssystem, dass man genau wusste, wo und wann die Karawane daherkommen würde? Nach einer halben Wegstunde lagerte die Armee hinter einem Felsen und harrte der Dinge, die da kommen sollten.
Bald näherte sich die Karawane. An die vierhundert Kamele, alle schwer beladen und mit bunten Tüchern geschmückt aus deren Falten gut verschnürte Pakete verheißungsvoll hervorragten. Alles war so, wie es der Prophet beschrieben hatte. Nur eine Kleinigkeit hatte er übersehen: Außer den vierhundert Kamelen zogen auch dreihundert bis an die Zähne bewaffnete Koreischiten des Weges. Onkel Hamsa musterte seine klägliche Truppe und beschloss, den heiligen Krieg zu vertagen. Erst als das letzte Kamelglöckchen im Wüstenwind verklungen war, wagte sich die Armee des Propheten aus ihrem Versteck. Besonders soll den Propheten geschmerzt haben dass der Eigentümer der Ladung ausgerechnet jener Onkel Abu Dschehel war, der ihm schon in Mekka das Leben schwer gemacht hatte. Einen Monat später, die Christen .schrieben gerade April 623, war wieder eine Karawane angekündigt. Und der Prophet hatte aus dem letzten Debakel gelernt. Seit zwei Wochen verfügte der Islam über eine regelrechte Armee: sechzig ehemalige Kontoristen. Sogar eine Fahne hatten die Krieger - ein weißes Tuch an einem ausgedienten, morschen Speer. Mit "himmlisch - metallischer" Stimme gab der Prophet den Tagesbefehl: "Die Waffen müssen sprechen und Pfeile müssen fliegen!" Dann begab sich die Rotte in das Tal Batn Rabigh um den Ungläubigen aufzulauern. Pünktlich tauchte die Karawane am Horizont auf, und die Sache wurde wieder nichts. Mit den zweihundert Bewachern wollten es die Muslims lieber doch nicht aufnehmen. Damit dem Tagesbefehl des Propheten Genüge getan sei, schoss ein Jüngling namens Saad drei Pfeile ab, als die Karawane schon längst wieder außer Sichtweite war. Die Geschichte des Islam hat ihn dafür zum Helden erklärt - immerhin war dies die erste Waffentat im Namen des Propheten. Überhaupt waren die ersten Kriegshandlungen des Propheten keinesfalls mit Lorbeer bekleckert. Sechs heilige Feldzüge erwähnt die Geschichte des Islam für das Jahr 623, und alle gingen aus wie die ersten beiden. Einmal wurde eine Karawane schlicht verpasst, ein anderes mal wurde einer an der falschen Stelle aufgelauert... als einziger Erfolg ließ sich verbuchen,
dass sich nun auch der Stamm Dhamra zum Islam bekehrte und versprach, die Mekkaner im Namen Allahs zu berauben, wann immer sich dazu Gelegenheit böte. Die Dhamras lagerten an der Strecke von Mekka nach Taif, und somit hatte der Prophet auch Bündnisgenossen im Süden der verhassten Handelsmetropole. Besonders schmerzte den Propheten, dass ihm eine Karawane mit tausend Dromedaren und fast fünf Millionen Mark Frachtwert durch die Lappen ging. Ganze einhundertfünfzig Mann hatte er für diesen Raubzug unter seiner persönlichen Führung aufgebracht, doch als diese stolze Truppe nach Aschira kam, musste sie hören, dass die erhofften Schätze schon zwei Tagreisen weitergezogen und in absoluter Sicherheit waren. Vor allem aber dürfte sich in Mekka mittlerweile herumgesprochen haben, wer hinter diesen Räuberbanden stand, die zwar keinen Schaden anrichteten, aber doch Nervosität verbreiteten. Die Koreischiten beschlossen, ein Exempel zu statuieren. Da sie Erfolgsmenschen waren gingen sie die Sache auch richtig an zehn Tage nach dem missglückten Raubversuch wollte der Prophet auf der Weide seine Kamele zählen und siehe, da war keines mehr anzutreffen. Wütend schickte er seine Streitmacht aus die Viehräuber zu verfolgen. Ali, der Getreue, trug die weiße Fahne, und die Geschichtsschreiber berichten, der Trupp sei bis Bedr vorgedrungen und habe glänzende Waffentaten vollbracht. Ob die Kamele dabei zurückerobert wurden steht nirgendwo. Die Firma Islam war dadurch in eine prekäre Lage geraten, vergleichbar einem Speditionsunternehmer, dessen Fuhrpark zusammengebrochen ist. Der Prophet war gezwungen seine eigenen Geschäfte auf geborgten Kamelen abzuwickeln und es gab nicht wenige Gläubiger in Medina, die darüber heimlich lachten. Dass noch mehr Gläubige in Medina offen murrten, besorgte ebenfalls der Prophet, und zwar im Januar 624. Dies war der erste der vier heiligen Monate in denen von alters her jeder Kleinkrieg zu ruhen hatte, auf dass alle Kauflaute Arabiens ungestört zur Messe ziehen konnten. So geheiligt war diese Zeit, dass die meisten Karawanen unbewacht ihres Weges zogen. So auch eine mit Rosinen und Safran von Taif nach Mekka. Zur Mittagspause fielen acht Muslims, vom Propheten gesandt in einem Palmenhain über die Karawane her, erschlugen ihren Anführer und brachten die Beute nach Medina.
Das war sogar für die radikalsten Anhänger. Mohammeds ein starkes Stück. Beim nächsten Treffen in der Moschee nahmen fünf von ihnen den Propheten ins Gebet. Ob denn die heiligen Monate nichts mehr zu bedeuten hätten? Der Prophet erbat sich eine Denkpause, und dann erklärte er: "Ruhe ist erste Muslimpflicht, und rebellische Fragen an den Propheten sind schlimmer als Totschlag." Im übrigen gälten die heiligen Monate nach wie vor, aber nicht für Ungläubige. Die dürfen das ganze Jahr beraubt werden, im Namen Allahs. Im selben Jahr wurde Mohammeds Tochter Fatima fünfzehn, und der Prophet fand es an der Zeit, sie unter die Haube zu bringen. An Freiern war kein Mangel - auch wenn man vom Prophetenblut in ihren Adern absah, war sie als Tochter des betuchten Konzernherrn eine gute Partie. Aber alle jungen Männer wurden vom Propheten rundweg abgelehnt, obwohl sie aus den ersten Handelshäusern Medinas stammten. Da fanden die vier nächsten Vertrauten des Propheten, Abu Bekr, Omar, Saad und Moaass, man müsse einmal mit Ali reden. Der gute Junge war nun fünfundzwanzig, trug ein gepflegtes Bärtchen und hatte noch immer nichts mit Frauen gehabt. Um den Propheten hatte er sich überaus verdient gemacht nicht nur als Placebo in seinem Bett beider legendären Flucht sondern auch als Leibwächter, Butler Privatsekretär und Sündenbock - hatte er doch die Verantwortung für jene unglückselige Waffentat im heiligen Monat sofort auf sich genommen, obwohl ihm gerade das niemand glauben wollte. Die vier Weisen knöpften sich also Ali vor und mussten ihm vier Tage lang zureden ehe er sich als Brautwerber vor seinen Propheten wagte. Der Prophet gab sich väterlich: Wie viel Vermögen hast du denn vorzuweisen? Ali wurde rot bis zum Schambein:" O Gottgesandter du weißt wohl, dass ich außer einem Kamel, einem Panzerwams und einem indischen Schwert nichts habe." "Schwert und Kamel kannst du als Krieger gut brauchen", sagte der Prophet, "aber über den Panzer können wir reden. Wisse nämlich o Ali" - und hier richtete sich der Prophet zu voller überirdischer Größe auf dass mir in dieser Nacht ein Engel erschien um Fatimas Vermählung mit dir zu verkünden.
Er war farbenprächtig wie ein Eichelhäher, und kaum hatte er gesprochen, kam auch schon Gabriel, ein grünseidenes Tuch mit Perlenborten in der Hand, und erzählte: lm Paradies ward ein großes Fest gefeiert. Der himmlische Lotosbaum ward mit Juwelen geschmückt, vor dem Thron Gottes eine Kanzel auf diamantenen Füssen errichtet, und von dort aus verkündete der redegewandteste Engel, Rahil, deine Hochzeit. Daraufhin begannen alle Engel und Propheten zu tanzen. Du siehst, ich bin überhaupt nicht überrascht - der Segen des Himmels ist dir gewiss. Alis irdische Hochzeit fiel etwas einfacher aus. In seinen Memoiren schreibt Ali: Ich verkaufte ein Kamel und erhielt dafür vierhundertachtzig Drachmen. Die schüttete ich dem Propheten in den Schoss. Davon nahm der Prophet eine Handvoll und ließ Räucherwerk und Parfum kaufen. Mein Hausrat bestand aus einer Wollmatratze und einem mit Palmstroh gestopften Lederkissen. "Wenn Fatima kommt, warte auf mich", sagte der Prophet. Da kam Fatima von der einen Seite ins Gemach und ich von der anderen. Dann kam der Prophet und begehrte Wasser, das Fatima in einer Schüssel brachte. Er goss es über ihren Scheitel zwischen ihre Beine und zwischen ihre Schultern, dann sagte er: "O Gott, schütze sie und ihre Nachkommenschaft vor dem Satan." Ebenso verfuhr er mit mir und sagte: "Schlaf nun mit ihr im Namen Gottes und mit seinem Segen." Die Chronisten berichten die Ehe sei eine überaus harmonische gewesen und tatsächlich sah Ali sein ganzes Leben lang keine andere Frau mehr an. Möglicherweise aber war das Schlachtfeld der einzige Platz wo Ali seinen Mann stellte. Denn die Chronisten berichten auch von häuslichen Schlachten, und dabei soll ausschließlich Fatimas Stimme zu hören gewesen sein, gleich drei Gassen weit. Anschließend sahen Medinas Bürger einen grün und blau geprügelten Ali zur Moschee gehen allwo er Busse tat und Erde auf sein Haupt streute. So regelmäßig geschah dies, dass Ali in die Geschichte des lslam als "Erdenvater" einging, als heißblütigster Krieger der jungen Religion und sanftmütigster Pantoffelheld des alten Arabien.
Doch auch der Prophet hatte seine Sorgen. Was sich die Medinenser auch immer von ihm versprochen haben mögen - eingetroffen war davon bisher nichts. Bald wurde am Basar offen ausgesprochen, dass Mohammed außer himmlischen Worten anscheinend nichts mehr los hätte. Am lautesten verkündete dies Assma, natürlich eine Jüdin. Sie war die Tochter des zweiten Börsenchefs, und an ihr, fand der Prophet müsse ein Exempel statuiert werden. Ihr eigener Schwager, durch Blindheit daran gehindert, sich auf dem Schlachtfeld einen Platz im Paradies zu sichern bot sich als freiwilliger Mörder an, und Mohammed akzeptierte. In der nächsten Nacht schlich der Blinde in Assmas Schlafzimmer. Er fand sie, einen sechs Monate alten Sohn an ihrer Brust, schnitt ihr die Kehle durch und nagelte anschließend die Hände der Toten an den Bettpfosten fest. Am Morgen kamen dem Mörder doch Bedenken. Ob man nicht vom Stamm der Ermordeten Blutrache befürchten müsse? Der Prophet, ganz ehemaliger Ziegenhirt, beruhigte ihn: Es werden sich keine zwei Ziegen darum stoßen. Damit behielt er sogar recht. Die Sippe Assmas war so entsetzt und verschreckt, dass sie lieber geschlossen zum Islam übertrat als in Ehren um ihr Leben fürchten zu müssen. In Medina wagte seitdem niemand mehr, über Mohammed zu lachen. Der zog sich gleichzeitig aus dem Geschäftsleben zurück. Er übertrug dem allzeit getreuen Abu Bekr die Leitung der Firma, um sich selbst ganz der Religion und dem Krieg gegen Mekka widmen zu können. Zunächst verordnete er seinen Gläubigen eine Kehrtwendung. Hatten sie bisher in Richtung Jerusalem beten müssen, wurde nun Mekka als Gebetsrichtung festgesetzt, und dabei ist es bis auf den heutigen Tag geblieben. Dass die Mekkaner jener Zeit über diese Ehre erbaut gewesen sind lässt sich nicht behaupten. Sie blickten besorgt in Richtung Medina. Was ihre Zwischenträger von dort berichteten, war nicht erfreulich. Der Prophet plante, die große Frühjahrskarawane von Damaskus nach. Mekka endlich einmal wirklich zu überfallen. Und es gelang ihm nicht nur seine Angestellten, sondern auch zwei hunderteinundvierzig Medinenser zu mobilisieren.
Dreihundertfünf Mann zählte die kleine Streitmacht und drei Fahnen: zwei schwarze Tücher und ein weißes - letzteres war im Zivilleben das Bettlaken Aischas. Kampfesmut entfachte die Versicherung des Propheten, die anfällige Beute gerecht zu teilen: vier Fünftel der Mannschaft, ein Fünftel dem Propheten. Die Karawane zählte hundert Pferde, siebenhundert Kamele und tausend Mann, davon allerdings achthundert Kaufleute. Und der Grossteil der Fracht gehörte den angesehenen Handelsherren Abu Leheb und Abu Dschehel in Mekka. Aatika, eine Tochter Abdel Mutalibs, meinte daraufhin zu Abu Leheb, es sei vielleicht besser, sich nicht ganz auf die Karawanenwächter zu verlassen, sondern noch eine Hilfstruppe auf den Weg zu schicken. Sie hätte da so einen Traum gehabt... Da aber fuhr sie Abu Leheb an: Reicht es nicht schon, dass wir einen Propheten in der Sippe haben? Fangen die Weiber jetzt auch noch an?! Drei Tage später kam ein Kurier von der Karawane: Es gäbe da Gerüchte, der Transport solle bei Bedr überfallen werden. Ob Abu Leheb nicht doch Hilfstruppen schicken könne? Nun erst machten sich hundert- fünfzig Koreischiten unter Anführung Abu Dschehels auf den Weg. Mohammed lagerte mit den Seinen unterdessen bereits auf einem Sandhügel bei Bedr. Einen ungünstigeren Platz hätte er auch nicht finden können. Weit und breit gab es kein Wasser, und einige Soldaten murrten bereits, ob sie statt im Kampf vielleicht an Durst sterben sollten? Da wirkte der Himmel ein Wunder. In der Nacht fiel ausgiebiger Regen und am nächsten Morgen kam die Karawane in Sicht. Gleichzeitig aber auch die Truppen aus Mekka, und damit hatten die Gläubigen nicht gerechnet. Ein langer Kriegsrat wurde gehalten. Die Mehrzahl der Medinenser war dafür, der Karawane entgegenzuziehen, sie zu berauben und dann schnell vor den Mekkanern davonzulaufen. Da traten Omar und Abu Bekr vor Mohammed und sagten feierlich: Prophet, befiel, wir folgen dir. Sie müssen das wirklich ergreifend gemacht haben - fast allen Gläubigen schossen Tränen in die Augen, und sie schworen dem Propheten so lange ewige Treue, bis sich Hilfstruppen und Karawane vereinigt hatten. Dann bauten sie dem Propheten auf dem Feldherrnhügel noch ein Zelt aus Palmblättern, und dann kamen auch schon Abgesandte der Mekkaner.
Nach altarabischer Sitte schlugen sie einen Zweikampf vor, der die Schlacht entscheiden sollte. Mohammed stimmte zu und wählte die drei bulligsten Medinenser aus. Damit aber waren die Koreischiten nicht einverstanden. Wenn schon, wollten sie sich nur mit ihresgleichen schlagen. In der Morgenkühle des nächsten Tages gingen drei Paare aufeinander los. Doch sehr lange hielt der ritterliche Zweikampf nicht an - ehe noch eine Entscheidung gefallen war, kam es schon zu einem wüsten Handgemenge aller gegen alle. Mohammed saß der weilen betend in seinem Zelt, und dabei sah er, dass sich auch die himmlischen Heerscharen in das Getümmel stürzten. Ob sie entscheidend mitkämpften, kann nicht überprüft werden. Auf jeden Fall hatte drei Stunden später der Islam seinen ersten Sieg errungen. Siebzig Gefangene wurden vor den Propheten geführt darunter auch Abbas, sein Onkel. Der trat, um sich das Lösegeld zu ersparen, zum Islam über und zog dann schnell nach Mekka ab. Aber auch siebzig Gefallene wurden gezählt, darunter Abu Dschehel. Als er mit den anderen in eine schnell aufgescharrte Grube geworfen wurde, hielt ihm der Prophet noch eine längere Rede die der Nachwelt erhalten blieb und mit: "Na, was sagst du nun?" begann. Omar, der gekämpft hatte und dementsprechend müde war, fand das ginge doch zu weit. "Merkst du nicht dass du mit Toten redest?" fragte er den Propheten. Der entgegnete würdevoll : "Die hören mir schon zu. Nur antworten können sie nicht." Die Beute war für damalige Vorstellungen ungeheuer groß und enthob die Gläubigen für lange Zeit aller irdischen Sorgen. Ebenso hoch war auch das Lösegeld, das nach dem gleichen Verteilersystem unter das Volk kam. Nur zwei Gefangene hatten nicht bezahlen können und wurden hingerichtet. Der dritte, der nicht bezahlen konnte war Abu Asa, im Zivilberuf Dichter. Ihn ließ der Prophet ziehen aus Achtung vor der Dichtkunst und mit der Auflage: Gebrauche wider mich nie wieder das Schwert der Zunge oder die Zunge des Schwertes. Kurz darauf starb zu Mekka Abu Leheb der erbittertste Feind des Propheten. Nie geklärt wurde, ob aus Ärger über den Verlust der Karawane ob an einer Seuche oder an den Folgen der Prügel seiner Schwägerin.
Denn des Abbas Gemahlin, empört über die durch das Lösegeld verursachte Einschränkung des Lebensstandards, war auf den alten Herrn mit einem Knüppel losgegangen. Einen Tag später starb in Medina Rakischet, des Propheten älteste Tochter. Sie hatte nicht viel von ihrem Leben gehabt. Zuerst war sie von ihrem Papa aus Geschäftsgründen ausgerechnet mit Abu Leheb verheiratet worden, der das Mädchen schließlich an seinen ältesten Sohn abtrat. Als es zum Krach zwischen Schwiegervater Mohammed und seinem zwanzig Jahre älteren Schwiegersohn gekommen war, wurde Rakischet mit ihrem Hochzeitsschleier gefesselt verkehrt auf einen Esel gesetzt und vor dem Haus. ihres Papa abgestellt. Der wickelte sie unter dem Spott seiner Nachbarn aus sperrte sie in ein Zimmer und ließ sie nie wieder auf die Strasse. Sonnenlicht sah das arme Mädchen erst wieder, als ihr Papa sie nach Medina transportierte. Dort wurde Rakischet wieder in ein Zimmer eingeschlossen und dort schluckte sie im März 624 Gift. Der Prophet hatte wichtigeres zu tun, als um sie zu trauern. Der Erfolg machte seine Gläubigen kriegshungrig und innerhalb von zwei Wochen wurden zwei weitere Karawanen aufgebracht und ausgeplündert eine aus und eine nach Mekka. Dann wurde auch noch die Karawanserei von Kainokaa dem Erdboden gleichgemacht. Hier hatten bisher Mekkas Karawanen Proviant gefasst. Nun kontrollierte der Islam die wichtigsten Nord-Süd-Strassen Arabiens. Was aber der Islam zu bedeuten hatte, verstanden die Araber jener Zeit nicht mehr ganz. War es nun ein Konzern, der mit bislang unbekannter Brutalität auf das Monopol hinarbeitete oder eine Horde von Straßenräubern unter Leitung eines Größenwahnsinnigen? Zur Feier seines Sieges ließ der Prophet in Medina seinen letzten nennenswerten Gegner umbringen Abu Aas, den nun schon beinahe hundertjährigen Rabbiner der Judengemeinde. Starrsinnig, wie nur Alte sein können hatte er ausgerechnet nach dem Sieg des Propheten eine Predigt über Straßenraub gehalten und behauptet, auch der heiligste Krieg sei nur gotteslästerlicher Massenmord.
Am nächsten Tag wurde der Greis in seinem Schlafzimmer gefunden, mit durchschnittener Kehle, die Hände am Bettpfosten festgenagelt. Diese Handschrift war bekannt. Dennoch wurde der Prophet am Mittag desselben Tages ohne eine einzige Gegenstimme zum Kommandanten aller Waffen fähigen von Medina gewählt. Sogar die Judengemeinde stellte ein Fähnlein. Diese Einigkeit kam nicht von ungefähr. Im Süden waren sich Größere einig geworden: Mekka, Taif und sämtliche befreundete Stämme rüsteten eine respektable Armee aus, die in Eilmärschen nach Medina zog, um dort keinen Stein auf dem anderen zu lassen. Will man den Chronisten glauben, begaben sich dreitausend Mann Infanterie, siebenhundert Panzerreiter auf Kamelen, zweihundert Bogenschützen auf Pferden und dreitausend Mann leichte Kamel-Kavallerie auf den Kriegspfad. Doch die Zahl ist unwahrscheinlich, und da sie von islamischen Historikern berichtet wird, dürfen wir sie getrost durch zehn dividieren. Auch dann bleibt sie noch beachtlich - Medina hatte diesem Aufgebot nichts Vergleichbares entgegenzustellen. Eine halbe Spazierstunde südlich von Medina liegt ein einsamer Hügel, und so heißt er auch: Ohud, der Einzelne. Dort traf die Truppe des Propheten die Armee aus dem Süden. Wieder wurde ein Zweikampf vereinbart, und wieder ging das Gemetzel noch vor dessen Entscheidung los. Es wurde die größte Niederlage des Propheten. Ein kleiner Anfangserfolg führte die Katastrophe herbei: Kaum sah der rechte Flügel des Propheten einige Koreischiten davonlaufen, stürzte sich die beutegierige Meute auf das Lager der Mekkaner. Doch die goldenen Gefäße, die so herrlich in der Sonne geblinkt hatten, entpuppten sich als dünnes Messingblech, raffinierte Köder, mit denen ein Drittel der Armee vom Schlachtfeld gelockt wurde. Daraufhin meinte der jüdische Truppenteil des Propheten, hier gäbe es nichts mehr zu gewinnen, und zog nach Medina zurück. Vom Islam blieben rund hundertzwanzig Mann übrig, die auch bald um ihr Leben rannten. Nur dreiundfünfzig von ihnen erreichten die rettenden Stadtmauern. Sogar der Prophet bekam was ab: Ein Stein hinterließ auf seiner Stirn eine bleibende Narbe. Warum die siegreichen Koreischiten nicht gleich vor Medina zogen wird für immer ein Rätsel bleiben.
Eine günstigere Gelegenheit, den Propheten für alle Zeit zu erledigen, als dieser 22. April 624 sollte sich nie Wieder ergeben. Doch die siegreiche Armee verhielt sich, als habe sie die Schlacht verloren: Ohne Ordnung, als lockerer Betriebsausflug, trat sie den Heimweg an. Und da bewies Mohammed militärisches Genie. Mit seiner Handvoll übriggebliebener Soldaten setzte er der Nachhut nach und erschlug am nächsten Tag deren sämtliche Kamele und auch den Dichter Abul Asa, der natürlich wieder mitgekämpft hatte. Von nun an ging's bergauf. Der Prophet organisierte seine Armee zu acht kleinen Räuberhaufen, die überall in Arabien alle Karawanen überfielen, die nicht nach Medina ziehen wollten. Bereits im Mai machte allein das Prophetenfünftel an der Beute vierzigtausend Drachmen aus, nach heutiger Kaufkraft gut hundertzwanzigtausend Mark. Am Jahresende war er bereits Millionär. Daraufhin verdoppelte er nicht nur seine Armee, sondern auch seinen Haushalt. Zu seinen Frauen Suda und Aischa heiratete er noch schnell Seineb und Hafsa. Jede der Damen brachte wieder eine Firma als Mitgift, zu deren Verwaltung ebenfalls Abu Bekr bestimmt wurde. Bald sprach sich in der ganzen damaligen Welt herum, dass Karawanen, die nach Mekka wollten, dort fast nie ungeplündert eintrafen. Der Prophet führte eine Art totalen Krieges: Wer in seine Gefangenschaft geriet, wurde als Sklave nach Abessinien oder Nedsch verkauft, und damit verglichen war selbst Stalins Sibirien ein Erholungsurlaub. Wer also seines Lebens sicher und seines Geldes froh sein wollte musste wohl oder übel zur Messe nach Medina ziehen und dort selbst höflich um den Schutz des Propheten ansuchen. Der kostete zehn Prozent vom Umsatz und das Glaubensbekenntnis: "Es gibt keinen Gott als Allah und Mohammed ist sein Prophet." Zugegebenermaßen verdankte der Prophet diese Erfolge weniger seinem eigenen Talent als Kriegsherr, sondern eher der totalen Unfähigkeit seiner Gegner. Die Koreischiten waren durchaus in der Lage, beachtliche Truppenkontingente auf die Beine zu stellen. Hätten sie auch nur einen talentierten Feldherrn gehabt wäre die ganze spätere Weltgeschichte wahrscheinlich anders verlaufen. So aber belagerten sie einmal zwei Monate lang Medina, ohne sich zu einem einzigen Angriff entschließen zu können, ein anderes Mal liefen sie schon davon, ehe die Armee des Propheten in Sicht kam.
Das alles hatte natürlich böse Folgen. Im heiligen Messemonat März 628 berief der Stadtrat eine Krisensitzung ein: Nur noch zwei Aussteller waren zur Messe gekommen. Der Platz um die Kaaba strahlte in gähnender Leere, vergleichbar nur der Staatskasse. Einundzwanzig Handelshäuser waren innerhalb der letzten zwei Monate pleite gegangen, und das Gewerbesteueraufkommen deckte nicht einmal mehr die Straßenreinigung ab. Mekkas Stadtväter machten lange Gesichter. Sie wurden auch nicht fröhlicher, als einer der beiden Aussteller in die Sitzung platzte und sagte, aufgrund seiner dürftigen Geschäfte sähe er sich außerstande, die Platzgebühr zu bezahlen, und seine Waren habe er sicherheitshalber schon abtransportieren lassen. Ehe noch darüber beraten werden konnte, ob man nicht lieber gleich Staatsbankrott anmelden solle, kam noch ein Bote: Ein vermögender Handelsherr zeige großes Interesse an der Messe von Mekka und sei bereit, gegen herabgesetzte Gebühren den Markt wieder zu beleben. Bei fünfzig Prozent Preisnachlass würde er gleich siebenhundert Messestände mieten. Das war natürlich ein verlockendes Angebot. Dennoch wurden die Mekkaner darüber nicht froh - es kam von Mohammed.
|
|
Ein multinationaler Konzern
|
|
|
Wirtschaftspolitik und höhere Mathematik haben gemeinsam, dass sie auf ganz einfachen Faustregeln beruhen. "Krisen beleben das Geschäft", heißt eine, eine andere: "Wer die Nutznießer von Katastrophen finden will muss dort suchen wo zuerst und am lautesten gejammert wurde." Die beliebteste Methode, über Gebühr in andere Taschen zu langen heißt wissenschaftlich "Marktverknappungs-Strategie" volkstümlich nach einer Wortschöpfung von Goebbels "Engpass". Der entsprechende arabische Ausdruck heißt schlicht "Nadelöhr" da sollen die Kamele durch und bei der Gelegenheit kräftig Fett, sprich: Geld lassen. Das "Nadelöhr" ist wohl das älteste Kind der Marktwirtschaft und feiert in seiner jugendlich-ruppigen Gestalt noch heute auf den Basaren des Orient fröhliche Urständ. Da erzählen an einem Morgen alle Händler ihren erschreckten Kunden von einer schlimmen Missernte beispielsweise bei Tee. Schon am Nachmittag sind dann sämtliche Teevorräte aus den Läden verschwunden. Wer am nächsten Morgen Tee kaufen will, hört dann: "Ja wissen Sie denn nicht...? Allerdings habe ich gestern noch einen kleinen Posten Tee bekommen, aber sündhaft teuer..." Dann holt der Händler ein kleines Päckchen Tee aus dem Gewölbe in das er seine Vorräte tags zuvor versteckt hatte, und es ist um das Zehnfache teurer geworden. Natürlich funktioniert dieses Spiel nur wenn sich alle Händler am Ort daran beteiligen. Doch bei der Aussicht auf gesteigerten Gewinn fällt Solidarität nicht schwer, und so genügen oft kleine äußere Anlässe, daraus eine schöne Versorgungskrise zu machen. Nach genau diesem Rezept wurde die Krise Mekkas im Jahr 628 zu einer lebensbedrohenden für die Bevölkerung des Stadt-Staates zubereitet. Durch die Räubereien des Propheten war es tatsächlich zu kleinen Versorgungsschwierigkeiten gekommen. Die Handelsherren der Stadt machten daraus große und verdienten daran soviel wie noch nie in ihrer Firmengeschichte. Gegen die Krisenpolitik der Konzerne half auch keine Regierung schließlich waren in Mekka Stadträte und Handelsherren gleich ein und dieselben Personen. Aus patriotischen Gründen schlugen die Stadtverordneten Mohammeds Gesuch ab, den Markt beschicken zu dürfen und auf dem Markt wurden daraufhin sogar Datteln unerschwinglich.
Mekkas Hausfrauen mussten ihren Schmuck für einen Topf Hirse verkaufen. Mohammed aber betrieb seine eigene Marktstrategie - bald sprach sich in Mekka herum, dass es beim Brunnen von Hobaida eine überaus preiswerte Einkaufsmöglichkeit gebe. Dort eine Tagreise von Mekka, hatte der Prophet seine Stände aufgeschlagen. Zu ihm strömten nun die ärmeren Mekkaner mit ihren Einkaufstaschen und ihrem letzten Geld. Sie bekamen überraschend viel dafür das meiste sogar unter dem Einkaufspreis des Propheten. Allerdings musste für diesen Supermarkt ein symbolischer Eintrittspreis entrichtet werden: Das Glaubensbekenntnis des Islam. Mekkas Stadtväter ergrimmten und hätten den Propheten am liebsten mit Waffengewalt verjagt. Doch die Staatskasse war leer, und für die gemeinsame Armee vom privaten Profit etwas zu opfern, kam keinem Handelsherrn in den Sinn. Daher wurde verhandelt. Mekkas Angebot an Mohammed lautete: Für zehn Jahre würden sämtliche Nord-Süd-Karawanen freiwillig in Medina Station machen und 20 % Maut zahlen. Dafür müsse der Prophet sein Lager vor Mekka abbauen. Mohammed lachte. Die Nordroute kontrollierte er ohnedies. Außerdem sei der Markt von Mekka für ihn als glühenden Patrioten eine innige Herzensangelegenheit. Da willigte der Senat auch ein, dass die Firma Islam künftig die Messe von Mekka beschicken dürfe, allerdings mit der Auflage die örtlichen Preise nicht zu unterbieten. Nun schlug Mohammed ein - mehr hatte er nicht gewollt. Überdies bekam er durch den Friedensschluss genügend Truppen frei, auch das restliche Arabien unter seine Kontrolle zu bringen. Bereits einen Monat später zerstörte er die jüdische Karawanserei von Chaiber, bislang seine schärfste Konkurrenz im Handel mit Byzanz. Privat feierte er diesen Sieg mit einer Vergrößerung seines Harems auf sechs Damen. Eine davon brachte auch Anteile am größten Handelshaus von Alexandria ins Ehebett, und in der Hochzeitsnacht forderte der Erzengel Gabriel den Propheten auf, auch etwas für die Auslandsbeziehungen des Islam zu tun. Mohammed schickte sechs Delegationen los mit kleinen Musterkoffern und langen Sendschreiben über die Vorteile einer Fusion mit dem Islam.
Für die Unterschrift dachte er sich einen neuen Titel aus, den er von nun an beibehalten sollte: "Mohammed, Gottes Gesandter! " Der Negus von Abessinien erklärte sich bereit, den Außenhandel seines Landes vom Islam organisieren zu lassen. Der Patriarch von Alexandria erbat Bedenkzeit und schickte als Werbegeschenke zwei koptische Sklavinnen, Maria und Sirin, das Rassepferd Maimum sowie einen Esel und einen Maulesel. Der Statthalter von Jemen war einer Fusion mit dem Islam nicht abgeneigt, fand aber Mohammeds Geschäftsbedingungen unter seiner Würde. Der Prophet wollte seinen Geschäftspartnern nur ein Drittel des Profits überlassen, und so schrieb der Geschäftsführer von Jemen, er sei ja auch Geschäftsmann und Dichter, ob der Prophet unter diesen Umständen nicht fünfzig zu fünfzig machen wolle? Persiens Schah zerfetzte das Schreiben ohne ein weiteres Wort, was ihm der Prophet nie verzieh. Und die freundlichste Antwort soll aus Konstantinopel gekommen sein, ein bezaubernder liebenswürdiger begeisterter, ja geradezu Huldigungsbrief. Eigenartigerweise fehlt gerade davon in den sonst ausgezeichnet geführten Archiven von Byzanz jede Spur. Der größte Erfolg dieser ganzen Aktion dürfte letztlich die Sklavin Maria gewesen sein. Sie schenkte dem Propheten dessen einzigen Sohn, Ibrahim. Doch der Junge hatte nichts davon, dass Prophetenblut in seinen Adern floss - seine Mama wurde im Harem nur als "Nebenlägerin" anerkannt, und für Ibrahim war von Anfang an nichts zu erben. Diese Einteilung in Haupt- und Nebenfrauen wurde sehr bald nötig. Infolge der zahlreichen Geschäftsverbindungen Mohammeds wuchs sein Harem auf neun reguläre Gattinnen an, kommandiert von der jüngsten und launenhaftesten, der immer Kind gebliebenen Aischa. Dass dem zehnjährigen Stillhalteabkommen zwischen Mohammed und Mekka eine lange Lebensdauer beschieden sein könne glaubten nicht einmal Optimisten. Bewusst hatte der Prophet in dem Vertragswerk auf einigen Rechtslücken bestanden, und durch die marschierte er nun mit seinen Truppen zur Eroberung ganz Arabiens. Schließlich war nur die Nord-Süd-Strasse Vertragsgegenstand. Über die anderen Routen zu verhandeln, hatte sich der Prophet geweigert. Ein Jahr später hatte er sie auch schon fest in seiner Hand.
An den Strassen nach Muskat und Persien; den wichtigsten Ostverbindungen, unterstanden achtzehn schwerbefestigte Karawansereien der Firma Islam, und die Strasse nach Jemen wurde andauernd von islamischen Räuberbanden verunsichert. In Mekkas Rathaus, dem ehrwürdigen Gemäuer aus den Konjunkturzeiten unter Mohammeds Großvater, tagte zum letzten Mal der Katastrophenrat der Koreischiten. Alle waren sie mit dem verwandt, der sie so in die Klemme gebracht hatte: Sieben Onkel und vier Cousins saßen beisammen, und einer beschimpfte den anderen, warum er nicht Mohammed erschlagen habe, als dazu noch Gelegenheit war. Dann beschlossen die Stadtväter, Mekkas Demokratie zu begraben. Ebl Sofian ein energischer Endfünfziger, wurde für unbestimmte Zeit zum Generalbevollmächtigten der Stadt bestimmt. Der Rest der Regierung begab sich schleunigst nach Hause, um seine Schäfchen ins trockene zu bringen. Viel Zeit blieb dazu nicht mehr: Der Prophet hatte sich zur Messe angekündigt, mit dem freundlichen Nebensatz, dass diesmal seine Anhänger die berühmte Messestadt besichtigen wollten. Das war natürlich eine Kriegserklärung. Am ersten Januar des Jahres 630 brach der Prophet aus Medina auf. Bereits nach sechs Tagmärschen sollen seine Truppen auf zehntausend Mann angewachsen sein, und der Armee kam ein Bote aus Mekka entgegen: Ein derartiger Touristenstrom sei, auch wenn er in friedlicher Absicht daherkomme, glatter Vertragsbruch. Die Stadt Mekka sehe sich außerstande, so viele Gäste zu beherbergen. Der Prophet sah dies ein und bezog Nachtlager zu Dschohfa, in Sichtweite der Stadt. Mohammed war ein Genie psychologischer Kriegsführung. Kein Mensch in Mekka wusste, ob der Prophet tatsächlich mit zehntausend Mann die Stadt umzingelt hatte oder ob auch dies wieder nur ein Bluff war - tagsüber ließ sich kein einziger Muslim sehen. Nachts aber flammten auf allen Höhen unzählige Wachtfeuerchen auf, und diese Beleuchtung brachte Mekkas Bürger um ihren Schlaf. Drei Nächte währte das Feuerwerk, dann begab sich Ebi Sofian aus der Stadt, den Propheten zu suchen. Weit brauchte er nicht zu gehen schon zweihundert Meter nach dem Stadttor nahm ihn eine Patrouille gefangen, setzte ihn gefesselt auf ein Kamel und legte ihn in ein Zelt, ohne ein Wort zu sagen.
Dort blieb Ebi Sofian den restlichen Tag und auch die Nacht über liegen. Durch einen Spalt im Zeltvorhang konnte er sehen, wie jeder Soldat sechs kleine Feuerchen anlegte. Am nächsten Morgen wurde Ebi Sofian vor Mohammed geführt. Der Prophet saß beim Kriegsrat, zur Rechten Abu Bekr, links Omar, und fragte betont freundlich: "Na, Ebi Sofian, glaubst du mir nun, dass es keinen Gott gibt außer Allah?" Da fiel Ebi Sofian auf die Knie und sagte: "Dann schone wenigstens die anderen Firmen." Der Prophet sagte: "In der Einigkeit liegt die Stärke. Wenn ihr das einseht, ist der heutige Tag ein Fest der Barmherzigkeit und für die Zukunft von großem Gewinn." Ebi Sofian sah ein, und Mohammed war der Herr Mekkas. Der Einzug des Propheten in seine Vaterstadt war ein Freitag, und dieser Tag ist seither der Feiertag des Islam. Mohammed hatte sich prächtig herausgeputzt: Eigens für diesen Anlass hatte er sich einen Purpurmantel anfertigen lassen, wie ihn früher nur der römische Kaiser tragen durfte. Vor seinem Kamel flatterte die grüne Fahne von Kadidschas einstiger Firma. Nur ausgesuchte Truppenteile durften ihn begleiten - fast wäre es vor dem Einzug noch zu einer Meuterei gekommen, denn die Medinenser hatten vorgehabt, Mekka nach Herzenslust zu plündern. Nun mussten sie sicherheitshalber vor den Stadttoren kampieren. Von Gefühlsausbrüchen der Mekkaner wird nichts berichtet. Die Stadt soll vielmehr, "in ehrfürchtigem Schweigen verharrt" haben, und das ist nur allzu verständlich. Durch menschenleere Strassen ritt der Prophet direkt zur Kaaba. In dem halbdunklen Kasten hingen die Embleme und Hausgötter aller mekkanischer Sippen und Handelshäuser. Elf Männer und sechs Frauen warteten davor, auf Knien und mit Ketten gefesselt, wie der Prophet es gefordert hatte - die Vorstandsvorsitzenden der größten Konzerne. Vierzehn von ihnen wurden ohne weitere Umstände umgebracht, drei Frauen ließ Mohammed laufen. Dann verkündete er: "Allah, der Herr aller Geschöpfe, hat dieses heilige Haus seit Erschaffung der Welt geheiligt. Daher sei allen, die an ihn glauben, in Zukunft untersagt, hier Blut zu vergießen oder einen Baum zu fällen."
Darauf begab er sich in die Kaaba Binnen weniger Minuten flogen dreihundertfünfundsechzig Firmenembleme und Hausgötter auf den Platz. Nur das Zeichen des Stammes Chosaa hing so hoch, dass es nicht einmal Ali erreichen konnte. Da ließ ihn der Prophet auf seine Schultern steigen. Ali war ergriffen: "Ich fühlte mich in den Himmel erhoben." Immerhin so hoch, dass er das Zeichen von der Wand reißen und vor die Kaaba schmeißen konnte. Dort ließ der Prophet die zahlreichen Symbole zu einem Haufen aufschichten und übergab Arabiens pluralistische Gesellschaft feierlich den Flammen. An den Schlüssel zur Staatskasse in der Kaaba kam er nicht so einfach. Osman, ihr Verwalter, weigerte sich, ihn zu übergeben. Ali musste dem Alten erst vier Zähne einschlagen, ehe er dieses letzte Zeichen mekkanischer Unabhängigkeit dem Propheten zu Füssen legen konnte. Mohammed studierte die Bücher und musste zugeben, noch nie ordentlicher geführte gesehen zu haben. Daher übertrug er auch die weitere Verwaltung der Kaaba an Osman, und dessen Nachkommen verwahren noch heute die Schlüssel zur Kaaba. Nur die Staatsbank wurde anderweitig untergebracht. Überhaupt zeigte sich Mohammed als großzügiger Sieger. Nur etwa zweihundert Mekkaner wurden hingerichtet, und die übrigen konnten Allah nicht genug für die Gnade preisen, mit dem Leben davon gekommen zu sein. Zwei Tage hatten sie Zeit, ihre Firmen dem Islam zu übertragen. Schon am Morgen des zweiten Tages waren sämtliche Transaktionen erledigt. Gerührt beschloss Mohammed daraufhin, für seine Vaterstadt in alle Ewigkeit zu sorgen: In Zukunft sollte jeder Muslim wenigstens einmal Mekka besucht haben am besten zur Zeit der Frühjahrsmesse. Zwei Wochen später ergab sich Taif. Diesmal war der Prophet nicht so gnädig. Sämtliche Handelshäuser wurden aufgelöst, ihre Inhaber umgebracht, aber eine Pilgerfahrt wurde nicht verordnet. Vielmehr unterstellte Mohammed den Basar von Taif ausgerechnet der Marktaufsicht von Medina. Mohammed beherrschte nun praktisch ganz Arabien. Prophet nannte er sich nur, weil er keinen besseren Titel fand. Wie soll man auch einen Händler nennen, der ausgezogen war, den Markt zu erobern, und darüber zum Staatsmann und Religionsgründer wurde?
Erst die moderne Fachsprache fand für das Wirken des Propheten den passenden Ausdruck: Kampf um das Monopol. Auch wer nicht an den Islam glaubt, sollte Mohammed seine Hochachtung nicht versagen, als einem der größten Genies der Geschichte und dem Gründer des ersten Großkonzerns. Geschichtsschreiber sind oft wissenschaftlich getarnte Romantiker, und viele glauben, die großen Entscheidungen fänden auf dem Schlachtfeld statt und nicht auf dem Markt. Damit aber tun sie dem Propheten unrecht. Sein atemberaubender Aufstieg war das Ergebnis seiner Marktstrategie. Ihr dienten auch seine Feldzüge, denn sie waren weniger einem Krieg vergleichbar als einem Bankraub. Nur deshalb trafen sie seine Gegner tödlich, in die Seele des Geschäfts. Wie niemand zuvor hatte der Prophet erkannt, dass Wirtschaft vor allem Vertrieb bedeutet, und durch den Vertrieb bekam er auch die Produktion in die Hände. Wer nach vergleichbaren Charakteren sucht, wird unter den Religionsgründern keine finden. Die mit Mohammed am ehesten vergleichbare Persönlichkeit ist John David Rockefeller, der eintausend-zweihundertfünfzig Jahre später seinen Konzern nach ähnlichen Methoden schuf wie Mohammed den frühen Islam. Allerdings betrieb die "Standard Oil" zwar Politik, wurde aber kein Staat; sie blieb das mächtigste Industrie-Unternehmen der westlichen Welt, entwickelte sich aber nicht zur Religion. Der aufgeklärte Materialismus der Gegenwart hat eine Meta-physische Verpackung der Macht nicht mehr nötig. Der Konzern des Propheten musste aufgrund der Bedürfnisse seiner Zeit eine Religion werden. Ohne überirdische Hilfe hätte sich Mohammed nur sehr schwer durchsetzen können. Daher brauchte und gebrauchte er Gott, um sein Geschäft zu betreiben und in Betrieb zu halten. Von den hitzigen Weltuntergangsvisionen des Anfangs abgesehen, ließ sich Allah nur vernehmen, wenn es im Geschäftsinteresse lag, als des Propheten überirdisches Über-Ich, mit einem betonten Sinn für Praxis. Von allen Religionen der Welt ist daher auch der Islam die sachlichste die am meisten an den Erfordernissen des täglichen Lebens orientierte. Doch auch tägliche Gewohnheiten des Propheten schlugen im Islam zu Buche. Mohammed war, was Essen betraf, durchaus kein Kostverächter, und so liest sich der Koran stellenweise wie ein Kochbuch, ab und zu von Vorurteilen diktiert, häufig aber von Vernunft.
Dass ein Muslim beispielsweise kein Schweinefleisch essen darf, liegt an der Schweinehaltung im Orient. Dort gilt das Schwein seit undenklichen Zeiten als Straßenreinigung. Dadurch ist es natürlich ein gefährlicher Seuchen-überträger, meist tuberkulös und fast immer voller Trichinen. Dass Eidechsenfleisch für Muslims ebenfalls verboten ist, liegt allerdings nur daran, dass Mohammed diese Standardkost alter Araber nicht schätzte. Er behauptete, Eidechsen seien in einem früheren Leben Menschen gewesen ein Beweis übrigens, dass ihm nicht nur Christen- und Judentum, sondern auch die hinduistischen Lehren von der Wiedergeburt durchaus bekannt waren. Zwiebeln und Milch liebte Mohammed über alles, Knoblauch konnte er nicht leiden und Datteln aß er leidenschaftlich gern. Der Koran erwähnt allein neunundvierzig verschiedene Zubereitungsarten für Datteln, zwölf Hammel-Rezepte und vier für Kamelhöcker. Wer einmal arabisch gegessen hat, wird bestätigen können, dass noch heute der Geschmack des Propheten den Speisezettel bestimmt. Politische Gründe hatte das Verbot, Fleisch mit dem Messer zu schneiden - das war nämlich Persersitte. Und diese Essvorschrift hat sich auch nicht lange gehalten. Verschiedene Motive bewogen Mohammed, seinen Gläubigen die schönen Künste zu verbieten. Als praktischer Unternehmer fand der Prophet: Kultur ist Zeitverschwendung. Musik schnitt dabei am schlimmsten ab. Zweifellos aus Gründen des Jugendschutzes untersagte er Tanz als sinnlose Kraftverschwendung und Ursache unsittlicher Gelüste. Davon abgesehen ärgerte ihn an Instrumentalmusik dass dabei viele Geräusche gemacht werden, ohne etwas zu sagen. Doch den Ausschlag dürfte gegeben haben, dass die arabischen Musiker seiner Zeit meist anstößige Perserklänge produzierten. Auch das Bilderverbot des Islam dürfte von politischen Überlegungen diktiert sein. Zu Mohammeds Zeit war die persische Malerei die höchstentwickelte der Alten Welt, subtil realistisch und von einer geradezu köstlichen Detailfreude. Die Malerei römischer Schule aber lag ziemlich im argen die meisten Maler begnügten sich mit dem Kopieren von Prototypen, und daraus entwickelte sich ein steif-ritueller Stil, wie wir ihn von Ikonen her kennen.
Das Christentum bevorzugte feierliche, jederzeit wieder erkennbare Darstellungen,und so ging in Konstantinopel nicht nur die Kenntnis der Perspektive wieder verloren, sondern auch die Beachtung individueller Details. Selbst die gegensätzlichsten Kaiser gleichen einander auf den Porträts wie ein Ei dem anderen. In Arabien hatte sich daher der persische Stil durchgesetzt. Allein zu Medina lebten vier gutbezahlte persische Porträtisten, und das war ein triftiger Grund, Bilder ganz allgemein zu verbieten. Einen weiteren dürfte Mohammed von dem ihm sonst verhassten Judentum übernommen haben : Schon Moses grenzte seine Gemeinschaft von anderen Religionen wirkungsvoll durch ein Bilderverbot ab. Mohammed erzählte seinen Gläubigen, Gott sähe es gar nicht gern, wenn man sein Schöpferhandwerk durch Malerei nachzuäffen ersuche. Am Jüngsten Tag werde Allah daher alle Künstler dazu verurteilen, ihre Kunstprodukte zu wirklichem Leben zu erwecken. Gelänge dies nicht, hätten die Maler ihr ewiges Leben erwirkt. Diese Drohung wirkte auf orthodoxe Muslims. Ihre ästhetischen Gelüste befriedigten sie fortan mit Schrift noch heute zählt im Islam Kalligraphie zu den geachtetsten Künsten, und einige Meister schafften sogar, dass ihre Buchstaben vor lauter Schönheit völlig unlesbar wurden. Außerdem erfanden die Muslims zahlreiche Ornamente. Die hatte der Prophet ja nicht erboten, und auf dieser Spielwiese der Phantasie tobten sich die Künstler des Islam so kräftig aus, dass wir heute noch Formspiele als "Arabesken" bezeichnen. Doch in seiner ganzen Strenge ließ sich das Bilderverbot nie durchsetzen. Vor allem im persischen Kulturkreis kehrten die Künstler bald wieder zum Abbild zurück. Allerdings wurde auch für sie der Islam stilbildend: Um nicht frontal gegen das Verbot realistischer Malerei zu verstoßen wurden nur Details realistisch wiedergegeben die Gesamtkomposition jedoch in einer Art synthetischer Perspektive ornamental gestaltet. Sogar Mohammed wurde abgebildet, und hier erhielt sich ein letzter Respekt vor seiner Bildfeindlichkeit: Mit nur einer einzigen bekannten Ausnahme tritt der Prophet stets verschleiert auf und von himmlischen Flammenzungen umgeben. Außerdem wurde eine neue Malform entscheidend, die Miniatur. Großflächige Malereien blieben stets ornamental, im kleinen Format aber triumphierte der Realismus. Ein Grund mag sein dass sich kleine Sünden gegen den Propheten, wie Miniaturen auf persisch tatsächlich heißen, mühelos vor bigotten Besuchern verstecken ließen.
Der ausschlaggebende war zweifellos die nomadische Lebensweise der Araber - kleine Kunstschätze lassen sich leicht transportieren. So können arabische Künstler als die eigentlichen Schöpfer der illustrierten Bücher gelten. Zwar versahen schon die Römer ihre Kodizes mit Bildern, doch die wurden meist gleich von den Schreibern angefertigt und waren mehr oder minder Beiwerk zum Text, künstlerisch kaum bedeutend und auf keinen Fall den Schöpfungen wirklicher Maler vergleichbar. Erst im Islam wurde das Bild im Buch dem Text gleichwertig, wurde der Buchmaler wichtiger als der Buchschreiber. Das europäische Mittelalter hat diese islamische Sitte begeistert übernommen, und in gewissem Sinn sind auch unsere Illustrierten entfernte Enkelkinder jener Künstler, die zwischen den Seiten wider das Bilderverbot des Koran löckten. Alles in allem aber war der Islam, wie ihn der Prophet verkündete, weniger Religion als Statut, Betriebsverfassungsgesetz für den ersten Großkonzern der Geschichte : Eine bis ins kleinste entwickelte Organisation mit Detailregelungen für sämtliche Geschäftsbereiche, streng nach Rationalität ausgerichtet. Sogar Sozialversicherung und Altersversorgung waren vorgesehen, und das einzig Überirdische an diesem Wunderbau war Allah, der ehemalige Firmengott der Familie und auch der nur als unsichtbarer Präsident des Ganzen. In moderne Sprache übertragen klingt das Programm des Islam erstaunlich ähnlich dem von Großkonzernen: Expansion um jeden Preis, Ausschaltung der Konkurrenz durch rationelle Organisation, Investitionsrücklagen und Dividenden für Anteilseigner aus den Gewinnen. Dass der Islam aus einem religiös ummäntelten Wirtschaftsunternehmen zu einer Weltmacht wurde und später zu einer Weltreligion absank, konnte der Prophet nicht voraussehen und hat es wahrscheinlich nicht einmal gewollt. Doch die Grenzen der Expansion sind nirgendwo festgelegt. Irgendwann wird bei stetigem Wachstum aus einem Konzern zwangsläufig ein Staat. Das Kontor wächst zum Verwaltungsgebäude, und dessen Abteilungen wachsen zu Ministerien aus. Und plötzlich ist die Zone absoluter Wirtschaftsmacht Hoheitsgebiet geworden und Mauthäuschen werden zu Zollämtern. Dann kann auch schon der Stillstand beginnen und neue Konzerne entstehen im Staat. Mohammed hat sich allerdings darüber nie den Kopf zerbrechen müssen.
Auch auf dem Höhepunkt seiner Macht blieb er prophetischer Kaufmann und kontrollierte sein Imperium aus einem kleinen Kontor in Medina. Zur Frühjahrsmesse des Jahres 632 kam der Prophet wieder nach Mekka, und diesmal drängte sich das Volk auf den Gassen. Der Anschluss an den Islam hatte Mekka ein Wirtschaftswunder beschert, wie es in der langen Geschichte Arabiens ohne Beispiel war. Islamische Grosseinkäufer drückten auf dem indischen und abessinischen Rohstoffmarkt die Preise - zum Vorteil der arabischen Verarbeitungsindustrie. Die Exportabteilung war so straff organisiert, dass sie trotz vierzigprozentiger Gewinnerhöhung ihre Europapreise um fast fünfzehn Prozent senken konnte. Dem war natürlich die persische Konkurrenz nicht gewachsen, und innerhalb von zwei Jahren war der Anteil des Islam am Ost-West Handel von bisher einem Drittel auf zwei gewachsen während sich feine Damen in Konstantinopel an dem neuen Modegetränk Mokka berauschten. Der Prophet sah dies mit Wohlgefallen: "Ich habe mein Werk vollendet und euch den Islam gerne gegeben." Fühlte er sich am Ende? Vieles spricht dafür, denn zu Mekka diktierte er seinen Sekretären noch einmal genaue Bedingungen für Vertragsabschlüsse und Regelungen von Streitigkeiten innerhalb der Stämme - noch heute oberste Richtlinien für die Innenpolitik islamischer Staaten. Andererseits weigerte er sich über die Regelung seiner Nachfolge auch nur zu reden. Gefährliche Folge: Viele seiner Anhänger glaubten, der Prophet halte sich für unsterblich, und daher nahmen sie dasselbe an. Der Islam ohne Mohammed schien undenkbar. Doch der Prophet zeigte Verfallserscheinungen. Sein ehedem glänzendes Gedächtnis schien nachzulassen: Bei seiner Rede zur Messeeröffnung vor der Kaaba versprach er sich so oft dass Gläubige meinten der Teufel habe ihn irritiert. Dabei verkündete Mohammed wichtige Dinge. So setzte er das bisher in Arabien berechnete Mondjahr ab und bestimmte statt dessen das römische Sonnenjahr als Kalendergrundlage. Außerdem und das wurde für Mekka fast noch wichtiger bestimmte er genau das Ritual für den Besuch der heiligen Messestadt.
Wie die Speiseregelungen sind auch die Förmlichkeiten des Hadsch, des Pflichtbesuches in Mekka, eine eigenartige Mischung von sinnvollen und abergläubischen Verrichtungen. Die dafür vorgeschriebene Einheitskleidung aus zwei weißen Tüchern ist eine letzte Erinnerung an das schnell vergessene Prinzip, dass alle Menschen vor Gott gleich sind. Das ebenfalls vorgeschriebene Tieropfer bescherte den Viehzüchtern von Mekka eine bis in die Gegenwart anhaltende Dauerkonjunktur. Der siebenmalige Geschwindmarsch zwischen den beiden Hügeln Ssafa und Merwe hingegen hat seinen Ursprung in der legendären Brunnengrabung Abrahams. Christen schien das Ritual des Hadsch so unverständlich, dass sich im Süddeutschen sogar ein Scherzwort daraus entwickelt hat: "hatschen" bedeutet langweiliges sinnloses Durch – die – Gegend - Wandern. Dabei haben gerade die Katholiken Bayerns am wenigsten Recht zu Spott - noch heute gehört es zum Ritual einer christlichen Wallfahrt nach Altötting, auf den Knien um den Altar zu rutschen. Für Muslims bedeutet die Hadsch noch heute den Höhepunkt eines frommen Lebens, und ein Hadschi, also einer der sie überstanden hat, ist ein hochgeachteter Mann. Diese Ehre kommt nicht billig - von allen asiatischen Städten hat Mekka mit Abstand die höchsten Preise, vor allem für Hammel und weiße Tücher. Wer als Mekkaner Fremdenzimmer in seinem Haus halten kann ist ein gemachter Mann. So fürstlich sorgte der Prophet durch himmlischen Tourismus für seine Vaterstadt. Er selbst überstand seine letzte Hadsch nicht gut. Bereits nach seinem Besuch in der Kaaba hatte er über heftige Kopfschmerzen geklagt, und den ganzen Heimweg nach Medina stöhnte er so laut, dass ihn Omar und Ali keine Minute aus den Augen ließen aus Angst, der Prophet könne vor Schmerzen Selbstmord begehen. Als sie das Stadttor von Medina passierten, wussten sie dass sie einen Todkranken nach Hause brachten. Zwei Tage später wollte Mohammed den Friedhof von Medina besuchen, das erste Mal in seinem Leben. Zwei Stunden lang ging er in der kühlen Abenddämmerung kreuz und quer über das Gräberfeld. Meine Zeit ist um, klagte er immer wieder. Dann sah er auf die Gräber nieder und sagte: Ihr die ihr tot seid, habt es besser als die Lebenden. Abu Bekr musste ihn mit Gewalt nach Hause bringen.
Am nächsten Morgen waren die Kopfschmerzen unerträglich geworden. Mohammed lag in seiner Kammer, den Kopf auf Aischas Schoss, am ganzen Körper schweißüberströmt. Noch einmal wollte er die wichtigsten Punkte sein er Lehre diktieren. Da meinte Omar: "Was du verkünden konntest, hast du schon gesagt. Was du noch sagen willst, werden wir nicht gelten lassen, denn es sind Fieberphantasien. Der Prophet hatte hohes Fieber. Die versammelten Ärzte wussten dagegen nur ein brutales Mittel: Jede halbe Stunde wurde der Kranke mit kaltem Wasser übergossen. Am Nachmittag ließ sich Mohammed von Ali und Abbas in die benachbarte Moschee tragen. Er war nur noch ein Schatten seiner selbst, und das Sprechen machte ihm bereits große Schwierigkeiten. Die Gläubigen begannen beim letzten Gebet des Propheten laut zu weinen und folgten ihm später vor sein Haus wo sie Wache hielten. Zwei Wochen noch dauerte des Propheten letzte Krankheit. Mohammed war nur für kurze Augenblicke ansprechbar. Die meiste Zeit lag er in tiefer Bewusstlosigkeit. Die genaue Todesursache ist nicht mehr feststellbar. Wahrscheinlich litt der Prophet an einem Gehirntumor. Mit Sicherheit kam noch eine Lungenentzündung hinzu, höchstwahrscheinlich auch eine Bauchfellentzündung. Denn die letzten hellen Augenblicke des Propheten wurden von qualvollen Schmerzen verdüstert. Während eines Anfalls brach sich Mohammed sämtliche Zähne aus und nicht einmal Opiumpillen aus Persien konnten helfen. Aischa das sonst so launenhafte, verzogene Mädchen pflegte ihn während dieser letzten Tage mit rührender Hingabe. Sie hielt seinen Kopf auf ihrem Schoss und wischte den Schweiß von der Stirn des Propheten. An den Fußenden des Bettes kauerten Ali und Omar. Im Vorraum des Krankenzimmers hatte Abu Bekr sein Kontor aufgeschlagen. Am Sonnabend, den 6. Juni 632, um drei Uhr nachts, erwachte Mohammed noch einmal, das erste Mal seit langer Zeit ohne Schmerzen. "Kommt nicht bald der Morgen? fragte er. Eine Stunde später war er tot. Die Frauen wollten in die traditionelle Totenklage ausbrechen, doch da stürzte Abu Bekr in das Gemach: Mohammeds Tod dürfe erst bekannt werden wenn die Geschäftsübernahme abgeschlossen sei und sämtliche Abteilungsleiter auf ihn vereidigt.
Dann formulierte Abu Bekr des Propheten Todesanzeige: "Gestorben ist zu Medina Gottes Prophet, Mohammed aus Mekka, in seinem fünfundsechzigsten Lebensjahr. Seine Seele ist in Gottes Hand. Gottes Gnade seinen Erben. Dann befahl er, den Leichnam zu waschen und aufzubahren. Noch im Sterbezimmer kam es zu einem Krach zwischen Abu Bekr und Ali. Die Frage, wer von den beiden dem Propheten am nächsten gestanden habe, war auch kaum zu klären. Abu Bekr warf in die Waagschale des Propheten langjährigster Freund und außerdem Schwiegervater zu sein. Dagegen hatte natürlich Ali auch seine Argumente. Schließlich war er des Propheten Schwiegersohn und außerdem noch vorübergehender Bettgenosse. Vor allem aber: Wer hatte sich gemeldet, als Mohammed seinen ersten Wesir suchte? Er, Ali, damals noch Kind, aber als erster von der Sendung des Propheten überzeugt. Und wer hatte für den Propheten sein Leben aufs Spiel gesetzt? Schließlich: Abu Bekr war ebenso alt wie der Prophet. Sollte der Islam in Zukunft von einem Greis diktiert werden oder von einem jungen, tatkräftigen Mann? Ehe sich die beiden darüber noch in die Haare geraten konnten, kam Omar dazu und meldete Schlimmes: In aller Öffentlichkeit stritten bereits die Bürger von Medina über die Frage, wer nun die Geschäftsführung des Islam übernehmen solle. Und dabei sei weder Abu Bekrs noch Alis Name gefallen, sondern bislang nur der von Saad, dem Börsenchef von Medina. Auch Saad hatte seine Argumente: Wodurch war denn Mohammed an die Macht gekommen, wenn nicht durch die Hilfsgenossen aus Medina? Mit seiner aus Mekka zugewanderten Clique hätte er das doch nie geschafft, also . . . Im Eilschritt begaben sich Abu Bekr, Ali und Omar in die Karawanserei, wo Medinas Kaufmannschaft in Vollversammlung tagte. Sehr bald erkannten die Mekkaner, dass die Stimmung hier nicht günstig für sie war. Da meldete sich Omar zu Wort und hielt eine lange Rede. Ergreifend schilderte er die letzten Stunden des Propheten, zählte die gesamte Geschichte des Islam, und als er gerade bei der Kindheit Mohammeds angelangt war, sah er zum Himmel auf: "Seht, die Sonne ist untergegangen!
Es schickt sich doch nicht, im Dunkeln über unser aller brennendste Sorge nachzudenken. Und das am Todestag des Propheten!" Das sahen auch die Bürger von Medina ein und vertagten sich auf den nächsten Mittag. Der brachte natürlich auch nichts Neues, davon abgesehen, dass nun auch der Mekkaner Obeida zur Debatte stand, weil Mohammed von ihm einmal gesagt haben soll: Er ist der Aufseher dieses Volkes. Omar meinte, das sei ein sehr gewichtiges Argument. Auch Aischa meldete sich zu Wort. Sie als Lieblingsgattin des Propheten könne bezeugen, Mohammed selbst habe Abu Bekr zu seinem Nachfolger bestimmt, mit dem letzten Hauch seines Atems. Doch die Medinenser wie auch Ali hielten das Mädchen für befangen - Abu Bekr war schließlich Aischas Vater. Als die Sonne sank, war wiederum nichts entschieden. Als Kandidaten für die Nachfolge Mohammeds standen zur Disposition: Abu Bekr, Ali und Obeida, ferner Saad und hinter diesem geschlossen die Bürger von Medina. Omar meinte zu Saad, man müsse sich doch gütlich einigen können, und lud ihn zum Abendessen in sein Haus ein, als sich die Versammlung auf den nächsten Mittag vertagte. Während dieser ganzen Zeit lag die Leiche des Propheten noch immer im Sterbezimmer. Dies war ein grober Verstoß gegen einen der letzten Befehle Mohammeds der besagte, verstorbene Muslims seien spätestens am Tag nach ihrem Tod zu bestatten. Der Prophet dürfte gewusst haben, warum, und am nächsten Mittag wusste es auch Omar. Kurz vor Beginn der Generalversammlung schickte er einen Laufburschen zu Ali: Der Prophet stänke bereits entsetzlich. Ali, der allzeit Getreue, ging daraufhin mit seinen Leuten nicht in die Karawanserei, sondern in das Haus des Propheten, Millionen Fliegen schwirrten bereits durch die Räume, und die Leiche des Propheten sah grauenerregend aus. Der stämmige Körper war unförmig aufgedunsen und roch so übel, dass Ali und seine zehn Freunde ihre Burnusse nass machen und vor das Gesicht binden mussten, um es im Haus aushalten zu können. An ein ordentliches Begräbnis auf dem Friedhof war unter diesen Umständen nicht zu denken. Gleich im Sterbezimmer wurde der gestampfte Lehmboden aufgehackt, eine tiefe Grube ausgehoben,
das Bett mit der Leiche hinein gesenkt und anschließend die Erde wieder fest getreten. Dann verbrannte Ali einige Körbe Stroh, um die Fliegen zu verjagen, und sprach das Totengebet. All dies dauerte natürlich seine Zeit, und damit hatte Omar gerechnet. Er hatte auch dafür gesorgt, dass diese Verhandlung einen anderen Verlauf nehmen musste als jene an den beiden Tagen zuvor. Am Anfang meldete sich Habab aus Medina zum Wort: Am sinnvollsten schiene ihm ein Kompromiss, denn ein Mann allein könne den Propheten ohnedies nicht ersetzen. Daher schlage er eine kollektive Geschäftsführung vor, und zwar einen Mekkaner und außerdem Saad. Omar protestierte: "Zwei Klingen passen nicht in eine Scheide." Dann fragte er: "Überhaupt - wo ist denn Saad geblieben? Ich habe ihn noch gar nicht gesehen." Die Genossen von Medina erstarrten - tatsächlich, Saad fehlte. Das letzte Mal war er gesehen worden, als er mit Omar davon ging. "Hast du ihn erschlagen?" fragten sie. Gott hat ihn getötet sagte Omar, denn er war der Genosse des Bösen und der Unruhe. Ehe noch darüber Unruhe aufkommen konnte schlugen die versammelten Mekkaner ihre Mäntel zurück, und siehe da, sie waren zu dieser friedlichen Sitzung bis an die Zähne bewaffnet gekommen. Als erster fand Seid ben Sabit seine Sprache wieder. Der Prophet war selbst ein Zugewanderter, meinte Medinas zweiter Börsenchef in das entsetzte Schweigen. Also werden wir uns in Gottes Namen damit abfinden müssen dass sein Nachfolger wieder ein Zugewanderter ist. "Gott wird dir danken," sagte Abu Bekr und ergriff die Hände Omars und Obeidas. Jeder von euch beiden ist würdig. Da verneigte sich Omar und sagte: "Ich aber huldige dir denn du bist der Altere, dem Propheten enger Befreundete. Wer von uns kann sagen: Ich habe mit dem Propheten auf dessen Flucht in ein und derselben Höhle übernachtet? Das sah Abu Bekr ein, und sogleich erteilte er Omar seinen ersten Befehl: "Geh hin zu Alis Haus und überzeuge auch ihn. Vor allem aber: Entwaffne Alis Anhänger." Während die übrigen Versammelten nun der Reihe nach Abu Bekr als dem alleinigen Nachfolger Mohammeds huldigten, zog Omar mit zwölf aus-gesuchten Schlägern vor Alis Haus.
Natürlich wusste Omar, dass er Ali gar nicht antreffen würde, und er hatte auch gar nicht vor, sich in längere Diskussionen einzulassen. Jeder seiner Leute bekam eine brennende Fackel in die Hand, und nachdem sie das Haus umstellt hatten, hielt Omar seine Fackel an das Haustor. Als es schon bedenklich qualmte, klopfte Omar an. Fatima war allein zu Hause und überschaute die Situation sofort. "Bist du so wahnsinnig, unser Haus anzünden zu wollen?" schrie sie. "Natürlich," lachte Omar. "Es sei denn, du gehst sofort in die Karawanserei und huldigst Abu Bekr." Fatima nahm sich nicht einmal mehr die Zeit, einen Schleier überzuwerfen. Wie sie war, rannte sie los und warf sich Abu Bekr zu Füssen. In diesem Augenblick kam auch Ali in die Versammlung. "Hast du denn vergessen, dass heute Wichtiges auf der Tagesordnung stand?" spottete Omar. "Warum hast du dir mit dem Begräbnis deines Schwiegervaters soviel Zeit gelassen? Nun ist die Versammlung bereits aufgehoben." Ali sagte kein weiteres Wort. Er nahm Fatima an der Hand und ging in sein Haus, das er während der nächsten sechs Wochen kein einziges Mal verließ. Was sich in jenen drei Tagen zu Medina ereignet hatte, war allerdings nur ein bescheidenes Kammerspiel im Vergleich zu dem Theater das nun in ganz Arabien begann. So schnell der Prophet die zahlreichen einst konkurrierenden Stämme im Islam vereinigt hatte, so schnell drohte die Firma auch wieder auseinander zubrechen und die einzigen Nachrichten die Abu Bekr während der nächsten Wochen erhielt waren Kündigungsschreiben aus allen Teilen Arabiens. Vielen Stämmen passte die ganze Richtung nicht. Gut als Mitglieder der Gesamtorganisation hatten sie eine gewisse Existenzsicherheit. Der Islam garantierte die Abnahme ihrer Produkte und den Vertrieb. Dafür aber war der innerarabische Zoll weggefallen und das Niederlagsrecht in den Karawansereien, und das machte doch eine Menge Geld aus. Zwölf Stämme beschlossen daher wieder zum Status quo zurückzukehren:
Sie stellten ihre alten Firmengötter wieder auf und verkündigten erneut die absolute Selbständigkeit ihrer Handelsunternehmen. Eine andere Quelle des Ärgernisses war das vom Propheten eingeführte Steuersystem. Uns heute Lebenden und. vom Staat ständig zur Kasse Gebetenen mögen die Steuerzustände des frühen Islam paradiesisch erscheinen: Nur zehn Prozent Umsatzsteuer waren zu bezahlen, in einen gemeinsamen Fonds zur Unterstützung der Armen und Waisen. Doch dieser Fonds hatte einen Schönheitsfehler. Bislang hatten Arme und Waisen daraus keinen einzigen Dinar zu sehen bekommen. Er diente vielmehr ausschließlich zur Besoldung der damit befassten Verwaltung und die war dementsprechend reich und umfangreich geworden. Daher meinten elf weitere Stämme, funktionierende Großfamilien seien eine bessere Sozialversorgung, und traten in Steuerstreik. Vor allem aber: Zwei weitere Wüstensöhne waren nach reiflichen Überlegungen zu der Überzeugung gelangt, was der Prophet gekonnt habe, könnten sie auch. So ernannten sie sich selbst zu Propheten und fanden auch viele Anhänger. Abu Bekr wehrte sich lange und standhaft, auch nur zur Kenntnis zu nehmen, dass der Islam in voller Auflösung begriffen war. Er hatte ja auch Wichtiges zu tun: Während der ganzen letzten Krankheit des Propheten musste er seine eigenen Geschäfte sträflich vernachlässigen, obwohl zu dieser Zeit zwei kleinere Karawanen eingetroffen waren und ihre Waren im Hof seines Privathauses abgestellt hatten. Eine Ladung bestand aus frischen Feigen, Herkunftsort Jerusalem. Sie hatten beinahe zwei Wochen in der Sonne gestanden. An einen Weitertransport nach Mekka war nicht mehr zu denken also beschloss Abu Bekr, sie als Sonderangebot auf den Basar von Medina zu bringen. Omar glaubte zu träumen als er die Bescherung sah: "Ganz Arabien befindet sich in Aufruhr und du als Kalif, als Nachfolger des Propheten sitzt da und versuchst, den Leuten faule Feigen unterzujubeln?!" "Wovon soll ich denn leben?" meinte Abu Bekr. Schleunigst trommelte Omar den übrigen Vorstand zusammen. Nach kurzer Beratung wurde ein festes Jahresgehalt für den Kalifen festgesetzt: zweitausend Silberstücke, nach heutiger Kaufkraft ungefähr hunderttausend Mark. Mehr hatte Abu Bekr nicht gewollt.
Er schlug ein, ließ seinen Stand stehen, wo er war, und begab sich in sein Landhaus bei Sendsch, eine Meile außerhalb von Medina. Von dort ritt er künftig jeden Tag fünfmal in die Stadt, um in der Moschee beim Gebet vorzustehen. Nur am Freitag, dem Feiertag, blieb er zu Hause, ließ sich maniküren und rasieren und sein schütteres Haar mit Henna rot färben. Abu Bekr war auch nicht sonderlich entscheidungsfreudig. Jeden Befehl musste ihm Omar erst in stundenlangen Diskussionen abringen, und dazu gab es nun wirklich keine Zeit. "Du musst Armeen gegen die Aufrührer schicken," beschwor Omar den Alten. "Ja, natürlich. Aber kostet das nicht Geld?" Omar explodierte: "Das Geld ist schon vorhanden, aus den Investitionsrücklagen. Was fehlt ist ein Feldherr." Abu Bekr rang mit sich. "Wenn ich ihn nicht bezahlen muss, will ich gern einen Feldherrn ernennen. Aber alles übrige musst du erledigen." " Was blieb Omar anderes übrig?" Er übernahm also das Handelsgericht und die Geschäftsführung des Islam, und Abu Bekr hatte von nun an Zeit sein Steckenpferd zu reiten. Gemeinsam mit seinem Sekretär Osman sammelte Abu Bekr sämtliche Aussprüche die der Prophet je getan haben soll. Natürlich hatte auch der Prophet sein Sekretariat gehabt, doch das hatte sich ausschließlich mit Geschäftskorrespondenz und Buchhaltung befasst. Des Propheten religiöse Geschäfte waren nur von Außenstehenden aufgezeichnet worden auf Papierfetzen, Lederflicken und Schiefertafeln, manche auch nur in Tonscherben eingekratzt oder an Hauswände gekritzelt vor denen der Prophet gesprochen hatte. Aus diesen zahllosen Bruchstücken erstellte Abu Bekr eine erste Fassung des Koran doch er konnte sich nicht entschließen sie auch zu veröffentlichen. Nur einen einzigen Entschluss fasste Abu Bekr, ohne zu zögern. Zum Ober-kommandierenden der islamischen Truppen ernannte er Chalid Ben Walid. Und ganz Medina war entsetzt. In der Moschee wurde Abu Bekr von Gläubigen bedrängt: Ob er denn von Sinnen sei, Chalid Ben Walid auf die Welt loszulassen? Abu Bekr gab sich erstaunt:
Kürzlich habt ihr mich bedrängt und gesagt: "Hier hilft nur noch brutale Gewalt. Was habt ihr nun gegen Chalid? Einen Schlimmeren fand ich nicht." In der Tat. Nur fünfmal hatte Chalid Ben Walid auf dem Schlachtfeld gestanden, doch sein Name war in ganz Arabien Symbol für Grausamkeit. Als er einmal vierundfünfzig Frauen die Kehlen durchschneiden ließ, erwog selbst Mohammed, in Sachen Brutalität gewiss nicht zimperlich, Chalid Ben Walid ruhmlos aus dem Islam auszustoßen. Dann aber erschien ihm der wüste Haudegen unentbehrlich und Chalid kam mit einem strengen Tadel davon. Doch auch abseits vom Schlachtfeld hatte er schlechten Ruf erworben als der größte Hurentreiber Asiens. Schon auf seinem ersten Feldzug bewies sich Chalid. Nachdem er die ersten vier abtrünnigen Karawansereien dem Erdboden gleichgemacht hatte, erschollen an allen anderen Orten sobald seine Armee nur in Sicht kam, schon laute Gebetsrufe. Nein, nein bedauerten die einzelnen Emire, es könne sich nur um einen bedauerlichen Irrtum handeln sie hätten nie und nimmer den Islam aufgekündigt. Und sogar die Steuern seien schon bereitgestellt. Es sei doch ohnedies alles in schönster Ordnung. Auf diese Weise drangen Chalid und seine Truppen ziemlich schnell bis zum Stamm Jerbuu vor, der dem Islam treu geblieben war aber Abgaben verweigerte, deren Zweckentfremdung bekannt war. Der siebzigjährige Emir Malik vertrat seinen Standpunkt auch Chalid gegenüber. Das war gefährlich. Außerdem aber hatte er eine hübsche Frau, und das war tödlich. Chalid gefiel die knusprige Zwanzigjährige und er gefiel auch ihr. Zunächst machte Chalid mit dem Alten kurzen Prozess: Ohne Förmlichkeiten verurteilte er ihn zum Tode und ließ ihn an einen Pfahl in der Mitte des Zeltplatzes binden. Dann holte er dessen Gattin aus seinem Zelt. Die Dame hatte gerade ihre Tage, doch das war weder für sie noch für Chalid ein Hinderungsgrund allen Versammelten auf dem Zeltplatz zu zeigen, wie sehr sie einander liebten. Nach einer Bluttat kommt die nächste, rief Chalid anschließend und gestattete seinen Soldaten, die bislang nur als Publikum fungiert hatten, ein Wettschiessen auf den Emir. Dessen letzte Worte waren: Heiratet nie eine junge Frau. So etwas bringt auch den stärksten Mann um. In Medina hatte dieser Skandal noch ein Nachspiel. Omar war der Meinung, einen derart frechen Verstoß gegen alle möglichen Gesetze des Islam könne nicht einmal Abu Bekr hinnehmen.
Um wenigstens einem Paragraphen Genüge zu tun, solle man Chalid und die Frau als erwiesene Ehebrecher steinigen. "Bei der Frau habe ich nichts dagegen," entschied Abu Bekr. "Doch Chalid ist sicher unschuldig. Ich bin überzeugt, er hat ohne böse Absicht gehandelt." "Dann musst du ihn wenigstens absetzen," beharrte Omar. Abu Bekr sah ihn groß an und dann in den Himmel: "Willst du wirklich, dass ich das Schwert Gottes in die Scheide stecke?" So endete das erste Kriegsverbrecher - Verfahren in der Geschichte des Islam wie viele spätere: Chalid wurde befördert. Und weil das "Schwert Gottes" auf dem Schlachtfeld so schrecklich hauste, durfte auch kein Gläubiger dagegen protestieren, dass es häufig in fremden Scheiden steckte. Als Feldherr war Chalid bald unentbehrlich. Nachdem er in kurzer Zeit ganz Arabien "der rechten Lehre zurückgewonnen" hatte, marschierte er gegen den alten Erbfeind des Propheten, Persien. Warum hatten auch die Perser versucht, aus dem vorübergehenden Chaos einige Brocken für sich zu holen? Zur Strafe dafür dass sie abtrünnige Stamme unterstützt hatten, nahm ihnen nun Chalid die Euphrat - Mündung weg und damit den Seeweg nach Indien. Kampflos gaben die Perser dieses wichtige Handelsgebiet natürlich nicht ab. Schah Chosroe hatte seine Elitetruppen unter seinem allerbesten Feldherrn aufgeboten. Doch Chalid wurde mit dieser beinahe doppelten Übermacht so schnell fertig, dass die Perser auf der Flucht sogar die Kriegskasse verloren. Ein Fünftel des Schatzes wurde nach Medina geschickt als "Beuteanteil des Propheten", und dieses Fünftel war nach heutiger Kaufkraft fünfzig Millionen Mark wert. Für die eroberten Gebiete wurde ein neues Steuersystem erfunden. Wer kein Muslim war musste ab sofort die Dschisdscha bezahlen, eine dreißigprozentige Kopf- und Grundsteuer und diese für damalige Verhältnisse ungeheuerliche Belastung sorgte dafür, dass Allah sehr schnell neue Jünger bekam. Überhaupt: in der Bilanz des Islam schlug Chalid Ben Walid ruhmvoll zu Buche. Getreulich sandte er jeweils das "Prophetenfünftel" nach Medina, und bereits im März 634 konnte Abu Bekr bei einem Kassensturz Goldstücke im Wert von einer halben Milliarde zählen. Mehr hatte damals kein Staat in der Kasse.
Dann eroberte Chalid auch noch Schawernak, den berühmtesten Palast des Nahen Osten. Fünfzig Jahre zuvor hatte ihn der größte Baumeister Asiens, Senawar, für den persischen Schah errichtet. Schawernak wurde ein Weltwunder, und von der höchsten Zinne des Palastes aus zeigte Senawar seinem Bauherrn die Pracht. "Willst du noch schönere Paläste bauen?" fragte der Schah. "Ich hoffe," sagte der Architekt. "Ich nicht," meinte der Schah und stürzte ihn in den Abgrund. Diese Geschichte sprach sich herum auch heute noch wird in der deutschen Sprache ein böser Streich Schabernack genannt. Als Chalid Schawernak eroberte, verhielt er sich entsprechend. Vom Festungskommandanten ließ er sich die sprichwörtliche Zinne zeigen. "Und von hier herunter soll ein Sprung tödlich sein? fragte er. "Ich weiß es nicht," sagte der Kommandant. "Dann versuchs mal," meinte Chalid, und nicht nur der Kommandant, sondern auch alle Offiziere wurden in den Abgrund gestürzt. Anschließend feierte Chalid nach alter Gewohnheit mit den jungen Witwen eine ausgiebige Siegesorgie. Nun hätte ihn eigentlich niemand mehr daran hindern können, gleich ganz Persien zu erobern, doch Abu Bekr in Medina überlegte sich's anders. Statt gegen den alten Erbfeind ließ er Chalid nun gegen die Erbfreunde des Propheten marschieren und eröffnete in Syrien eine neue Front: gegen das Römische Reich und den Kaiser in Konstantinopel. Der neue Marschbefehl hieß: nach Damaskus. Dass Abu Bekr ausgerechnet dem wichtigsten Handelspartner des Islam den Krieg erklärte, schien vielen Zeitgenossen der nackte Wahnsinn. Seltsamerweise aber nahmen die Geschäfte dabei keinen Schaden. Während Damaskus vom Islam belagert wurde und eine römische Armee nach der anderen vernichtende Niederlagen einstecken musste, tranken die Damen in Konstantinopel weiter arabischen Kaffee. Nur etwas teurer war der Genuss geworden: Die schwarzen Bohnen kamen nun aus Alexandrien und waren außerdem vom Kaiser mit einer neuen Steuer belegt worden, einem Notgroschen für den Kampf gegen den Islam. Chalid hingegen konnte aus dem vollen schöpfen. Bei seiner dritten Schlacht in Syrien eroberte er auch die Kriegskasse.
So üppig war die Beute, dass Chalid auch seinen Truppen etwas abgab. "Wer mit dem Propheten verwandt ist, trete vor. Er soll das Doppelte der Beute erhalten," verkündete er beim Appell. Da meldeten sich über tausend Soldaten. Die Hälfte von ihnen musste gar nicht mehr ins Glied zurücktreten. "Geht nach Hause genießt euer Geld und betet, dass Allah auch weiter unseren Waffen den Sieg verleiht," sagte Chalid. Das sind die letzten Worte, die von ihm überliefert sind, denn zum Zeitpunkt dieser noblen Geste war er bereits gar nicht mehr Oberkommandierender. Schon kurz vor der Schlacht hatte er aus Medina schlimme Nachrichten erhalten: Sein Gönner war gestorben, Omar zum neuen Kalifen ernannt und er selbst fristlos entlassen. Für einen kurzen Augenblick erwog Chalid, mit seinen Truppen einfach nach Medina zu marschieren und mit Omar ein ernstes Wort zu reden, doch dann ließ er es bleiben. Er war durch seine Feldzüge zu einem der reichsten Männer der Welt geworden, Herr eines Palastes und eines Harems mit siebenhundert Sklavinnen - sollte er das alles nur aus Ehrgeiz aufs Spiel setzen? So nahm Chalid seinen Abschied und wir hören von ihm nur noch, dass er in hohem Alter auf einer sehr jungen Sklavin an Herzschlag verschied. Über Abu Bekrs letzte Tage liegen verschiedene Nachrichten vor. Manche Historiker meinen, er sei an Typhus gestorben, andere, an Gift eingeflösst von persischen oder römischen Agenten. Fest steht nur: Er starb nach zweiwöchigem Krankenlager am 23. August 634, siebenundsechzig Jahre alt. Bei der Beurteilung seines Wirkens gehen die Meinungen wieder auseinander. Abu Bekr war eine schillernde Persönlichkeit, wie geschaffen zu einer Zielscheibe von Spott. Die Eitelkeit, mit der sich der alte Herr schminken und seine Haare jugendlich färben ließ, wurde ebenso sprichwörtlich wie seine Scheu vor Entscheidungen. Eine Sklavin muss ihm die Augen schwarz schminken und Omar in den Hintern treten, ehe was geschieht, wurde in Medina kolportiert und: Wenn er Goldstücke sieht, schließt er seine Augen gern vor den Geboten Allahs. Andererseits: Dass der Islam seinen Propheten überlebte ist vor allem Abu Bekrs Verdienst, und dabei bediente er sich meisterlich gerade jener Eigenschaften, die seinen Zeitgenossen so lächerlich erschienen.
Seine scheinbare Entschlusslosigkeit, seine angebliche Naivität brachten seine Verhandlungspartner zur Verzweiflung und zermürbten sie schließlich. Wer mit Abu Bekr zu tun hatte, musste diesen eitlen, alten Mann einfach unterschätzen, und das war Abu Bekrs Kapital. Seine Verträge waren Meisterwerke des Kleingedruckten, und die darin von seinen Gegnern übersehenen Paragraphen ließ er mit Armeen durchsetzen. Abu Bekr dürfte einer jener Mittelmäßigen gewesen sein, die aufgrund ihres Erfolges zu den Genies gerechnet werden müssen. Außer seinen menschlichen Schwächen wurde keine hervorragende Eigenschaft an ihm bekannt, und doch hinterließ er den Islam stärker und mächtiger, als er zur Zeit des Propheten je war. Er war der rechte Mann zur rechten Zeit, und das ist sehr viel. Nach den ersten Erfolgen Chalids trugen ihm Schmeichler den Titel "Held" an. Der alte Herr aber schüttelte den Kopf: "Ich bin nur der Buchhalter des Propheten." Besser hätte ihn niemand charakterisieren können. Zu Mohammeds Lebzeiten hatte er die Geschäfte des Propheten organisiert und pedantisch darauf geachtet, dass die Kasse stimmte. Nichts anderes tat er als Kalif, und damit machte er den Islam aus einem Konzern zum Staat: Er schuf das Amt der Zentralkanzlei, erfand eine mustergültige Finanzverwaltung und installierte ein oberstes Gericht unter dem Vorsitz Omars. Im Privatleben fühlte er sich als Dichter. In seinem Harem, zwischen vier Damen soll er sehr viel Lyrik abgesondert haben. Über deren Qualität ist kein Urteil möglich, denn nur ein kleines Gedicht blieb erhalten - ein harmloser Gemeinplatz, garniert mit rührender Eitelkeit: "Der Tod ist nur ein Tor, durch das die Menschen gehen. O möge dies Gedicht nie diese Pforte sehen." Für Abu Bekr spricht, dass dieser Vers tatsächlich unsterblich wurde.
|
|
Krach im Hause des Propheten
|
|
|
Noch heute ist Omar in Arabien allgegenwärtig, sprichwörtlich wie sonst nur noch der Bart des Propheten. Ein Bettler kommt "zerlumpt wie Omar" daher, ein Hüne "groß wie Omar" und ein Krüppel "bucklig wie Omar". . Urteilt ein Richter "streng wie Omar", muss der Gauner "Omars Peitsche" fürchten. Doch der Richter kann auch "gnädig wie Omar" sein Omar hat alle möglichen Eigenschaften und da schließt eine keineswegs die andere aus. Ob nun ein Gläubiger bescheiden oder maßlos ist, liebenswürdig oder arrogant, knauserig oder großzügig, engstirnig oder tolerant: All das wird er stets "wie Omar" sein der Widersprüchlichste unter den Weggenossen des Propheten. Mehr als siebenhundert Bücher wurden allein in arabischer Sprache über Omar geschrieben und gerade deshalb ist es schwierig, Genaues über Omar zu erfahren. Denn ob Freund oder Feind sein Bild zu zeichnen versuchten, stets geriet es überlebensgroß. Ein Hüne war der historische Omar tatsächlich einsfünfundachtzig groß und damit überragte er seine Zeitgenossen um mehr als Haupteslänge. Glücklich schien er damit allerdings nicht zu sein. Bereits als Junge hatte er sich einen schweren Haltungsfehler angewöhnt und Gassenjungen spotteten über den erwachsenen Omar: Sein Buckel streift die Wolken und sein Kinn die Erde. Omar hörte so etwas nicht gern - kaum war er Kalif ließ er die Verbreiter solcher Scherze zu Tode prügeln. Mit Todesstrafe musste seltsamer weise auch rechnen, wer die Herkunft von Omars Namen zu ergründen versuchte. Das führte natürlich zu den wildesten Spekulationen, auch über sein Elternhaus, obwohl gerade das über jeden Zweifel erhaben war. Sein Vater Chattab gehörte zu den Honoratioren von Mekka und war auch ein entfernter Onkel Mohammeds. Ihm gehörte ein angesehenes, altes Handelshaus das vor allem Korallenschmuck nach Griechenland exportierte. Aus Griechenland importierte Chattab dafür den Namen für seinen zweiten Sohn: Homer. Omar genierte sich, nach dem Vater der Dichtkunst benannt zu sein denn er hatte ein gebrochenes Verhältnis zu den schönen Künsten: Kultur ist Zeitverschwendung sagte er einmal und wir können sicher sein, dass er sein Leben lang keinen einzigen Vers seines Namenspatrons las.
Omar hatte Wichtigeres zu tun. Als er zwanzig war, stellte ihn sein Vater auf eigene Beine und überließ ihm ein Karawanenunternehmen, das Seide und Korallen vom Indischen Ozean nach Mekka transportierte. Das Geschäft florierte, doch Omar fühlte sich damit keinesfalls ausgelastet. Mit fünfundzwanzig schloss er sich Mohammed an, das heißt, er brachte sein Unternehmen in die Firma des Propheten ein und befasste sich von nun ab nur noch mit seinen eigentlichen Interessen: Machtfragen im allgemeinen und besonderen. Omar war der Machtmensch par excellence und ohne ihn hätte Mohammed höchstwahrscheinlich als verlachter Spinner geendet. Hinter allen politischen Schachzügen des Propheten stand Omar, und schon lange vor seiner tatsächlichen Machtübernahme galt er als die graue Eminenz des Islam. Er war ein Fanatiker der Macht. An das Leben hatte er nur einen einzigen Anspruch: dass stets sein Wille geschehe, und dazu war ihm jedes Mittel recht. Nur so erklären sich die zahllosen Widersprüche in seinem Leben. Die meisten entspringen jenem Zynismus, den wir heute Realpolitik nennen. Der Zweck heiligte jedes Mittel. Dass sich Omar für den Islam einsetzte, machte den Islam groß. Doch auch ohne Islam wäre Omar zweifellos in die Geschichtsbücher eingegangen. In diesem Punkt ähnelt er Bismarck, der kurz vor seinem Tode sagte: Und wenn ich in bayrischen Diensten groß geworden wäre statt in preußischen hätte es eben ein Kaiserreich Bayern gegeben. Anders aber als der fress- und trinklustige Eiserne Kanzler gab sich Omar stets demonstrativ bescheiden. Seine sechs Frauen und seine Kinder litten darunter. Da kam Omar einmal zu seiner Tochter auf Besuch. Die hatte gerade Mittagessen gekocht, einen Topf Gemüse und eine Schale Öl. Omar trommelte sämtliche Nachbarn zusammen: Sei das nicht ungeheuerliche Verschwendung zum Gemüse auch noch Öl?! Und gab seiner Tochter vor versammelter Gemeinde einige Ohr feigen. Seine Kleidung war ein Meisterstück gekonnter Selbststilisierung: ein total zerfetzter Kaftan, den seine Frauen immer wieder kunstvoll stopfen mussten. So unverschämt bescheiden wagte kein Machthaber der Weltgeschichte wieder aufzutreten. Omar war ein Meister der PR. Er wusste dass Volkstümlichkeit aus einer Fülle kleiner Eigenschaften besteht die sich überall weiter tratschen lassen, und er ließ keine Gelegenheit aus, für Anekdoten zu sorgen.
Da rannte einmal ein Kamel aus der Staatskoppel davon, und prompt rannte Omar der Kalif, hinterher. Ali, der das Theater mit ansah, konnte sich nicht verkneifen zu fragen: "Willst du damit schon wieder ein nachahmenswertes Beispiel für deine Nachfolger liefern?" Omar seufzte: "Ach, Ali! Wenn auch nur ein Kalb an den Ufern des Euphrat verloren geht - glaubst du nicht, dass mich Allah eines Tages danach fragen wird?" Alis Antwort ist leider nicht überliefert dahingegen, dass Omar gerne über die Strassen ging, als würde er was suchen. Sobald sich dann genügend Publikum versammelt hatte, hob der Kalif einen Strohhalm auf und klagte in lautem Selbstgespräch: O wäre ich doch dieser Halm. O wäre ich nur nicht erschaffen worden. Und so etwas verfehlte natürlich nie seine Wirkung. Stets gab sich Omar als Moralist und auch da war er gründlicher als sämtliche Kollegen dieser zweifelhaften Zunft. Den bekanntesten Weiberhelden von Medina ließ er die Köpfe scheren und stellte sie so an den Pranger. Doch geschoren gefielen sie den Damen nur noch besser. Daraufhin verbannte Omar sämtliche Gigolos aus der Stadt. Das war noch milde: Seinen eigenen Sohn ließ Omar zu Tode prügeln, nur weil der angeblich an einem Glas Wein genippt hatte. Überhaupt: Einige Charakterzüge Omars lassen sich nur als Sadismus bezeichnen. Er führte die Prügelstrafe ein und vollzog sie ab und zu auch selbst. Er baute die ersten Gefängnisse Arabiens - zuvor war als strengste Haftstrafe ausschließlich der Hausarrest bekannt. Und er sorgte dafür, dass Sie auch gefüllt wurden: Auf Spottverse beispielsweise stand lebenslänglich. Omar war Mitte der Vierzig, als er Kalif wurde, und schon lange davor stand außer Zweifel, dass er es würde. Abu Bekr war noch kerngesund, als Omar schon ankündigte, beim Tode des Kalifen werde keinesfalls mehr so ein. Chaos entstehen wie beim Tod des Propheten. Jeder in Medina wusste, wie das gemeint war. Von Mitbestimmung oder Wahl des Propheten- Nachfolgers war hinfort nicht mehr die Rede, und sogar Ali hielt sich daran.
Seine Position War ohnedies geschwächt: Fatima war gestorben, die energischste Tochter des Propheten ein halbes Jahr nachdem Omar ihr Haus anzünden wollte. Und Omar als Oberster Richter des Islam erklärte sofort, von nun an bestünde zwischen Ali und . Verwandtschaft mehr - dabei dem Haus des Propheten keinerlei war Ali Mohammeds engster Cousin. Die Machtübernahme verlief dementsprechend glatt. Omar zeigte ein Testament Abu Bekrs, worin er zum Nachfolger bestimmt war, nahm den Titel Kalif an und noch einen völlig neuen: Emirol-Muminin, Fürst der Rechtgläubigen. Das war sein Programm. Der Islam sollte aus dem Konzern, der unter religiöser Schutzmarke laufenden Interessengemeinschaft, endgültig zum Staat mit hierarchischem Aufbau werden. Einige alte Kampfgenossen meinten, das könne der Prophet denn doch nicht gewollt haben, und über dieses neue Programm müsse zumindest einmal diskutiert werden. Da zeigte ihnen Omar sein neues Staatssiegel, und darauf stand: "Reden soll der Tod." Es gab keine weiteren Diskussionen, und in der Folgezeit bestätigte Omar durch immer neue Erfolgsmeldungen, dass seine Richtung stimme. Bereits drei Wochen Dach seiner Machtübernahme ließ er die Bürger von Medina zum Dankgebet in die Moschee rufen: Damaskus war gefallen. Omar wurde ausgiebig als Sieger gefeiert, doch schuld war er daran nicht. Schon bei Abu Bekrs Tod war die Lage der Stadt aussichtslos gewesen. Und auch dies lag weniger am strategischen Geschick der islamischen Truppen als an der totalen Unfähigkeit ihrer Ost römischen Gegner. Damaskus ist zehn Königreiche wert, sagte ein altes Sprichwort, und diese Stadt war seit undenklichen Zeiten der wichtigste Umschlagplatz des Nahen Osten. Hier wickelten Römer, Perser, Araber und Juden ungestört ihre Geschäfte ab, auch wenn sich anderswo gerade Römer und Perser oder Perser und Araber in den Haaren lagen. Offiziell gehörte Damaskus zum Ost römischen Reich, Kronkolonie des Kaisers in Konstantinopel, in Wahrheit aber war die Stadt internationales Territorium. Die Stadtväter von Damaskus ließen sich von ihrem Kaiser nichts sagen, und der hütete sich auch, sich mit ihnen anzulegen. Schließlich kamen zwei Drittel des Wohlstands von Konstantinopel aus Damaskus, und hätte er versucht, dessen Handelsherren straffer an die Kandare zu legen, wäre dabei nur viel zerstört worden, aber nichts gewonnen.
So war Damaskus die einzige Stadt des Römischen Reichs, in der nicht einmal eine Garnison lag. Als die Truppen des Islam in Syrien einfielen, waren nur zweitausend Mann römischer Truppen in ganz Syrien stationiert. Schnell wurden aus Konstantinopel sechzig Galeeren mit fast dreißigtausend Mann Truppen los geschickt, um Syrien zu halten. Doch zum Oberkommandierenden bestimmte der Kaiser einen schwarzlockigen Jüngling von dem nicht mehr bekannt war, als dass er die Nacht zuvor mit seinem Kaiser verbracht hatte, im großen Badezimmer des Palastes. Mit einer Wasserschlacht wollte dieser Jüngling auch die islamischen Truppen schlagen. Kaum hatte er die großartigen Bewässerungsanlagen Syriens gesehen, ließ er die Felder unter Wasser setzen. Nur einen schmalen Landstreifen hielt er trocken, um mit seinen Truppen nach Damaskus zu kommen. "Nun sollen die Muslims nach Damaskus schwimmen" sagte er, und mehr wird von ihm nicht berichtet. Denn die Muslims kamen aus der falschen Richtung trieben seine Armee über den Landstreifen in die frisch entstandenen Sümpfe und damit war die römische Oberhoheit in Syrien beendet. Die Stadtväter von Damaskus kränkten sich nicht sonderlich. Sie waren nüchterne Geschäftsleute und wussten, dass sie nun mit Konstantinopel nicht mehr zu rechnen hatten. Um ihre angesammelten Schätze nicht der Gefahr einer Plünderung auszusetzen, begannen sie sofort mit Übergabeverhandlungen. Christliche Chronisten haben sich stets geweigert, diese schlichte Tatsache zur Kenntnis zu nehmen. Dicke Bücher wurden über die heldenhafte Verteidigung von Damaskus geschrieben, die gar nicht stattfand. Zwar wurde die Stadt fast sechs Monate lang belagert doch während dieser ganzen Zeit kam es zu keiner einzigen Kampfhandlung. Nicht einmal Hunger drohte den Eingeschlossenen in den Speichern lagerten Lebensmittel für fast drei Jahre. Die Kapitulation erfolgte ausschließlich aus Vernunft und das spricht mehr für die Damaszener, als sinnloses Heldentum je könnte. Nur einige Truppenteile des frisch entlassenen Chalid fanden diese kampflose Übergabe schmählich. Sie hätten zu gerne die reiche Stadt geplündert versuchten es auch ein bisschen, doch da ließ Omar Halt gebieten: "Mit der Bekehrung von Damaskus ist der Islam Weltmacht geworden. Gottes Fluch soll den treffen, der sich am Reichtum dieser Stadt vergreift."
In Damaskus fand auch in der Folgezeit niemand einen Grund, sich über den Islam zu beklagen. "Wir können unsere Feinde besiegen, doch wir können unsere Eroberungen nur halten, wenn wir unsere Feinde auch überzeugen", verkündete Omar und verordnete friedliche Koexistenz mit den Christen. Nur die Dschisdscha wurde ihnen abverlangt, als zwanzigprozentige Kopf- und Grundsteuer für Ungläubige, dafür wurde ihnen aber volle Religionsfreiheit garantiert. Und die Hälfte der berühmten Johanneskirche von Damaskus mussten die Christen abtreten. Für die nächsten siebzig Jahre bot die älteste Kirche der Christenheit ein seltsames Bild : Gegenüber der christlichen Kanzel stand der islamische Predigtstuhl, neben dem Altar die Mihrab, die nach Mekka ausgerichtete Gebetsnische und zur selben Zeit riefen Glocken und Muezzins ihre so verschiedenen Gläubigen zum Gottesdienst unter ein und demselben Dach. Natürlich war das weniger Toleranz als Taktik, und die verfehlte ihre Wirkung nicht. Unter den Christen des Nahen Osten sprach sich schnell herum dass sich mit den Muslims leben ließe, und bei den nächsten Feldzügen des Islam kamen die Waffen meist gar nicht mehr zum Einsatz. Ohne nennenswerte Vorfälle besetzte der Islam im Lauf der nächsten zwei Jahre den Grossteil von Palästina, ganz Libanon und die Sinai-Halbinsel. Während dieser Zeit bot der Kaiser in Konstantinopel die größte Armee auf, die sein Reich bislang gesehen hatte. Aus allen Teilen der damaligen Welt ließ er Söldner anwerben, und sogar die damals noch heidnischen Bayern schickten hundert grimmige Krieger in Lederhosen. Zum Oberkommandierenden ernannte er einen erfahrenen Mann von dem außerdem feststand dass er für Badezimmerspiele untauglich war: den Kastraten Theodorus. Zweihundert Galeeren sollten den Völkerhaufen nach Palästina schiffen, doch bereits der Start verlief katastrophal: Noch im Hafen versanken drei Galeeren mit Mann und Maus, sechs weitere im Bosporus. Nur einhundertsechzig Schiffe erreichten das Gelobte Land.
An einem der heißesten Sommertage des Jahres 636 kam es zur Schlacht. Den Bayern verschlug die Hitze jede Kampfeslust. Sie beschränkten sich darauf, das eigene Nachschublager zu plündern. Währenddessen blies frischer Wüstenwind den römischen Soldaten Sand in die Augen. Schon nach kurzer Zeit endete der grandiose Aufmarsch in zügelloser Flucht. Ob es überhaupt zu einer Schlacht gekommen war blieb zweifelhaft: Fast alle Toten der Römer waren am Rücken verletzt, und nicht einmal Theodorus starb den Heldentod - er erhängte sich an einer Stange seines Kommandozeltes. Die islamischen Truppen hatten selbst nur dreißig Tote zu beklagen, und Omar erklärte beim Dankgottesdienst, dank Allahs Hilfe und aufgrund seines strategischen Geschicks habe er eine tausendfache Übermacht besiegt. Überflüssig zu sagen dass Omar während dieser ganzen Zeit Medina gar nicht verlassen hatte. Auf den Weg machte er sich erst, als ihm Sopronius, der Patriarch von Jerusalem, die Übergabe der Stadt anbot. Ali meinte zwar, auch in diesem Fall müsse Omar die Strapazen einer Reise nicht auf sich nehmen doch Omar sagte: "Ich muss meinen Gläubigen mit gutem Beispiel vorangehen und einmal selbst in den Kampf ziehen." Dann zog er los mit nur einem Leibwächter und einem Kamel. Zwei Proviantsäcke hatte er dabei: In dem einen waren Datteln und etwas Reis, in dem anderen ein Wasserschlauch. Fünf Tagereise vor Jerusalem warteten seine Truppen. Die staunten nicht schlecht als ihr oberster Kriegsherr daherkam: zu Fuß vor seinem Kamel. Und auf dem saß der Leibwächter. Er hat schlappgemacht, der Arme erklärte der Fürst der Gläubigen. Dann ließ er seinen braunen Kaftan erneut flicken und erwartete die Delegation aus Jerusalem. Die Übergabeverhandlungen dauerten nur kurz. Schon eine Woche später hielt Omar seinen Einzug in der Heiligen Stadt, natürlich zu Fuß. Mit von der Partie waren alle alten Kampfgenossen des Propheten, die den langen Marsch noch schaffen konnten. Sopronius den Omar in Amt und Würden belassen hatte betätigte sich als Fremdenführer. Vor dem ehrwürdigen Gemäuer der Grabeskirche blieb Omar lange stehen. Betreten wollte er das Heiligtum nicht.
"Dann werden meine Gläubigen verlangen daraus eine Moschee zu machen, und ich will euch Christen diesen heiligen Platz nicht weg nehmen", meinte er zu Sopronius. Da beeilten sich auch die Juden, schnell einen Fremdenführer zu Omar zu schicken, denn der wollte gerade zur heiligsten Stätte ihrer Religion wandern, dem Platz des salomonischen Tempels. Auf halbem Weg stieß ihr Oberrabbiner zum Kalifen. Doch da war es schon zu spät. Omar wollte partout den Stein sehen, auf dem Abraham einst Isaak opfern sollte. Der heilige Stein sah nicht gut aus. Christen hatten ihn zentimeterdick mit Kot eingerieben und ebenso dick schwollen Omars berühmte Zornadern. "Was habt ihr Juden gegen Abraham?" schrie er. Vergeblich beteuerte der Rabbiner, hier könne es sich nur um ein christliches Verbrechen handeln, verübt am heiligsten Stein der Juden. Da Omar zuvor von Sopronius gehört hatte die Juden hätten sogar einmal in das Heilige Grab gemacht stand für ihn der Schuldige fest. Das gesamte Judentum werde ich demütigen schwor er und zog sein Schwert so heftig dass sich der Rabbiner sofort zum Islam bekehrte. Damit hatte er sein Leben gerettet, nicht aber den Tempelplatz. Mit seinem eigenen Kaftan wischte Omar den Stein sauber dann bat er den ersten Muezzin des Islam, zum Gebet zu rufen. Seit Mohammeds Tod hatte der Alte geschwiegen, nun zitterte seine Stimme vor Rührung. Allen Gläubigen traten Tränen in die Augen als Omar den heiligen Platz zur Moschee erklärte, und wie viele Tränen seitdem darüber vergossen wurden kann nicht geschätzt werden. Dieser kahle Felsen im Herzen Jerusalems ist der ewige Stein des Anstoßes zwischen Juden und Muslims beiden gleich heilig und deshalb ein Denkmal religiöser Unversöhnlichkeit. Denn für die Juden wird er immer Moria heißen und für den Islam Al Aksah. Omar aber ritt auf seinem Kamel nach Hause und widmete sich inneren Reformen. Seihe erste war die Einführung einer Staatspension. Damit schaltete er jede mögliche Opposition gründlich und wirkungsvoll aus. Wer sollte von nun an etwas gegen Omar haben? Abbas etwa der Onkel des Propheten der selbst gerne Kalif geworden wäre? Er bekam eine Jahrespension von vier Millionen Mark. Jede der acht Witwen des Propheten erhielt zweihunderttausend Mark Jahresgehalt, Aischa vierzigtausend extra.
Den Veteranen aus der Schlacht von Bedr schlug ihre Treue mit hundert-tausend Mark pro Jahr zu Buche; wer in Hobaida dabei gewesen war, konnte mit achtzigtausend rechnen, und selbst die Kampfgenossen der späteren Feldzüge bekamen fürstliche Ruhegehälter. Ali hielt dieses Sozialprojekt für nackten Wahnsinn und weigerte sich auch nur einen Pfennig Pension anzunehmen. Da setzte Omar dessen beide Söhne auf die Liste der Kämpfer von Bedr. Zwar waren die Kleinen damals noch gar nicht auf der Welt gewesen, doch Ali schwieg - es sei unter seiner Würde, für Unmündige zu sprechen. Natürlich gab es einigen Wirbel In Medina. So hatten sich viele Gläubige Gottes Lohn nicht vorgestellt zumal sie selbst davon nichts hatten. Um wenigstens in der Stadt seine Ruhe zu haben ließ Omar öffentliche Speisehäuser errichten, in denen jeder umsonst so viel essen konnte wie er wollte. Dann stieg er auf die Kanzel der Moschee und beschwor schreckliche Höllenstrafen auf alle die gegen seine Entscheidung zu murren wagten. Sich selbst verschaffte der bescheidene Kalif eine andere Einnahmequelle: Er erklärte einen kleinen See zu seinem Privateigentum, über den sich islamische Krieger beim ersten Persienzug sehr gewundert hatten. Statt Wasser sickerte dort nämlich eine schwarze stinkende Flüssigkeit aus dem Boden. Schon wollten die Muslims diese Pfütze für eine Teufelsfalle halten da erklärten ihnen Einheimische, dass man das Zeug ganz gut in Lampen füllen könne. Omar hatte davon gehört. Er untersagte Unbefugten das Betreten des Geländes und ließ das dunkle Nass in Schläuche aus Ziegenleder füllen. Kurz darauf verkündete er: Damit des Propheten Gebetsanweisungen auch wirklich befolgt werden solle das früher im stillen Kämmerlein zu verrichtende Gebet der Fastenzeit ab sofort in den Moscheen stattfinden zur Abendstunde und bei Beleuchtung. Das Öl für die Lampen würde er gegen geringes Entgelt aus seiner eigenen Erdölquelle liefern. Ali spottete: "Willst du dir auch noch mit diesem schmierigen Zeug die Hände dreckig machen?" Omar aber sagte: "O Ali, dieses Zeug ist kostbarer als Gold. Es ist ein Geschenk Allahs und duftet dem Islam wie der Himmel."
Mit dem Wohlstand kommt der Hunger Weniger Weitblick als beim Erdöl hat Omar bei den Staatspensionen gehabt. Allen Ernstes hatte er geglaubt, die Bauern Arabiens und des Nahen Ostens würden gerne und freiwillig die dafür nötigen Kosten aufbringen. Doch diese Rechnung konnte nicht aufgehen. An den Bauern war der Islam und erst recht der mit ihm verbundene Wohlstand vorübergegangen. Der Islam war ein kaufmännischer Konzern gewesen und eine Religion für Kaufleute geworden. Die Bauern hatten Mohammed nie interessiert und damit übersah Allah jene, auf die letztlich auch der cleverste Kaufmann angewiesen ist. Die Lebensmittelversorgung war und blieb der wunde Punkt im kunstvollen Gebäude des Islam. Misstrauisch hatten die Bauern beobachtet dass auf dem Basar alles teurer wurde. Viehhaltung war ihnen von alters her verboten, und die Mieten für Zugtiere stiegen plötzlich ins Unermessliche. Viele Bauern mussten Kredite aufnehmen, nur um ihre Felder bestellen zu können und damit kamen sie vollends in die Gewalt der Kaufleute. Bei Abu Bekrs Tod bereits waren aus dem Oasenland regelrechte Güter geworden die von ihren ursprünglichen Herren nur noch als Pächter bewirtschaftet wurden. Und die Pacht betrug die Hälfte der Ernte. Das konnte nicht gut gehen. Weshalb sollte ein Bauer mehr arbeiten wenn ihm nur die Hälfte blieb? So verlotterten die Felder und die Wüste fraß sich langsam aber sicher in das ihr einst abgetrotzte Ackerland. Und dann kam auch noch die Geschichte mit den Staatspensionen. Über Nacht entstand ein nagelneuer Geldadel unermesslich reich und damit war Arabiens Volkswirtschaft reif für das Chaos. Die ungeheuren Geldmengen wirkten wie eine aufputschende Droge. Eine hektische Bautätigkeit zerstörte die bestgelegenen Acker und wer bei Omars Goldregen zu kurz gekommen war versuchte durch höhere Pacht reich zu werden. Da streikten die Bauern. Im Winter 639 wurde nur noch ein Achtel des gesamten Ackerlandes bewirtschaftet. Im Sommer 640 erlebte Arabien die schlimmste Hungersnot seiner Geschichte. Zwar wurden aus Syrien noch schnell viertausend Kamelladungen Getreide nach Medina und Mekka geschickt doch als sie ankamen, war dort auch schon die Pest ausgebrochen. Allein um Medina starben fünfundzwanzigtausend Menschen.
Da Volkswirtschaft zu Omars Zeiten noch keine Wissenschaft war, kam der Kalif ungeschoren davon. Die arabische Halbinsel aber erholte sich nie wieder von dieser Katastrophe. Erst heute versuchen Bewässerungssysteme den damals entstandenen Schaden wiedergutzumachen. Nach Omar kam die Wüste, heißt es in Arabien. In seinem ersten Schreck ließ Omar ein radikales Sparprogramm verkünden so etwas war schon damals populär. Unter der Devise "Rückkehr zum einfachen Leben" musste der Statthalter von Kufa seinen besonders prunkvoll geratenen Neubau-Palast niederbrennen, aber die Probleme des Islam konnten damit natürlich auch nicht gelöst werden. Es waren im Grunde Strukturprobleme. Die Entwicklung von einer kaufmännischen Organisation zu einem Staat hatte das ursprüngliche System des Propheten auf den Kopf gestellt. Die Gewinne aus dem Handel standen in keinem Verhältnis zu der Beute und den Tributzahlungen aus den eroberten Gebieten, und so rüsteten immer mehr Karawanen zu Militärtrupps um. Was sollte man auch handeln, wo sich genauso gut rauben ließ? So musste die Politik des Islam zum erklärten Imperialismus werden. Die Grenzen des Wachstums im Inneren waren schon längst erreicht die Erwartungen aber hoffnungslos überreizt. Wollte Omar nicht eine Revolution unzufriedener Araber riskieren mussten fremde Völker die Zeche bezahlen. Zunächst musste Persien dran glauben. Dort regierte das älteste Herrscherhaus der Alten Welt, die Sippe der Sassaniden. Sie hatten es geschafft, seit Alexander dem Grossen ihren Thron zu behaupten. In ihrer Residenzstadt Medain hatten die Schahs fast ein Jahrtausend lang ungestört Schätze über Schätze häufen können. Nun saß dort ein junger Mann namens Jesdegir auf dem Thron, und ihm hatte Omar angekündigt, er werde der letzte Schah der Weltgeschichte sein. Neuntausend Mann, dachte Omar würden ausreichen, das riesige Perserreich zu erobern. Er schickte sie über den Euphrat und gab den Befehl, die Brücken hinter der Armee abzubrechen: "Wo ein islamischer Soldat steht gibt es kein Zurück."
Auf der anderen Seite des Euphrat aber stand bereits die persische Armee, die nicht nur das Vierfache größer, sondern auch besser ausgerüstet war. In vorderster Front schnaubten dreißig Elefanten, die Tanks der Antike. Omars Feldherr gab Befehl, sich auf die Elefanten zu konzentrieren und ihnen die Rüssel abzuhauen. Er selbst ging mit gutem Beispiel voran und wurde prompt von einem aufgeregten Dickhäuter zertrampelt. Damit war die Schlacht entschieden. Die islamischen Truppen wurden in den Euphrat gedrängt viertausend Mann ertranken oder wurden erschlagen. Doch Jesdegir hatte seinen letzten Sieg errungen. Ende Februar 637 kamen die Muslims wieder, vierzigtausend Mann stark, und diesmal siegten sie an den Ufern des Euphrat. Nach einer verbissenen, dreitägigen Schlacht musste Jesdegir seine Truppen zurückziehen. Von nun an flohen die Perser, wo immer islamische Einheiten in Sicht kamen. Im April 638 besetzten die Muslims Medain, die tausendjährige Residenzstadt der Perser, und dabei fiel ihnen der größte Schatz in die Hände der je in der Weltgeschichte erobert wurde. Sie gingen nicht zimperlich damit um. Vor dem Tor des Palastes bereits hing ein riesiger Schleier, aus reinem Gold geweht. Er wurde eingeschmolzen und ergab Barren im Gesamtgewicht von siebenhundert Kilo. Aus der riesigen Krone die an schweren Ketten über dem Kaiserthron hing, wurden einhundertzwanzig Kilo Edelsteine gebrochen aus einem Prunkpanzer über viertausend Diamanten. Das kostbarste Stück aber war ein Teppich, fünfzehn Meter breit und einhundertfünfzig Meter lang. Er hieß "Teppich der Weinlese", war uralt und überaus haltbar. sein Grundmaterial war massives Gold, darauf leuchteten Blumen aus Edelsteinen und alle Städte des persischen Reiches, aus Diamanten und Perlen gebildet. Omar hätte ihn gerne in seinem eigenen Haushalt gesehen doch sicherheitshalber fragte er Ali ob er was dagegen habe. "Kannst du ihn in dein Grab mitnehmen?" meinte Ali. Da ließ Omar dieses einmalige Kunstwerk zerhacken und zur übrigen Beute legen. Die war so groß dass allein das Prophetenfünftel neunhundert Kamelladungen betrug. Einige Edelsteine wurden später nach Konstantinopel verkauft und dort noch später von Venezianern geraubt. Sie wurden zum kostbarsten Altar des Christentums verarbeitet der Palad´oro in der Markuskirche von Venedig, und dort funkeln sie heute noch ein letzter Glanz des berühmtesten Teppichs der Weltgeschichte.
Einige Muslims aber wurden ihrer Beute nicht froh: Sie hatten die Speicher des Palastes geplündert, dabei einige Säcke mit Kampfer gefunden und sie für Salz gehalten. Das war natürlich eine tödliche Verwechslung. Schah Jesdegir aber verlor nicht nur seine Residenzstadt, sondern auch sein Reich. Eine Provinz nach der anderen fiel den Muslims in die Hände, und Jesdegir endete erbärmlich als Straßenbettler. Im Jahr 651 wurde der letzte Sassanide zu Chorasan von einem Müller erschlagen, den er um eine Schale Weizen gebeten hatte. Es kam zu einer kleinen Gerichtsverhandlung gegen den Müller, und dabei stellte sich die Identität seines Opfers heraus. Da sagte der Müller: "Und wer weint um ihn?" Gleichzeitig mit den persischen Eroberungen ging auch der Krieg gegen das Oströmische Reich weiter. Ist es schon erstaunlich, dass da urplötzlich in der Wüste eine Macht entstanden war, so wird für immer unbegreiflich bleiben, dass es dieser Macht auch gelang, in kürzester Zeit die am höchsten zivilisierten Staaten der damaligen Welt in die Knie zu zwingen. Das Oströmische Reich war der legitime Erbe der alten Römer. In Italien hatten die Germanen gehaust und das war der Halbinsel nicht gut bekommen. Nun waren dort zwar schon wieder seit einem Jahrhundert römische Truppen stationiert, doch von der alten Pracht Roms war nicht viel geblieben. "Hauptstadt der Welt" war unangefochten Konstantinopel und mit dieser strahlenden Metropole konnten sich nur noch zwei Städte messen: Damaskus, der alte Handelsplatz, und Alexandria, das Tor zur Kornkammer der Alten Welt der Hafen Ägyptens. Für Konstantinopel war Alexandria lebenswichtig: Dreiviertel seines gesamten Getreidebedarfs wurden in Alexandria verladen und seit dem Fall von Damaskus über diesen Hafen auch nahezu der gesamte Außenhandel abgewickelt. Dementsprechend stark war die Stadt befestigt, und nie wurde sie im Verlauf ihrer langen Geschichte mit Waffengewalt eingenommen. Doch ebenso kostbar war das Hinterland, das Delta und der lange Lauf des Nils, die üppigsten Felder der Erde.
Genau dorthin marschierten nun die Armeen des Islam. "Es fehlt uns an Brot, also müssen wir welches holen", hatte Omar verkündet, und während in Arabien Zehntausende an Hunger starben, fielen 15.000 Mann arabischer Truppen im Niltal ein. Im Juli 640 schlugen sie bei Heliopolis eine römische Armee, und damit beherrschten sie den gesamten Nil bis zum Delta. In Alexandria residierte als Patriarch und römischer Statthalter Kyros, ein betagter Herr. In den Anfangstagen des Islam war er ein wichtiger Geschäft-spartner Mohammeds gewesen, und der Prophet hatte ihn sogar einmal nach Mekka eingeladen. Kyros war nicht gekommen, und nun kam der Islam zu ihm. Der alte Herr schrieb einen Brief an seinen Kaiser in Konstantinopel: "Nach allen bisherigen Erfahrungen mit dem Islam muss ich fest stellen, er ist ein Kreuz, von Gott gesandt. So lasset uns dieses Länder dem Halbmond übergeben." Der Brief erreichte seinen Adressaten nicht mehr. Am 11. Februar 641 starb in Konstantinopel Kaiser Heraklios. Eineinhalb Jahre lang wurde darüber gestritten, wer nun Kaiser werden solle, und Kyros saß in Alexandria auf verlorenem Posten und wartete auf Antwort. An einem Septembertag des Jahres 642 schließlich schrieb Kyros eine formlose Kapitulationserklärung, bestieg einen Esel und trabte auf diesem quer durch die islamischen Linien Richtung Sinai. Dort bezog er eine Einsiedelei, schrieb bis an sein Lebens-ende Tiefsinniges über die Verwandtschaft zwischen Gott und Allah, und daher wird sein Grab noch heute sowohl von christlichen als auch islamischen Pilgern besucht. Da Alexandria ohne Schwertstreich erobert wurde, kamen seine Bewohner glimpflich davon. Sie mussten nur einen gehörigen Tribut zahlen, durften aber ihr Eigentum behalten. Das römische Staatseigentum aber wurde zur Beute erklärt, und damit erlitt die abendländische Kultur wohl den schlimmsten Verlust ihrer Geschichte: In Alexandria befand sich nämlich die Bibliothek der Ptolemäer. Die frühen Christen waren, alles in allem, ausgesprochene Büchermuffel. Was nicht als christliche Literatur galt, wurde vernichtet. Die "Grosse Bibliothek" in Konstantinopel umfasste nur zweihundert Bände. In Alexandria aber lagerte das gesamte Wissen der Antike. Die alten Ptolemäer waren ausgesprochene Bücherwürmer, und als prunkvollstes Denkmal ihrer Regierung galt die "Grosse Bibliothek".
Selbst Kleopatra hatte zwischen ihren Liebesaffären Zeit gefunden, der Bibliothek siebzehntausend Handschriften zu spendieren, und das letzte Inventarverzeichnis der Bücherburg steht noch heute in der Geschichte konkurrenzlos da: neuneinhalb Millionen Bücher alle von Hand geschrieben. Sämtliche Werke aller griechischen Philosophen und Dichter waren vorhanden, die römische Literatur komplett, aber auch Wörterbücher, mit deren Hilfe heute sämtliche unentzifferbaren Inschriften der Antike mühelos übersetzt werden könnten, indische und sogar chinesische Literatur. Allahs Soldaten gerieten vor diesem Bücherberg in Verlegenheit. Sie schickten einen Kurier nach Medina, was sie damit tun sollten. Omars Antwort war kurz: "Nur was der Prophet gesagt hat, ist interessant." Die nächsten sechs Monate wurden die Badeöfen von Alexandria mit dem Wissen der Antike geheizt. Nur etwa zweihundert Bücher entgingen der Verbrennung. Später hat diese Barbarei auch Arabern leid getan. Im Jahre 1972 entstand in Kairo eine Doktorarbeit mit dem Titel: Wie wäre die Kulturgeschichte der Menschheit ohne die Bücherverbrennungen von Alexandria verlaufen? Mit der Eroberung von Persien und Ägypten war der Islam die absolute Weltmacht geworden, doch gleichzeitig ein Koloss auf tönernen Füssen. Zwanzig Jahre waren seit der Hidschra vergangen zehn seit dem Tod des Propheten. Nun standen arabische Truppen im Kaukasus am Nil, am Mittelmeer und sogar an den Ufern des Indus. Dagegen verblasste sogar das einstige Weltreich der Römer. Araber hatten sich wahrlich die Erde untertan gemacht, und die ganze glorreiche Geschichte hatte nur einen Schönheits-fehler: Arabien selbst war nahezu entvölkert. Das wirtschaftliche Gefüge der Halbinsel war zusammengebrochen, seit einigen Jahren wurde nur noch von Beute gelebt. Omar, der diese Entwicklung auf dem Gewissen hatte schien sie gar nicht zur Kenntnis zu nehmen. Er residierte in Medina eher wie ein Wüstenscheich, und je größer das Reich wurde, desto lieber befasste er sich mit Kleinigkeiten.
Für die Verwaltung des großen Reiches hatte er einen Diwan eingesetzt. Dieses Wort stammt aus dem Persischen und bedeutet: Versammlung von Geistern, und tatsächlich blieb der Diwan geisterhaft. Wer im Staatsrat saß und wer wofür zuständig war, blieb ein Geheimnis. Der Diwan blieb anonym, und das war sogar von Vorteil: Unerkannt konnten seine Mitglieder das Reich kontrollieren und niemand konnte sie bestechen. Wer als Mitglied des Diwan bekannt wurde, musste seinen Platz räumen, und damit kann Omar ruhig als der Vater des Geheim-Kabinetts gelten. Omar blieb genug Zeit, sich mit seinem Hobby zu befassen den Rechtsstreitigkeiten kleiner Leute. Und das fünf Tage in der Woche - der Freitag gehörte traditionsgemäß dem Gebet, und nur der Samstag war Angelegenheiten des Riesenreiches reserviert. Von Sonntag bis Donnerstag war der Kalif Distriktrichter. Nicht immer verhielt er sich dabei diplomatisch. Da kam einmal ein persischer Sklave zu ihm und klagte: Sein Gutsherr verlangte zuviel Pacht. Omar fragte: "Was ist dein Beruf?" ,Tischler, Schlosser und Anstreicher, antwortete Lulu. Wenn du so viel kannst, kannst du auch höhere Pacht bezahlen," entschied Omar. Lulu grollte natürlich. Einige Tage später, am 3. November 644 betete Omar gerade in der Moschee, als Lulu wieder auf ihn zukam. Diesmal hatte der Sklave einen Dolch in der Hand. Einige Sekunden später war Lulu erschlagen, doch auch Omar hatte drei Dolchstiche abbekommen. Zunächst erschienen die Verletzungen harmlos, zumal Omar noch das Gebet zu Ende sprach. Beim Verlassen der Moschee aber brach der Kalif zusammen: "Der Kerl hat mich umgebracht. Gott sei Dank war's kein Muslim." Die Verletzungen waren vielleicht noch nicht einmal tödlich, doch nach zwei Tagen kam Wundfieber hinzu. Trotz ständiger Bitten seiner Freunde weigerte sich der Sterbende einen Nachfolger zu ernennen. Er hatte andere Sorgen: Jeder musste ihm schriftlich geben, dass Omar ein gerechter Kalif gewesen sei, und diese Urkunden sollten in seinen Sarg gelegt werden, als Entlastungspapiere vor Allah. Am siebten Tag nach dem Attentat ernannte er endlich ein sechsköpfiges Wahlkomitee und sagte mit brechender Stimme: "Wählt Ali oder Osman oder sonst wen. Mir ist's egal."
Damit starb er, und diese allerletzte Wurstigkeit hätte beinahe auch dem Islam das Leben gekostet. Denn die Alternative Ali oder Osman bedeutete nicht nur eine Entscheidung zwischen zwei grundverschiedenen Persönlichkeiten, sondern auch zwischen zwei Systemen und, was in Arabien stets gefährlichen Konfliktstoff birgt, zwischen zwei Stämmen. Zwar waren sowohl Ali als auch Osman Koreischiten doch Ali war seit Mohammeds Tod Boss der Haschemiten, des ärmeren Zweiges der Gruppe, während Osman zur steinreichen, hochnoblen Sippe der Omajaden gehörte. Und beide Kandidaten hatten etwa gleichviel Anhänger. Es war mehr Qual als Wahl, was sich da im Wahlkomitee ab spielte. Die erste Sitzung der Sechs endete damit, dass sich das Komitee für unfähig erklärte, zumal Osman und Ali selbst drin saßen und dabei sich keine Stimme geben durften. Die zweite Sitzung endete damit dass Abd-el-Rachman der einzige den alle für halbwegs neutral hielten, damit beauftragt wurde, im Alleingang die Entscheidung zu fällen. Damit ging das Gemauschele los. Es endete nach fünf Tagen damit dass Abd-el-Rachman einen Ministerposten von Osman versprochen bekam und Osman Kalif wurde, während Ali sich wieder übertölpelt fühlte. Nicht einmal darüber wie Osmans Name zu schreiben sei konnten sich die Historiker einig werden. Der dritte Nachfolger des Propheten machte es ihnen aber auch schwer: das "O" seines Namens gehört eigentlich wie "ou" gesprochen, und das "S" könnten am ehesten Lispler hinkriegen. Daher schwankt die Schreibweise zwischen Osman, Othman und Outhman bis Uthman. Und das Charakterbild des Mannes mit diesem komplizierten Namen noch mehr. Einig sind sich alle nur darüber, dass Osman von Haus aus sehr begütert und überdies sein Leben lang ein schöner Mann war. Sein gepflegter Bart reichte bis zum Ellbogen, und nie zeigte er sich ohne makelloses Make-up in der Öffentlichkeit. An Mohammed hatte er sich verhältnismäßig früh angeschlossen, und das Geld des verwöhnten Hocharistokraten hatte dem Propheten so geholfen dass dieser nacheinander zwei Töchter seinem Finanzier verehelichte.
Doch Osmans Verdienste um den Islam erschöpften sich mit dessen Finanzierung - an keiner einzigen Kampfhandlung hatte er je teilgenommen. Mohammed selbst musste ihn einmal dafür entschuldigen: Osman sei so schön, dass es ein Jammer sei, ihn einer Gefahr auszusetzen, und so schüchtern, dass er auch gar nicht auf das Schlachtfeld passe. Das mit der Schüchternheit schien allerdings nicht zu stimmen. Wenn es darum ging, Verwandten oder Freunden Vorteile zu verschaffen, kannte Osman überhaupt keine Scheu und schon lange ehe er Kalif wurde, galt er als Unverschämter Intrigant. Mit dem Pfund, das er einst dem Propheten gepumpt hatte, verstand er ganz gut zu wuchern: in aller Stille war er Arabiens reichster Großgrundbesitzer geworden, und ebenso unauffällig hatte er den einst genossenschaftlich betriebenen Außenhandel des Islam, sobald dieser Staat wurde, zu seinem Privatunternehmen gemacht. An Einfluss fehlte es Osman also keinesfalls, als er Kalif wurde, wohl aber, meinten einige, an Verstand. Osman kann sich mit Schmuckstücken behängen, aber er wird keinen Freund finden, der an ihm hängt, hatte einst Abbas gesagt. Doch als Osman Kalif wurde, gönnte ihm auch Abbas diese Würde: Omars Tod war für nahezu alle eroberten Gebiete das Signal gewesen, sich gegen die Herrschaft des Islam zu erheben. In Persien formierte sich eine Guerillabewegung in Damaskus und Alexandrien kam es zum Aufstand, Jemen und Palästina erklärten sich für unabhängig - das Riesenreich schien jämmerlich auseinander zubrechen und aus Konstantinopel wurde ein Heer losgeschickt, den Muslims den Rest zu geben. In Medina hatte Osman auf sein Siegel die Worte setzen lassen: "Allahs Gnade leite und nähre mich" aber selbst dort fanden die Gläubigen, der Kalif sei von Gott und allen guten Geistern verlassen. Gleich bei seiner Antrittsrede, auf der Kanzel des Propheten hatte er sich eine Stufe höher gestellt, als Mohammed je gesessen hatte und musste unter dem Protest der Gläubigen herabsteigen. Dann ernannte er einen erfahrenen General zum Gouverneur der neuen Verwaltungseinheit Kufa an der Euphratmündung - doch der fiel in der Moschee betrunken von der Kanzel. Den Statthalterposten im ohnedies unruhigen Jemen vergab er irrtümlich gleich dreimal, innerhalb eines einzigen Monats. Hätte nicht noch Omars Diwan regiert, wäre dies das Ende des Islam gewesen.
Osman aber wusste nicht einmal wer in diesem geheimen Rat saß, und so liefen die Regierungsgeschäfte noch zwei Jahre, ohne dass der Kalif etwas dazu tun konnte. Deshalb blieben auch die Armeen in den eroberten Gebieten intakt, und nach eineinhalb Jahren waren sämtliche Aufstandsbewegungen niedergeschlagen. Natürlich hatte Osman selbst neue Generäle ernannt, ausnahmslos Vettern und Neffen, und sie waren auch alle aus Medina losgezogen. Gleich außerhalb der Stadtgrenzen wurden sie von Kurieren des Diwan abgefangen: Bei allem Respekt vor dem Kalifen möchte der Geheime Rat doch vorschlagen, dass die frisch gebackenen Heerführer die Schlachtfelder erst nach Abschluss aller Kampfhandlungen aufsuchen. Bis dahin stünden ihnen komfortable Paläste samt reizvollen Sklavinnen zu unbeschränkter Verfügung... Keiner lehnte ab, und so versickerte Omars Generalstab in gut verborgenen Wüstenpalästen. Es ist eine Groteske der Weltgeschichte, dass der Kalif zwei Jahre lang seine Regierung gar nicht kannte, dass Osman zwei Jahre lang auch nicht einmal merkte, dass nahezu sämtliche seiner Erlässe durchkreuzt wurden. Osman fiel aus allen Wolken, als eines Tages neun würdige Männer vor ihn traten, die er zwar vom Gesicht her kannte, mit denen er aber nie gesprochen hatte. Nun hielt der Älteste von ihnen eine kurze Ansprache: "Verzeih uns, Fürst und Alleinherrscher aller Gläubigen, dass wir gemäss den Befehlen Omars zwei Jahre lang regiert haben. Wir glauben, nun unsere Pflicht getan zu haben und übergeben dir hiermit das Reich des Islam." Osman dankte ihnen nicht. Den Ältesten ließ er hinrichten, die anderen in die Verbannung schicken, und wir wissen nicht einmal die Namen der Retter des Islam. Sofort setzte Osman einen neuen Diwan ein, und wer darin saß, blieb nicht lange geheim: lauter Verwandte des Kalifen. Nur der Vorsitzende war nicht mit dem Kalifen verwandt. Er hieß Merwan, und der damals schon siebzig-jährige Osman, Gatte von sieben Frauen, pries Merwans verlängertes Rückenende in einem langen Gedicht. Kürzer und prosaischer beschrieb Ali das übrige: "Ein Haufen Scheiße, Verlogenheit und Korruption." Amru Ben Aass fand, Alihabe da höflich untertrieben.
Doch Amru war aus persönlichen Gründen befangen: Obwohl er mit einer Schwester Osmans verheiratet war, hatte ihn Merwan von seinem Statthalterposten in Ägypten abgesetzt. In seinem ersten Zorn ließ sich Amru scheiden, dann besprach er sich mit seinen Freunden, daraufhin brach ein Aufstand aus. Merwan aber hatte nicht nur einen neuen Statthalter nach Alexandria geschickt, sondern auch eine neue Armee. Nach zwei Wochen bereits steckten die Köpfe der Aufrührer auf den Zinnen der Stadt. Nur der Amrus fehlte: Der Rädelsführer war rechtzeitig nach Medina gereist und hatte sich dort ausgerechnet mit Merwan angefreundet. Dafür bekam er einen neuen Statthalterposten in Persien und bereits nach einem halben Jahr war dabei sein Privatvermögen um eine halbe Million Mark gewachsen. Auch für Merwan machte sich die Geschichte bezahlt: Die von ihm nach Ägypten geschickte Armee hielt sich dort nicht lange auf, sondern eroberte nach und nach die afrikanische Mittelmeerküste bis Tunesien. Dabei fielen einige reiche Römerstädte in ihre Hände, und insgesamt wurden eineinhalb Milliarden Mark Beutegelder nach Medina geschickt. Osman fand, dieser Goldregen sei gerade das passende Geschenk für Merwan. Ohne sich mit den Verwaltern der Staatskasse auch nur zu beraten schenkte er seinem Günstling den größten Barbetrag aller Zeiten. Das machte natürlich böses Blut in Medina, und es ist ein Wunder, dass es nicht gleich zum Aufstand kam. Doch die beispiellose Siegeswelle des Islam schien sämtliche Gesetze politischer Psychologie auf den Kopf gestellt zu haben. Die letzten zwanzig Jahre waren ein einziger Triumph des Propheten gewesen, und in diesem Rausch ging sämtliche Kritik unter. Unter normalen Umständen und erst recht in der pluralistischen Stammesgesellschaft der Araber wäre Osman seines Thrones vom ersten Fehler an nicht mehr sicher gewesen, doch er hatte zusätzlich noch das Glück, dass sein Vorgänger Omar die Macht des Kalifates so gefestigt hatte, dass auch wahnwitzige Entscheidungen als Gottes Ratschluss unantastbar blieben. So konnte Osman den Islam sechs Jahre lang unangefochten verschleudern - solange Siegesmeldungen hereinkamen, konnte die Sache gut gehen. Und die Siegesmeldungen kamen: Im Jahr 650 wehte die grüne Fahne des Propheten auch im Mittelmeer. Zypern wurde erobert, Malta und Kreta geplündert und schließlich fiel auch der wichtigste Flottenstützpunkt Konstantinopels die Insel Rhodos.
Die Welt erlitt bei dieser Gelegenheit einen unersetzlichen Verlust. In der Hafeneinfahrt stand seit der Antike eine riesige Statue des Sonnengottes. Zwischen ihren gespreizten Beinen spielte sich der gesamte Schiffsverkehr ab, und die rechte Hand diente als Leuchtturm. Der "Koloss von Rhodos" galt als Weltwunder, zu Recht denn eine größere Freiplastik wurde nie wieder gebaut. Auch seine ähnlichen Zwecken dienende Schwester, die Freiheitsstatue im Hafen von New York hätte neben ihm wie ein zierliches Mädchen gewirkt - ihr hoch gereckter Arm hätte ihm nicht einmal einen Kinnhaken geben können. Allerdings hatte der alte Sonnengott andere Schicksalsschläge hinnehmen müssen. Bei einem Erdbeben war er einmal ins Meer gestürzt doch die römischen Kaiser ließen ihn wiederherstellen. Dann wollten ihm die Christen an die Kehle. Doch als sie mit Kränen und Brechstangen anrückten, war dem heidnischen Symbol in wunderbarer Weise ein Kreuz auf der Stirn gewachsen. Vor den Muslims konnte ihn nichts mehr retten. In vierwöchiger Schwerarbeit wurde das Weltwunder verschrottet, seine Trümmer auf Schiffe verladen und anschließend auf neunhundert Kamelen kreuz und quer durch Arabien geschleppt - als Beweis für den Sieg über die antike Kultur. Bei dieser Gelegenheit wurde so viel geklaut dass nur noch achtzig Kamelladungen Blech in Medina eintrafen. Sie wurden eingeschmolzen und krönen heute als Kuppel das Grab des Propheten. Denn Osman war nebenbei auch ein leidenschaftlicher Bauherr. Er ließ den Platz um die Kaaba in Mekka ausbauen und gestaltete die Grosse Moschee in Medina so üppig, dass kein Gläubiger mehr das erste Gebetshaus des Islam wiedererkannte. Außerdem aber ernannte er seinen Cousin Muawia zum Statthalter von Syrien, und damit war die Schonzeit für den Kalifen endgültig abgelaufen. Als erster legte sich Abd-el-Rachman mit ihm an, der Osman zum Kalifen gemacht hatte, aber nicht Minister geworden war. In der Moschee stellte er den Kalifen zur Rede: "Du hast den Islam genau zu dem gemacht, wogegen er gegründet wurde." "Daran bist du allein schuld," antwortete Osman. "Warum hast du mich zum Kalifen gemacht?" Diese Frechheit giftete Abd-el-Rachman so sehr, dass ihn der Schlag traf.
Diese Geschichte sprach sich herum und noch mehr das Missgeschick, dass Osman den Ring des Propheten verloren hatte. Osman trug stets mindestens fünfzehn Ringe an seinen Fingern. Als er sich einmal wusch, fiel ihm der unscheinbarste in den Brunnen ein schlichter Silberreif mit der eingravierten Inschrift "Mohammed, Prophet Gottes". Mohammed hatte ihn nach der Schlacht von Bedr anfertigen lassen, und Abu Bekr und Omar hatten ihn später getragen, so dass er zum Symbol des Kalifats wurde. Obwohl Osman sofort den Brunnen aufgraben ließ, wurde der Ring nicht mehr gefunden. Tags darauf stand mit grüner Farbe an der Wand der Moschee: "Allah hat den Ring zurückgeholt, weil Osman seiner unwürdig ist." Und von diesem Augenblick an gingen sämtliche Vorbeter, die Geistlichkeit des Islam, in Opposition zum Kalifen. Zusätzlichen Ärger schaffte auch noch Muawia, Osmans Cousin und Statthalter in Syrien. Für die alten Kämpfer des Islam musste seine Ernennung eine Provokation sein - zu Lebzeiten des Propheten hatte sich Muawia als einer seiner wildesten Gegner einen Namen gemacht, und nun war er Gouverneur der reichsten Provinz. Als solcher sorgte er dafür, dass Syrien nicht sehr reich blieb. So unverschämt beutete er das Land aus, dass er binnen kurzer Zeit ein Achtel des Landes als Privatvermögen verbuchen konnte. Vergeblich hielten ihm alte Muslims einen Ausspruch des Propheten vor: "Wer Gold und Silber rafft und dieses nicht im Sinn Gottes verwendet, soll in der Hölle braten (9. Sure, 5. Vers). Muawia meinte nur: Das gelte nur für Christen und Juden, aber nicht für Muslims. Und Osman ergriff natürlich auch Partei. Für Muawia. Die Nachwelt verdankt dieser Geschichte immerhin die Endfassung des Koran. Denn Osman ließ nun alle Aussprüche des Propheten noch einmal katalogisieren und in einer Ausgabe vereinigen. Was sonst noch an Schriftlichem vorhanden war, wurde verbrannt. Das System, nach dem der Koran geordnet wurde ist etwas eigenartig: Osman begann mit den längsten Reden des Propheten, und so ergab sich weder eine thematische Ordnung noch eine chronologische. Ausschlaggebend war nur die Wortzahl der einzelnen Kapitel, die in der Fachsprache des Islam Spuren heißen. So kommt es, dass die ersten Äußerungen Mohammeds heute die Schlusskapitel des Korans sind und seine letzten die ersten.
Auch der Koran konnte Osman nicht mehr retten. In nahezu allen Moscheen des weiten Reiches wurde der Kalif nun offen kritisiert, und was noch schlimmer war: Ganze Truppeneinheiten verweigerten den Gehorsam. Osman berief eine Konferenz sämtlicher Statthalter ein. Einziger Punkt der Tagesordnung: Wiederherstellung der Autorität des Kalifen. Es gab ebenso viele Ratschläge wie Teilnehmer. Einer riet, neue Feldzüge anzusetzen. Der andere empfahl höhere Besoldungen, der dritte Niederschlagung der Aufstände mit Gewalt, und Muawia meinte, Osman sollte sich keine Sorge machen und den Statthaltern freie Hand gewähren. Osman tat das alles und nichts. Die Folge war ein noch größeres Chaos. Sämtliche Garnisonen an der Euphratmündung traten in den Ausstand, und auch die ägyptische Armee empörte sich. Osman weigerte sich, mit den Aufrührern zu verhandeln. Daraufhin beschlossen die Truppen von Kufa, Basra und Fostat in Ägypten, den Kalifen in Medina zu besuchen um ein ernstes Wort mit ihm zu reden. Das war im Januar des Jahres 656. Bereits im Februar lagerten mehr als zehntausend Unzufriedene um Medina. Die Stadt geriet in Panik und fürchtete dass die Aufrührer vielleicht den Basar plündern könnten. Die Bürgerschaft wählte Ali zu ihrem Sprecher. Ali ging zu Osman: Er sei bereit zwischen dem Kalifen und den Aufständischen zu vermitteln wenn Osman sich öffentlich in der Moschee für seine bisherige Politik entschuldige. Noch am gleichen Tag bestieg Osman die Kanzel und hielt eine lange, tränen reiche Entschuldigungsrede, die auch die Bürger von Medina und die Anführer des Aufstandes rührte. Der Friede schien wie der greifbar nahe. Doch am Abend dieses Tages besprach sich Osman mit Merwan, und am nächsten Tag verkündete der Kalif von derselben Kanzel den Widerruf seiner Entschuldigung. Daraufhin rückten die Aufständischen in die Stadt ein, und die Bürger von Medina verbündeten sich mit ihnen. Noch einmal versuchte Ali zu vermitteln. Er versprach jedem Aufständischen der freiwillig nach Hause gehen wollte, fünftausend Mark aus der Staatskasse.
Das wirkte: Nur dreihundert Aufrührer blieben in Medina, ausnahmslos Truppen aus Ägypten. Sie wollten kein Geld, sondern einen neuen Kommandanten, Mohammed, den Sohn Abu Bekrs. Am nächsten Morgen bekamen sie ihren Willen. Feierlich unter zeichnete Osman die Ernennungsurkunde, und damit zog Mohammed samt den nun wieder gehorsamen Truppen in Richtung Ägypten. Schon zwei Tagreisen später überholte sie ein eiliger Sklave. Er solle zum Statthalter von Ägypten. "Der bin ich", sagte Mohammed. "Was sollst du ausrichten?" Der Sklave stotterte, und daraufhin ließ ihn Mohammed Ben Bekr durchsuchen. Es fand sich ein Brief mit dem Siegel des Kalifen: "An den alten und rechtmäßigen Statthalter des Islam zu Ägypten. Sobald Mohammed Ben Bekr in dein Land kommt, lass ihn einfach umbringen. Meinen Segen hast du". Die Truppen kehrten auf der Stelle um. In Medina gab sich der Kalif erstaunt: Er kenne diesen Brief nicht. Da müsse jemand sein Siegel missbraucht haben. "Dann liefere uns den Merwan aus", forderte Mohammed Ben Bekr. "Er ist der einzige, der sonst noch dein Siegel hat." Osman weigerte sich: "Merwan ist die Würde meines Kalifats." Daraufhin beschloss Mohammed Ben Bekr, mit seinen Truppen so lange vor Osmans Palast zu warten, bis der Kalif sich's anders überlegt hatte. Er blieb nicht lange allein. Auch aus Basra und Kufa kamen Aufständische - sie hatten von der Geschichte gehört und wollten nun endlich Taten sehen. Von nun an wurde der Kalif in seinem Palast belagert. Sooft er sich an einem Fenster zeigte, flogen Steine hoch, und schließlich wurde ihm sogar die Wasserleitung abgegraben. Ali versuchte noch einige Male zu vermitteln. Osman weigerte sich nach wie vor, Merwan zu entlassen: "Ein Kalif ist nicht erpressbar." Er weigerte sich auch, eine Pilgerfahrt nach Mekka anzutreten, obwohl er als Pilger ungefährdet seinen Palast hätte verlassen können. Osman wollte die Katastrophe. Und sie kam. Nach vierwöchiger Belagerung sprach sich herum, dass Muawia aus Syrien ein Heer gegen die Aufständischen schicken würde. Die Aufrührer entschlossen sich zu handeln. Am Freitag, dem 18. Juni 656, stürmten sie den Palast.
Osman saß mit seiner Frau im Empfangsraum, anscheinend unansprechbar in die Lektüre des Koran vertieft. Es wollte aber auch niemand mehr mit ihm reden. Schweigend umstellten die Aufständischen den Kalifen, während aus den anderen Räumen des Palastes bereits die Möbel auf die Strasse geworfen wurden. Eine halbe Stunde später durften Neugierige aus Medina den Palast betreten. Der Kalif war über den ganzen Empfangsraum verteilt seine Eingeweide lagen auf dem Bett eine Hälfte seines Kopfes lag neben dem Gebetpult, die andere auf der Fensterbrüstung. Hände, Füße, Arme und Beine waren zu einem bizarren Haufen geschichtet und an das Glied des alten Herrn hatte ein Witzbold den Siegelring mit der Aufschrift "Gott leite mich" gesteckt.
|
|
Der Krieg der lustigen Witwe
|
|
|
Osmans Ermordung und ihre Vorgeschichte waren die letzten, alarmierendsten Anzeichen dafür, dass etwas faul war in der Gründung des Propheten. Seither zerbrechen sich Moral- und Geschichtsphilosophen die Köpfe darüber, was denn und wann denn der Sündenfall des Islam gewesen sei. Jede Religion hat einmal anders angefangen. Wäre beispielsweise das Christentum stets so gewesen, wie es die Jahrhunderte abendländischer Geschichte geprägt hat die römischen Cäsaren hätten absolut keinen Grund gehabt, Christenverfolgungen zu veranstalten. Eine frömmere Untertanenfabrik hätten sie sich doch gar nicht wünschen können. Doch das Christentum war zunächst eine revolutionäre Bewegung. Jesus als historische Figur war ein Revolutionär, standrechtlich hingerichtet im römisch besetzten Palästina. Er hatte zumindest Kontakte zu den Essenern, der nationalistischen Guerillabewegung jener Zeit, wenn er nicht gar dazugehörte. Der ehemalige Zimmermann zog als Agitator der Gewaltlosigkeit durch Galiläa wie später Mahatma Gandhi durch Indien, aber er hatte weniger Erfolg als Gandhi: Er wurde geschnappt und knapp vor dem Pessach-Fest hingerichtet. Gleich Zeitig mit ihm wurde ein anderer prominenter Guerilla gefasst: Bar Abbas, und der dürfte beliebter gewesen sein jedenfalls verlangte das Volk seine Begnadigung, und Jesus musste sterben. Dann wurde Jesus zum Symbol für alle Unterdrückten des römischen Imperiums. Von allen Gruppierungen des Riesenreichs waren die Christen extreme Linke. In allen Erlassen der Cäsaren wurden sie als Radikale bezeichnet und als Anarchisten Jesus hatte doch gesagt, sein Reich sei nicht von dieser Welt, und daher hatte es auf ihr auch kein Reich zu geben. Und zumindest Roms Bevölkerung hielt die Christen auch für Terroristen: Sie glaubte Nero, als er denen die Schuld am Rande Roms zuschob, wie auch später die Deutschen Göring glaubten, dass die Kommunisten den Reichstag eingeäschert hätten. Erst nach Jahrhunderten arrangierte sich das Christentum mit der Staatsmacht, unter Kaiser Konstantin, und noch viel später wurde es offizielle Staatsreligion, nach dem Motto: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers und Gott, was Gottes ist. Doch sollte Jesus diesen Satz je gesagt haben, dachte er mit Sicherheit nicht an Kirchensteuer und Militärgottesdienste.
Der Sündenfall des Christentums war die bedingungslose Ehe mit dem Staat. Kaiser und Kirche wurden fett dabei, doch die Welt zum Lotterbett dieser lasterhaften Verbindung - christliche Moral als kritische Instanz gegen Auswüchse der Staatsmacht fand nicht statt, und daher mussten sich später sämtliche revolutionäre Bewegungen gegen die Kirche des einstigen Revolutionärs Jesus richten. Mohammed kannte das Christentum, und wir können annehmen, dass er auch diese Problematik genau analysiert hat. Allerdings war der Islam nie eine revolutionäre Bewegung sondern von Anfang an auf Macht ausgerichtet. Die einzige Frage die Mohammed interessierte, war wem die Macht des Islam zugute kommen sollte. Und da fand Mohammed als Antwort: allen Gläubigen. Der Islam war stets eine elitäre Bewegung. Äußerlich entstand er aus einer kaufmännischen Genossenschaft die einfach besser organisiert war als andere und somit - nach der schlichten Moral der Ökonomie - in jeder Hinsicht besser war. Die Religion Islam übernahm dieses Selbstverständnis: Der Glaube an Allah war einfach der beste, seine Gläubigen daher die besten Menschen der Erde und geradezu berufen als Herrenmenschen alle Ungläubigen zu beherrschen und zu verachten. Die daraus entstehende Überheblichkeit bestimmt heute noch die arabische Außenpolitik. Untereinander aber und vor Gott waren alle Gläubigen gleich der Prophet selbst natürlich ausgenommen. Aus dieser Ausnahme ließ sich natürlich leicht eine Regel ableiten. Schon beim Tode des Propheten waren einige gleicher als die anderen. Plötzlich spielte eine Rolle, wer sich wann zum Islam bekehrt hatte und wer vielleicht gar mit dem Propheten verwandt war. Die alten aristokratischen Prinzipien, die Mohammed eigentlich abschaffen wollte feierten fröhliche Urständ und sogar dynastische Überlegungen wurden plötzlich wichtig. Genau dadurch wurde der Islam des Propheten verraten. Und so kurze Zeit brauchte der Islam, diese Schere zwischen Theorie und Praxis zu öffnen, dass vielen Historikern dieser Angelpunkt gar nicht auffiel. Wie selbst-verständlich nahmen sie hin, dass das Kalifat stets mit verwandtschafts-rechtlichen Argumenten beansprucht wurde, obwohl es seit Abu Bekrs Zeiten immer Muslims gab die auf die Frage wem das Kalifat gebühre, Mohammeds klassische Antwort gaben: "Dem frömmsten der Gläubigen, dem besten.
Mit der Machtausweitung des Islam wuchs grotesker weise auch das kleinkarierte Stammesprinzip, und so kam es nie zur Herrschaft der Gläubigen über die Welt, sondern stets nur zum Regime von Angehörigen eines mit dem Propheten angeblich verwandten Stammes über die Gläubigen. Spätestens mit Omar hatte .der Islam aufgehört, eine vorwärtsstürmende Religion zu sein, und war zu einem imperialistischen Staat geworden, der zum Zweck seiner eigenen Erhaltung stets neue Kolonien erobern musste. Denn die frisch eroberten Gebiete ließen sich nie allzu lange reichlich ausbeuten: Es war zu einfach, sich zum Islam zu bekehren, zumal man dadurch der erhöhten Steuer entkam. Es waren meist irdische Überlegungen, die unterworfene Völker an Allah glauben ließen aber jeder neue Gläubige bedeutete einen Verlust für die Staatskasse die schon mit Omar ein Fass ohne Boden geworden war. Allen Ernstes versuchte daher schon Osman, etwas gegen den Zustrom von Gläubigen zu unternehmen: Er erließ die Verordnung, dass auch Neubekehrte zumindest zwei Jahre lang die für Ungläubige geltenden Steuern zu bezahlen hätten - eine Perversion des ursprünglichen Missionsgedankens. Mit Osmans Regierung und erst recht seiner Ermordung änderte auch das Kalifat seine Bedeutung: es war nicht mehr die von Allahs Gnade gelenkte Führung der Gläubigen, sondern nackte Staatsmacht um die zu kämpfen es lohnte, weil sich ihr Besitz auch in bar bezahlt machte. Von nun an war das geistliche Amt den Kalifen ziemlich egal. Was zählte war die irdische Herrschaft. Sechs Tage nach Osmans Ermordung wurde in Medina Ali zum Kalifen gewählt und viele Gläubige fanden das sei auch an der Zeit gewesen. Ali der knabenhafte Getreue der ersten Stunde, der mit der Leidenschaft eines Pubertierenden an seinen Propheten geglaubt hatte, als noch jeder Vernünftige über ihn lachte der mit vierzehn schon zu seinem Stellvertreter ernannt wurde und dennoch außer der Lieblingstochter Mohammeds nie etwas davon gehabt hatte und wie seine Ehegeschichte zeigt auch davon nicht viel... Spät aber doch war Ali Kalif geworden. Viele fanden auch, es sei schon zu spät.
Denn Ali war nun schon fünfundfünfzig, ein gestandener Mann mit behaarter Brust, auffälligem Hängebauch und leuchtender Glatze und seine langjährige Abstinenz von politischen Geschäften hatte ihn bei den Muslims außerhalb von Medina ziemlich in Vergessenheit gebracht. Nicht einmal in Medina glaubten viele, Ali sei nach dem Desaster seines Vorgängers der genau richtige Kalif Ali galt zwar als unbestechlich, moralisch einwandfrei gutmütig und tapfer, aber auch als herzzerreißend naiv und häufig unklug. Seit vielen Jahren wurde er "der Löwe des Propheten" genannt, und dieses Tier ist bekanntlich stark und wild, doch seine Geisteskräfte halten mit den körperlichen keinesfalls Schritt. Sein verstorbener Onkel Abbas hatte ihm einmal vorgehalten: "Wenn ein Ratschlag klug ist, ist das für dich schon ein Grund, ihn nicht zu befolgen." Seine verstorbene Gemahlin Fatima hatte ihn einmal öffentlich in der Moschee blamiert: "Zwischen Herz und Hirn besteht, bei dir keine Verbindung." Und Mohammed selbst hatte einmal gemeint: "Wo seine Liebe hinfällt, wächst kein Gras mehr. Er hat die Behutsamkeit eines Amokläufers." All das sind natürlich keine Tugenden für einen Kalifen, und Ali war außerdem noch Moralist: Er fieberte geradezu von Moral der aller schlimmsten Untugend jedes Realpolitikers. Dafür ragt Ali wie ein gerader grober Klotz aus dem Intrigengewebe orientalischer Geschichte, volkstümlicher als selbst Omar. Noch heute ist im gesamten Orient die Bezeichnung Ali gleich bedeutend mit: guter Kumpel. Der war Ali in jeder Beziehung: Gleich bei seinem Amtsantritt räumte er die Staatskasse aus. Des Islam größter Schatz sind die Worte des Propheten. Sein Gold gehört den Armen erklärte er und befahl die Kassenschränke zu öffnen. Allen Ernstes hoffte er nur Bedürftige würden zulangen und auch die nur so viel wie sie unbedingt brauchten. Ali glaubte an das Gute im Menschen. Das war zwar löblich, aber dumm von nun an blieb die Staatskasse leer und das wurde Alis Verhängnis. Sein schlimmster Fehler aber war, stets auszusprechen, was er dachte und damit hatte er sich seine unversöhnlichste Feindin geschaffen: Aischa die Witwe des Propheten.
Die Geschichte lag schon vierzig Jahre zurück, doch Aischa hatte nach dem Urteil sämtlicher Zeitgenossen ein Gedächtnis wie ein Kamel, und das vergibt bekanntlich niemals. Dabei liest sich, was sich im Jahr 626 im Haushalt des Propheten begab, in den Memoiren Aischas wie eine ganz harmlose Geschichte: "Sooft Mohammed eine Reise machte, loste er zwischen seinen Frauen, welche ihn begleiten dürfe. Beim Feldzug gegen den Stamm Musstalik war ich seine Begleiterin. Bei solchen Gelegenheiten wurde immer mein Kamel vorgeführt und meine Sänfte daneben gestellt. Sobald ich eingestiegen war, hoben die Diener meine Sänfte auf das Kamel und führten es an einem Strick hinter dem Propheten her. Bei der Rückkehr aber, kurz vor Medina, merkte ich beim Einsteigen, dass ich meine Kette aus Dhafari-Muscheln verloren hatte. Ich stieg also aus und suchte sie, bis ich sie gefunden hatte. Mittlerweile aber hoben meine Diener die Sänfte auf das Kamel, ohne zu bemerken, dass sie leer war." Darüber dürften sich schon damals Gläubige gewundert haben denn Aischa fügte sicherheitshalber hinzu: "Damals aßen die Frauen noch kein Fleisch und waren daher leicht wie Federn." Seltsamer noch war was weiter geschah: "Als ich zurückkam, sah und hörte ich niemanden mehr. Ich hüllte mich also in mein Tuch und setzte mich nieder denn ich dachte, man werde mich schon suchen. Da kam Safwan vorüber. Er kannte mich noch aus der Zeit, wo wir Frauen noch keinen Schleier trugen, und rief: "Gattin des Gottgesandten, was machst du denn hier?" Ich gab ihm keine Antwort. Da führte er sein Kamel vor und trat selbst zurück, bis ich aufgestiegen war. Dann führte er mich eilends nach Medina. Obwohl er lief, kam er jedoch erst am Nachmittag nach den Truppen dort an. Kurz darauf erkrankte ich, so dass mir nichts von dem bösen Gerede der Leute zu Ohren kam." Gerede gab es in der Tat denn schon bei der Ausreise hatte Aischa ihre Muschelkette vergessen und auch da war Safwan in ihrer Nähe gewesen. Eigens für Safwan hatte Allah seinem Propheten sogar eine Sure geoffenbart (33/5): "Gläubige betretet die Häuser des Propheten nicht, wenn ihr nicht zum Essen geladen seid, und dann wartet dort nicht, bis das Mahl zubereitet ist, sondern kommt erst, wenn ihr gerufen werdet.
Sobald ihr gegessen habt, entfernt euch und schwatzt nicht mehr, denn dies belästigt den Propheten. Und habt ihr unbedingt etwas mit seinen Frauen zu besprechen so redet nur durch einen Vorhang - dies erhält euer und ihr Herz reiner." Mohammed war nämlich krankhaft eifersüchtig und auf Aischa ganz besonders. Und die Geschichte mit Safwan gefiel ihm gar nicht. Er schickte Aischa zu ihren Eltern offiziell um sie dort gesund pflegen zu lassen. Dann erkundigte er sich bei allen Bekannten, wie sie über die Geschichte dächten. Drei meinten sofort wenn Aischa nur das Kamel geritten hätte, wäre die ungeheure Verspätung beim Einzug in Medina schwer erklärlich. Daraufhin ging Mohammed in das Haus Abu Bekrs, um noch einmal ernsthaft mit Aischa zu reden. Er traf sie in Tränen aufgelöst - angeblich hatte ihr Mama erst kurz zuvor vom Verdacht des Propheten erzählt. Mohammed konnte Tränen im allgemeinen nicht sehen. Diesmal aber gab er sich streng und fragte seine beiden Begleiter ob auch sie Aischa für eine Ehebrecherin hielten. Der erste sagte sofort: "Gesandter Gottes, wenn eine Frau so weinen kann, weigere ich mich zu denken". Der andere war Ali, und der sagte: "Wenn dem so ist, haben auch andere Mütter schöne Töchter. Ich würde lieber einmal ihre Diener zu der Sache befragen". Das verzieh Aischa nie. Für sie selbst ging die Geschichte allerdings gut aus. Kurz darauf, schreibt Aischa fiel der Prophet in Ohnmacht wie dies gewöhnlich vor seinen Offenbarungen der Fall war. Wir hüllten ihn in sein Gewand und legten ein ledernes Kissen unter seinen Kopf. Ich war dabei völlig ruhig, denn ich wusste, dass Gott mir recht geben werde. Meine Eltern aber machten sich gegenteilige Sorgen bis der Prophet zu sich kam. Als Mohammeds Bewusstsein wiederkehrte, setzte er sich aufrecht und trocknete seinen Schweiß, der an ihm niederfloss, obwohl es Winter war. Dann sagte er: "Freue dich, Aischa, Gott hat mir deine Unschuld geoffenbart." Sofort ging er dann in die Moschee und tadelte alle Leute, die seiner tugendhaften Gattin und dem nicht weniger herrlichen Safwan Vorwürfe gemacht, und verkündete die vierundzwanzigste Sure. Die bestimmte unter anderem, dass für jeden Ehebruch vier Zeugen beigebracht werden müssten und dass jeder mit achtzig Peitschenhieben rechnen müsse der so was fälschlich behaupte.
Nun saß Aischa im Harem der Prophetenwitwen und nahm übel, dass ausgerechnet Ali Kalif wurde. Sie war nun schon Mitte der Vierzig und keinesfalls mehr leicht wie eine Feder, sondern um Taille und Hüften arg aus dem Leim gegangen. Dennoch war sie attraktiv: Ihre riesige Staatspension hatte auch sie nicht für Schmuck und Schminke ausgeben können, und da Omar das Ruhegehalt in ihrem Fall auch rückwirkend berechnet hatte, war ein ganz schönes Vermögen zusammengekommen. Dies war sie bereit, in den Sturz Alis zu investieren. Nun suchte sie geeignete Bundesgenossen. Ihre Wahl fiel auf die Garnisonskommandanten von Kufa und Basra auf die Herren Talha und Az Zubair. Besser hätte sie's auch gar nicht treffen können. Beide wären selbst nämlich gern Kalif geworden, und beide hielten sich auch gerade in Medina auf. Denn auch sie hatten Osman in seinem Haus mit belagert. Schnell wurden die drei einig: Ali muss mit Waffengewalt aus der Welt geschafft werden. Und dann verlieh sich das Trio einen historischen Vereinsnamen: Triumvirat, ungeachtet der Tatsache, dass der dritte Mann eine Frau war. Aischa hatte in diesem Bund das Kommando - schließlich lieferte sie das Kapital. Sie versuchte sogar, für die böse Sache auch aus den Sparstrümpfen der übrigen Prophetenwitwen größere Beträge flüssig zu machen, doch da kam sie schlecht an: "Eine Frau gehört ins Haus. Kriege sind Männersache und auch als solche schon eine Dummheit", erklärten einstimmig die übrigen Damen. Heimlich, still und leise reiste das Triumvirat aus Medina ab. Erst aus sicherer Entfernung erklärten die drei Ali den Krieg, und dies mit einer besonders pikanten Devise: "Rache für Osman. Rache an Ali, der seine Mörder deckt". Etwas Originelleres hätte ihnen wahrlich nicht einfallen können. Ali selbst hatte nur einen einzigen begnadigt der bei dem Schlachtfest dabei war: Mohammed Ben Bekr. Der hatte angeblich den Leichnam mit einem Speer durchbohrt und Ali meinte, wenn jemand Grund zu Rache an Osman gehabt habe, sei dies Mohammed Ben Bekr gewesen, schon allein aufgrund des seltsamen Kalifen-Briefes, der sein Todesurteil hätte sein können.
Mohammed selbst hatte bei dem Verfahren ausgesagt, seine Schwester habe ihn zu der Wahnsinnstat aufgestachelt, und die war niemand anderer als Aischa. Dass Talha und Az Zubair so großes Interesse daran gehabt hätten, Osmans Leben zu retten, wie sie nun behaupteten, glaubte auch niemand ernsthaft: Zwar waren sie vor des Kalifen Haus gesehen worden, aber nur als besonders wüste Schreihälse und Hetzer. Aischa sah darin keinen Widerspruch: "Natürlich habe ich Osmans Tod gefordert, aber da hatte er seine Fehler noch nicht bereut. Als er dann erschlagen wurde, wird es ihm schon leid getan haben. Damit aber war sein Mord Sünde. Als Mutter aller Gläubigen habe ich das Recht, Blut zu fordern oder die Rache dafür, alles zu seiner Zeit." Nicht so leicht war die Frage zu beantworten, von wo aus das Trio seinen Krieg beginnen sollte. Aischa hatte an Muawia gedacht, Osmans Cousin und Statthalter in Syrien von Blut und Charakter unser natürlicher Bundesgenosse. Doch Muawia hatte seine eigenen Pläne und wollte vorerst in Syrien Ruhe haben. Höflich, aber bestimmt ließ er die drei abblitzen. So machte sich das Triumvirat auf den Weg nach Basra. Unterwegs kam noch ein neuer Bundesgenosse dazu: der Statthalter von Jemen. Kurz vor Osmans Tod waren seine Bücher geprüft und bedenklich befunden worden. Daraufhin hatte ihn Ali abgesetzt, und mit vierhundert Kamelen und der Staatskasse Südarabiens begab sich der seines Postens Enthobene zu Aischa. Sie jubelte: "Nun schwimmen wir in Geld - da können wir auch bald in Blut schwimmen." Ali machte unterdes Kassensturz in Medina, und dabei kam nicht viel heraus. Alis Großzügigkeit hatte die Reserven der Zentralbank auf ganze zwanzig Mark schrumpfen lassen, und damit konnte man bei bestem Willen keine Armee aufstellen. Hilfesuchend wandte sich Ali an Abdallah, den Sohn des Abbas, und der wusste Rat. Ali sollte Schulden machen, und seine Schuldscheine sollten bis zu ihrer Fälligkeit durchaus auch als Zahlungsmittel gelten. Diesmal und ganz gegen seine sonstige Gewohnheit befolgte Ali den Ratschlag. So kam es dass anlässlich des ersten Bürgerkrieges in der Geschichte des Islam ein Papier erfunden wurde, das sich seitdem auch in Friedenszeiten bewährt hat: der Wechsel.
Der erste Krieg von Muslims gegen Muslims begann wie jede andere Wahnsinnstat: Beide Parteien beteuerten, dass sie keinesfalls den Krieg wollten, und Ali sogar glaubwürdig, denn er versuchte buchstäblich bis zur letzten Minute zu verhandeln. Die Lage war total verfahren. Aischa, Az Zubair und Talha saßen in Basra, Ali lagerte mit einer schnell angeworbenen Armee davor, und beide Seiten konnten sich nicht einmal auf ihre eigenen Leute verlassen. Je länger beide Parteien von Verhandlungen sprachen, desto explosiver wurde die Atmosphäre. Schließlich war es ein Friedenswilliger, der den Ausbruch des Kampfes beschleunigte, und auch er hieß Osman. Osman Ben Honeif war zweiter Statthalter von Basra und hatte während der Abwesenheit Az Zubairs die Geschäfte geführt. Dabei machte er sich in Basra mehr Freunde als sein Boss, und nun glaubte er, Friedensrichter spielen zu können. Er ließ Aischa und ihre Truppen in die Stadt, sorgte aber dafür, dass sie sich dort nicht allzu breit machten, und als Alis Armee in Sicht kam zog er mit seinen Truppen aus Basra und erklärte: Eher werde er sich mit dem Kalifen prügeln, als es zum Kampf zwischen dem Fürsten der Gläubigen und der Mutter der Gläubigen kommen zu lassen. Ali grollte schlug aber sein Lager vor Basra auf und harrte dort der weiteren Dinge, während Osman Ben Honeif nach Basra zurückkehrte und dort auf dem Basar verkündete Frauen gehörten in den Harem und keinesfalls zur Armee. Die Bevölkerung applaudierte, und nun grollte auch Aischa. In der folgenden Nacht ließ sie Osman Ben Honeif greifen und ihm Bart, Augenbrauen Haupt- und sogar Schamhaar scheren. So gerupft schickte sie den Statthalter in Alis Lager, und der er kannte ihn nicht wieder. Daraufhin grollte die Bevölkerung von Basra. Aischa und ihre Truppen waren in der Stadt nicht mehr sicher. Nun schlugen auch sie ihr Lager vor den Stadtmauern auf, genau gegenüber von Ali. Eine perverse Situation: Über beiden Lagern flatterte die grüne Fahne des Propheten. Aischa und Ali fanden dies peinlich. Jeder schlug dem anderen vor, eine neue Farbe zu wählen. Natürlich gab niemand nach. In einem anderen Punkt allerdings wurde Einigkeit erreicht: Beide Parteien sollten alle Krieger entlassen, die Osman zu Medina belagert hatten.
Ali hielt sich daran, und plötzlich standen fünfhundert Krieger zwischen den Fronten. Sie ergriffen die Initiative: Zuerst machten sie einen kleinen Überfall auf Aischas Lager, dann sprengten sie in das Alis und schrieen: "Die anderen kommen!", und dann machten sie sich aus dem Staub, während beide Lager zur Schlacht rüsteten. Jede Armee zählte etwa zwölftausend Mann, doch wir können annehmen, dass auf jeder Seite nur etwa dreitausend Soldaten tatsächlich kämpften: Wer einen Blutsverwandten auf der anderen Seite hatte, war vom Kampf befreit, und damit fielen allein fünftausend Mann aus Medina aus. So ungeheuer blutig, wie sie in den Geschichtsbüchern geschildert wird, dürfte die "Schlacht des Kamels" nicht gewesen sein, die vor den Mauern Basras zwei kalte Dezembertage lang tobte. Ihren Namen bekam sie durch Aischas Kamel. Die Dame hatte sich nicht nehmen lassen, persönlich auf dem Schlachtfeld zu erscheinen, und dazu ließ sie das berühmteste Kamel Arabiens satteln. Es hieß Asker und hatte nach heutiger Währung siebentausend Mark gekostet zwanzigmal soviel wie ein Normalmodell. Dafür war es aber auch der Rolls-Royce der Wüste wesentlich größer als sämtliche Artgenossen und von strahlend weißem Fell. Davon allerdings war die Schlacht über nicht viel zu sehen: Gegen eventuelle Pfeilschüsse wurde das Tier so dick mit Matratzen gepanzert dass es kaum mehr gehen konnte und auf seinem Rücken schwankte ein weiterer Matratzenturm, Aischas Sänfte. Gerechterweise sollte man die Schlacht nicht nach dem Kamel benennen, sondern nach Moselma einem Jüngling, über dessen Vorgeschichte nichts bekannt ist. Wir wissen von ihm nur, dass er etwa zwanzig Jahre alt war, schwärmerische Augen und ellbogenlanges Haar hatte. Und dass er den Kampf um jeden Preis verhindern wollte. Einen Koran in der rechten Hand, stellte er sich zwischen die Fronten und schrie, es sei doch jeder Krieg wahnsinnig und erst recht dieser. Ein Krieger aus den Truppen Aischas schlug ihm die rechte Hand mit dem Koran ab. Moselma nahm das heilige Buch in seine Linke und schrie weiter. Aufhören! Aufhören! Da wurde ihm die linke Hand abgeschlagen. Moselma nahm den Koran zwischen die Armstümpfe, presste ihn an seine Brust und schrie, bis ihm auch der Kopf abgeschlagen wurde.
über seinem Leichnam begann die Schlacht. Moselmas kurzer Auftritt aber blieb unvergesslich: Gläubige, die am Koran bis zu, letzt festhalten, heißen nach ihm Muslims oder Muselmanen. Ebenso wahnsinnig, wie sie begonnen hatte verlief die ganze Schlacht. Da die Feldzeichen auf beiden Seiten dieselben waren, konnte niemand so recht zwischen Freund und Feind unterscheiden. Auch Ali nicht, der einfach jeden niederschlug, der ihm in den Weg kam, und dazu Gott ist groß rief. Angeblich über vierhundert Mal, und mit Sicherheit erlegte er dabei auch zwei seiner eigenen Offiziere. So endete der erste Schlachttag unentschieden. Um für den nächsten Tag dasselbe Chaos zu vermeiden befahl Ali, auf seine Feldzeichen zusätzlich ein weißes Band zu hängen. Aber auch dies half nicht: Groteskerweise war Aischa auf dieselbe Idee gekommen. So entschieden schließlich Talha und Az Zubair die Schlacht. Helden aber waren sie nicht: Heimlich versuchten sie sich mit der Kasse aus dem Kampfgebiet abzusetzen, wurden aber entdeckt und erschlagen. Wie ein Lauffeuer sprach sich die Geschichte auf dem Schlachtfeld herum und demoralisierte Aischas Truppen. In hellen Scharen liefen sie davon, und schließlich drängten sich etwa einhundertzwanzig Getreue um ihr Kamel auf den Feldherrnhügel. "Wir schützen das Kamel", war ihr Schlachtruf. Alis Truppen marschierten geschlossen gegen den Haufen. Aischas Kamel sah wüst aus: Panzer und Sänfte waren mit Pfeilen gespickt wie ein Igel, das Zaumzeug hatten Aischas Mannen mit abgeschlagenen Köpfen und Händen dekoriert. Siebzig Mann sollen rund um das Kamel gefallen sein, ehe es einem Offizier Alis, Ammar, gelang bis unter das Tier zu kommen. Mit einem Dolch schnitt Ammar dem Kamel die Fußsehnen durch; schwer sackte es zu Boden und begrub Ammar unter sich. Auf dieses Zeichen hin flüchteten auch Aischas letzte Soldaten, und Alis Truppen hetzten ihnen nach. Während die Geier über dem Schlachtfeld kreisten, stiegen Ali und sein Generalstab zu Aischas Feldherrnhügel hoch. Sie fanden das sterbende Kamel: einen Haufen Pfeil durchbohrter Matratzen und Leichenteile in mitten Erschlagener.
Mohammed Ben Bekr konnte sich nicht vorstellen, dass in der arg lädierten Kiste auf dem Tier noch Leben sei. Vorsichtig langte er durch das Guckloch und wurde kräftig in die Hand gebissen. Dann kreischte es aus der Sänfte: "Wer vergreift sich da an der Perle aus dem Harem des Propheten?!" "Der Bruder jener Schlampe, die den Harem des Propheten geschändet hat" brüllte Mohammed Ben Bekr zurück. Dann ließ Ali die Sänfte aufbrechen. Eine ziemlich derangierte Aischa kam ans Tageslicht und sagte, ganz würdevolle Prophetenwitwe: "Gut, du hast gewonnen. Aber jetzt zeige dich als anständiger Sieger." Ali behandelte sie tatsächlich mit Glacehandschuhen. Durch ein Ehrengeleit ließ er Aischa nach Basra bringen und wies ihr den schönsten Palast als Quartier an. Dort blieb Aischa fast eine Woche und weigerte sich störrisch, in den Harem nach Medina zurückzukehren. Drei Gesandte sollten sie überreden, doch jeden schickte sie unverrichteter Dinge weg. Mal hatte sie Migräne mal war sie aus anderen Gründen nicht reisefertig und als Ali selbst in das Haus kam, weigerte sie sich mit ihm auch nur zu reden. Da schickte Ali seinen Sohn Hasan. Aischa war gerade bei der Toilette und meinte, ungekämmt könne sie doch unmöglich auf die Reise gehen. Hasan fragte, wie lange sie denn für ihre Frisur brauche. Vielleicht fünfzig Jahre meinte Aischa. Da sprach Hasan ein ernstes Wort. Fünf Minuten später bestieg Aischa ihre Sänfte, sanft wie ein Täubchen. Halbgekämmt trat sie den Heimweg nach Medina an, von hundertzwanzig Sklavinnen begleitet aber auch von tausend Soldaten. Ihren Geschlechtsgenossinnen im Islam erwies sie mit ihrem Ausflug in die Politik allerdings einen üblen Dienst. Von nun an blieben die Frauen auf Harem Kinderkriegen und Küche gesetzt und durften nicht einmal mehr lesen und schreiben. Selbst heute noch müssen sich Befürworter der Frauenemanzipation in Arabien Aischa als warnendes Beispiel vorhalten lassen. Aber auch Hasan wurde sprichwörtlich: Pantoffelhelden wird seitdem empfohlen, sich von diesem energischen Kerl beraten zu lassen. Ali selbst sollte Medina nie wiedersehen. Noch während er sich in Mesopotamien huldigen ließ, erklärte ihm Muawia in Syrien den Krieg. Jahre später meinte Muawia: "Ali hatte gar keine Chance gegen mich. Er war ehrlich - ich war verschlagen. Er ließ seinen Soldaten zu viel Menschenwürde - bei mir mussten sie kuschen. Und schließlich hatte er im ersten Bürgerkrieg mitgekämpft. Aus dem Hass der Unterlegenen konnte ich mein Kapital schlagen." Dies ist möglicherweise der einzige wahre Satz den Muawia sein Leben lang gesagt hat denn nicht einmal seine fanatischen Anhänger konnten sich daran erinnern, ihn auch nur einmal bei einer Wahrheit ertappt zu haben. Muawia war ein Meister der Demagogie und der Lüge der Bestechung Korruption und Intrige, und diese Tugenden reichten aus ihn zu einem überragenden Staatsmann zu machen. Erst beim Fall von Mekka, 630, trat er dem Islam bei und auch da nur sehr widerstrebend. Damals war er fünfundzwanzig der Erbe eines Riesenkonzerns nebenbei aber auch der führende Playboy in Mekkas Schickeria. Seine Familie war der des Propheten weitläufig verwandt, Ali sein Onkel zweiten Grades, aber die beiden Sippen konnten einander nie ausstehen. Während die Beni Haschem aus dem Islam das Reich Allahs auf Erden machen wollte sahen die Omaja den ihn stets nur als Mittel, ihren privaten Profit zu machen. Spätere Historiker sahen daher in der Beni Omaja die ersten Realpolitiker der arabischen Welt. Auf jeden Fall trifft dieses Urteil auf Muawia zu. Während Omars Kalifat organisierte Muawia in Mekka so lange eine Oppositionsbewegung bis er durchgesetzt hatte, dass ihm der Kalif eine Teilstatthalterschaft in Syrien übertrug. Die benützte er schamlos zur Vergrößerung seines Privatvermögens. Das investierte er wieder geschickt: Er finanzierte damit seinen Cousin Osman, und als der Kalif wurde, revanchierte er sich und machte Muawia zum Statthalter von ganz Syrien. Damit hatte Muawia bald sämtliche Auslagen wieder ersetzt samt Wucherzinsen denn er besteuerte Syriens Wirtschaft so gnadenlos dass er innerhalb von fünf Jahren der reichste Mann des Islam wurde. Sein Herz für das Volk entdeckte er erst, als Osman umgebracht wurde. Überraschend erließ er eine fünfzigprozentige Steuersenkung und wurde damit über Nacht zum Volkshelden.
Zwei Wochen später brachten Kuriere aus Medina ein Paket mit makabrem Inhalt: ein blutverkrustetes Stück Leinen, an dem noch drei halbverweste Finger hingen Osmans letzten Mantel. Es ist nicht bekannt ob Muawia klassisch gebildet war aber er dürfte eine der berühmtesten Geschichten des alten Rom gekannt haben nämlich wie Marc Anton dem römischen Volk Cäsars Mantel zeigte und es da mit zum Bürgerkrieg aufwiegelte. Genau das tat auch Muawia. In der halb Moschee gewordenen Johanneskirche ließ er Osmans blutigen Kaftan ausstellen und erzählte selbst dem versammelten Volk dass niemand anderer als Ali seinen armen lieben, guten Vorgänger grausam ermordet habe. Da sich in der Geschichte manches wiederholt, wirkte diese Aktion auch diesmal. Vor allem aber gewann Muawia einen Bundesgenossen, der sich ebenfalls einen Namen gemacht hatte: Amru. Im Januar 657 erklärten die beiden Ali den Krieg, und Muawia nahm den Titel Kalif an. Dann warben beide ein großes Heer an und warteten auf Ali. Der hatte Mühe, für den neuen Bürgerkrieg Soldaten zu bekommen. Die Schlacht des Kamels hatte ihm zwar viel Ehre eingebracht, der Staatskasse aber überhaupt nichts. Aischas Kriegskasse hatte gerade für den Sold seiner Truppen gereicht. Seine Wechsel, die ihm nun präsentiert wurden konnte er bereits nicht mehr bezahlen. Da half ihm noch einmal seine eigene Sippe mit einem größeren Kredit. Sogar Aischa fand sich bereit etwas gegen die Beni Omaja zu tun und pumpte ihm eine halbe Million Mark. Damit heuerte Ali rund zwanzigtausend Soldaten an und machte sich auf den Weg in den nächsten Bürgerkrieg. Von Kufa marschierte er den Tigris hoch bis Mossul denn dort sollten noch die persischen Steuergelder der letzten drei Jahre liegen. Sie hätten Ali aus der Klemme geholfen doch als er in Mossul ankam, wurde ihm mitgeteilt, die Gelder seien schon an den Kalifen geschickt worden zu Muawia nach Damaskus. Für Ali blieb kein Pfennig. Von nun an konnte er keinen weiteren Sold bezahlen. Einen halben Monat hatte Ali noch Zeit so lange galt der Tarif Vertrag seiner Soldaten. In Eilmärschen zog er nun quer durch Mesopotamien und über den Euphrat. An dessen anderem Ufer wartete bereits Muawia mit seiner hochbesoldeten Armee.
Am 29. Juli 657 kam es bei Siffin zur Schlacht. Alis Truppen wollten sich so kurz vor Dienstschluss nicht sonderlich anstrengen, und Muawias Truppen hatten sich vorgenommen, ihren Sold mit heiler Haut zu kassieren. Daher gingen sich beide Armeen lieber aus dem Weg als aufeinander los. Auch der nächste Tag hätte nicht anders geendet, wäre nicht Ali an der Spitze einer Kavallerieeinheit selbst vorwärts gestürmt. Fast hätte er dabei Muawias Lager überrannt, und nur die Abenddämmerung ließ den Kampf wieder unentschieden enden. Ali betete die ganze Nacht über Allah möge ihm den Sieg verleihen. Muawia saß währenddessen mit Amru zusammen, und die beiden berieten, wie ihre Niederlage zu verhindern sei. Der nächste Morgen brachte eine totale Überraschung für Ali: Muawias Soldaten hatten Koranbände auf ihre Lanzen gesteckt, und seine eigenen Truppen weigerten sich plötzlich gegen so ostentative Gläubige zu kämpfen. Und außerdem war ja schon der 31. Juli - in zwei Tagen sei ihr Vertrag ohnedies abgelaufen, und nicht einmal doppelte Solderhöhung könne sie dazu bewegen, einen so gotteslästerlichen Krieg weiter zu führen. Noch auf dem Schlachtfeld musste Ali mit Muawia einen Kompromiss schließen : Ein unabhängiges Gremium solle innerhalb von sechs Monaten feststellen, wer zu Recht Kalif sei. So lange sollten auch alle Waffen ruhen. Abgesehen davon, dass Ali mit diesem Kompromiss seine Ansprüche auf das Kalifat selbst in Frage stellte, beging er noch den entscheidenden Fehler die Wahl seines Verhandlungsbevollmächtigten ausgerechnet seinen streikenden Truppen zu überlassen und die wählten einen Mann namens Ebu Musa während Muawia ohne weitere Mitbestimmung Amru ernannte. Vor allem hielt sich Ali peinlich genau an den Vertrag zog sich nach Kufa zurück und hoffte dort innig auf neue Steuergelder, während Muawia an die siebenhundert Agenten mit Millionenbeträgen durch Arabien schickte um für seine Sache Stimmung zu machen. Pünktlich am 31. Januar 658 trat in Dschendel das Schiedsgericht zusammen. In geheimer Sitzung besprachen sich Amru und Ebu Musa. Ebu Musa meinte am besten sei wenn beide Bevollmächtigten ihre Kandidaten ablehnten, da beide in Bürgerkriege verwickelt gewesen seien. Amru stimmte begeistert zu und machte den Vorschlag, Ebu Musa solle zuerst reden, er werde dann dasselbe wortwörtlich wiederholen.
Die Moschee barst förmlich vor Gläubigen, als Ebu Musa und Amru als Bevollmächtigte eintraten. Ebu Musa bestieg die Kanzel und sagte: "Vom Propheten ist der Satz überliefert, nur der Würdigste sei des Kalifats würdig. Dies zu bestimmen sollte nach meiner Ansicht Sache des Volkes sein. Daher erachte ich weder Ali noch Muawia des Kalifats würdig. Ich möchte vorschlagen, beide abzusetzen und einen neuen Kalifen zu wählen." Darauf bestieg Amru die Kanzel: "Gläubige! Ihr habt selbst gehört, dass Ebu Musa seinen Herrn Ali des Kalifats entkleidet hat. Ich bin ebenfalls zu der Entscheidung gekommen dass Ali des Amtes nicht würdig ist. Für meinen Herrn Muawia aber kann er nicht sprechen - dazu fehlt ihm die Vollmacht. Und ich erkläre somit Muawia zum rechtmäßigen Kalifen. Er hat die Blutrache für Osman übernommen und wurde von diesem selbst, was sich erst jetzt herausgestellt hat, zu seinem Nachfolger bestimmt." Viel weiter kam er nicht - Ebu Musa wollte ihn von der Kanzel zerren. Es kam zu einer Massenprügelei in der Moschee, und dann reisten die Schiedsrichter ab, Ebu Musa beschämt nach Kufa und Amru triumphierend zu Muawia. Damit war der Bürgerkrieg im Islam Dauereinrichtung geworden. Die "Schwarze Hand" schlägt zu Noch im selben Jahr ernannte Muawia Amru Ben Aass zum Statthalter von Ägypten. Für den Dienstantritt nahm Amru eine große Armee mit denn Ägypten hatte bereits einen Statthalter: Mohammed Ben Bekr. Der saß in Fostat, der Verwaltungshauptstadt am Anfang des Nildelta. Aber Fostat war von Amru gegründet worden während seiner ersten ägyptischen Statthalterzeit und der alte Fuchs hatte dort noch viele Freunde. Daher schlug Mohammed aus Sicherheitsgründen sein Lager vor der Stadt auf und wartete dort auf die Hilfstruppen, die Ali ihm versprochen hatte. Tatsächlich marschierte aus Medina eine ansehnliche Streitmacht gegen Amru doch Muawias Agenten hatten auch sie schon unterwandert: ihr Kommandant Eschter bekam von seinem Koch vergifteten Honig serviert. Muawia erklärte daraufhin: "Allah hat auch im Honig Heere zur Vernichtung seiner Feinde. Wer sich daher seine Gnade erwerben will und nicht frühen Tod, schließe sich meiner Armee an, gegen doppelten Sold."
Er brauchte nicht lange zu warten. Die von Ali gegen Amru gemusterte Armee lief fast geschlossen zu Amru über, und nach verzweifelter Gegenwehr wurde Mohammed Ben Bekr geschlagen und gefangen-genommen. Amru ließ den Sohn des ersten Kalifen und Schwager des Propheten in eine Eselshaut einnähen und so an einer hohen Stange zwei heiße Tage lang auf dem Marktplatz von Fostat hängen. Am dritten Tag wurde aus Mohammeds von seinem Vater ererbter Bibliothek ein Scheiterhaufen geschichtet und er selbst darauf verbrannt - eine Hinrichtungsmethode, die unterlegenen Aufständischen gegenüber in islamischen Ländern bis zum Jahr 1856 praktiziert wurde. Mit nur einem kleinen Unterschied: Bücher wurden dazu nicht mehr verwendet. Ali, der sich nur noch auf die persischen Provinzen verlassen konnte, versuchte daraufhin einen Einfall in Syrien. Er kam nicht weit: Wie immer fehlte ihm das Geld zur Besoldung seiner Truppen. Die plünderten schließlich auf eigene Faust einige Dörfer und brachten sich und ihre Beute in Sicherheit. Muawia nahm dies zum Anlass gegen Medina, die Stadt des Propheten zu ziehen. Auf seinen ausdrücklichen Befehl wurde die Heimstatt des Islam geplündert und ein Viertel ihrer Bewohner erschlagen. Alis Selbstvertrauen erlitt damit einen tödlichen Stoss. Er weigerte sich eine neue Armee aufzustellen. "Ich habe dazu weder das nötige Geld noch die nötige Gnade Allahs" meinte er seinen Beratern gegenüber, und als aus Medina fast fünftausend Freiwillige kamen die für ihn notfalls auch umsonst kämpfen wollten, schickte er sie nach Hause: "Allahs Reich ist wohl nicht von dieser Welt. Wartet auf das Reich nach eurem Tod." Doch mit diesem Bescheid gaben sich nicht alle zufrieden. Noch in Kufa schworen sie: "Keine Herrschaft als die Gottes." Und damit erklärten sie beiden Kalifen als dritte Kraft den Krieg. Von den beiden Parteien Alis und Muawias wurden sie "Spalter" genannt, "Charidschiten" in Wahrheit aber waren sie die letzten gläubigen Muslims. Die meisten von ihnen hatten schon für Mohammed und sein Reich Allahs gekämpft - so aber hatten sie sich's nicht vorgestellt. Für die nächsten Jahrzehnte sollten die Charidschiten die Rigoristen des Islam bleiben: unerbittlich misstrauisch gegenüber der weltlichen Macht des Islam, fanatisch an den Vorstellungen Mohammeds festhaltend und somit die gefährlichsten Gegner aller die auf dem Feuer des Glaubens nur ihr eigenes Süppchen kochen wollten.
Während noch die meisten Charidschiten darüber diskutierten, wie denn der Wahnsinn des Bürgerkrieges am besten zu beenden sei, entschlossen sich drei zu handeln. Die Zeiten waren unsicher geworden, so unsicher dass sich auch viele Männer nur noch verschleiert auf die Strasse wagten. Aus Angst vor Mordanschlägen war in den Strassen der Hauptstädte des Islam unmöglich geworden zwischen Männlein und Weiblein zu unterscheiden: Gleich vermummt schlichen die Parteigänger Alis und Muawias durch die Strassen. Daher fiel auch nicht auf dass in einer Dezembernacht des Jahres 660 drei Vermummte fast gleichzeitig durch ein enges Haustor in Medina huschten. Dem Wächter vor dem Eingang zeigten sie nur kurz die rechte Hand - sie war in schwarze Farbe getaucht. Im Haus wartete eine verschleierte Frau. Sie wurde von den Eintretenden mit "Mutter der Gläubigen" angesprochen da sie aber den ganzen Abend lang schwieg, steht bis heute nicht fest ob es tatsächlich Aischa war. Die Namen der drei Männer sind überliefert: Barek at Temin ein angesehener General aus der ersten Armee des Propheten, Abdelrachman Ben Modschem, einst Sekretär Omars, und Amru. Der letztere aber war mit Amru Ben Aass absolut nicht identisch, sondern der jüngste Sohn Abu Bekrs und daher des anderen Amru erbittertster Feind. Vor der verschleierten Dame schworen sie ihre Hände nicht eher zu waschen, bis sie ihren Plan ausgeführt hätten, und dann baten sie die Dame, ihnen einen Tag zu nennen. Da tauchte aus dem Umhang eine Hand auf ebenfalls in schwarze Farbe getaucht, und schrieb ein Datum auf den Boden. Daraufhin verließen die drei Männer das Haus und brachen am nächsten Morgen in verschiedene Richtungen auf. Am zwanzigsten Januar wartete das Volk von Fostatrn der Moschee auf seinen Statthalter. Pünktlich um elf Uhr betrat er die Eingangshalle, eine majestätische Gestalt weiß verschleiert. Aus der wartenden Menge stürzte ein Verschleierter auf ihn zu. In dessen schwarzer Hand blitzte ein Dolch und traf den Eintretenden direkt ins Herz. Lautlos sackte der zusammen. In diesem Augenblick riss Amru Ben Bekr seinen Schleier vom Gesicht und schrie verzweifelt auf:
Der Schleier des Toten hatte sich verschoben und zeigte ein fremdes Gesicht. Amru hatte nicht Amru getötet, sondern seinen Stellvertreter. Amru Ben Bekr wurde noch in der Moschee umgebracht, und sterbend musste er hören, dass Amru Ben Aass an diesem Tag unpässlich gewesen sei. Zur selben Stunde stürzte sich Barek at Temin in der Moschee von Damaskus auf Muawia. Er traf schlecht, und Muawias Leibgarde ließ ihm keine Zeit mehr zu einem zweiten Hieb. Pech hatte nur, wie immer, Ali. Unverschleiert und pünktlich um elf Uhr betrat er die Moschee von Kufa. Abdelrachman Ben Moldschem spaltete ihm mit einem einzigen Schwertstreich das Haupt. "Allahu akbar", murmelte der Kalif ganz mechanisch, "Gott ist groß, wie er sonst immer gerufen hatte, wenn er jemandem den Schädel einschlug. Damit war genau das eingetreten, was die Charidschiten verhindern wollten: Nichts konnte den Islam mehr vor Muawia retten. In dieser Zeit kam ein neues Wort in den Islam, Kismet. Der Glaube, ein unabänderliches Schicksal stünde ohnedies von Anfang an fest, passte so recht in diese düstere Zeit. Fatalismus ist immer die Verzweiflungsfrucht enttäuschter Hoffnungen, und gerade die begeisterten Vorkämpfer des Islam mussten vor der blutigen Gegenwart resignieren. Sie zogen sich aus der Politik zurück in die Theologie, Stellten von nun an die Religion Islam gegen die Politik Islam und wurden damit die Keimzelle der Ulema, der Religionsgelehrten. Bislang waren die Kalifen auch die geistlichen Führer gewesen, und die Priester orientierten sich ebenso an ihnen wie die Krieger. Daher heißen Abu Bekr und Omar aber auch Osman und Ali noch heute die "richtigen Kalifen". Mit Muawia musste der Islam zerfallen, zunächst in reine Staatsmacht einerseits und Religion andererseits und später in logischer Folge in viele religiöse Gruppierungen. Von nun an war es undenkbar, dass ein Kalif wie einst Omar ohne Leibwache durch die Lande reisen konnte, denn das Kalifat war keine moralische Instanz mehr, sondern nur noch nackte Gewalt. Das war das Kismet des Islam, das unvermeidbare Schicksal. Schließlich soll der Prophet selbst auf seinem Totenbett gesagt haben: "Dreißig Jahre lang wird die Sache gut gehen, dann kommt die Tyrannei."
Mit Muawias Machtübernahme waren genau diese dreißig Jahre vergangen. Und am dreißigsten Todestag des Propheten, am 6. Juni 662, wurde Muawia auch seinen letzten Widersacher los. An diesem Tag resignierte nämlich Hasan, der Enkel des Propheten und Sohn Alis. Mit Fatima hatte Ali zwei Söhne gehabt, Hasan und Hussein. Sie waren die einzigen männlichen Nachkommen Mohammeds, und der hatte an den beiden Knaben einen Narren gefressen. Überallhin durften die Kleinen ihren Opa begleiten, und als dem Propheten zu Mekka gehuldigt wurde saß der kleine Hasan auf seinem Schoss. Bei der Ermordung seines Vaters war Hasan gerade siebenunddreißig Jahre alt. Noch in der Moschee, vor Alis Leiche, wurde ihm von den Garnisonen Kufa und Basra gehuldigt. Doch Hasan hatte ebenso wenig Geld wie sein Vater und konnte seine Soldaten auch nicht bezahlen. Nachdem er zweimal den Monatssold schuldig bleiben musste, wollten die Truppen den von ihnen ausgerufenen Kalifen lynchen. Hasan trat mit Muawia in Verhandlungen und erklärte sich bereit Muawia als Kalifen anzuerkennen. Seine Forderungen:
Die beiden ersten Punkte bewilligte Muawia anstandslos, den dritten verweigerte er. Ali wurde weiter verflucht. Außerdem aber sollte Hasan seinen Verzicht öffentlich verkünden. Folgsam bestieg Hasan die Kanzel in der Moschee von Kufa: "Versammelte Gemeinde. Allah hat euch und mich geleitet, und die Wege waren verschieden. Immerhin ist nun das Blutvergießen beendet. Ich habe mein Amt an einen abgetreten, der seiner nicht würdig ist. Von nun an soll das Unrecht recht behalten." Weiter kam er nicht. Amru Ben Aass, der für Muawia die Verhandlungen geführt hatte und in der Moschee dabei war, ließ ihn von der Kanzel zerren. Gut bewacht reiste Hasan am nächsten Morgen nach Medina ins Exil. Dort ließ ihn Muawia acht Jahre später vergiften.
Die Bevölkerung von Basra und Kufa aber trauerte Hasan bald nach, denn als Statthalter dieser Provinzen setzte Muawia "den blutigen Hurensohn Sejad" ein. Schon Sejads Ernennung war ein Skandal. Hatte nicht der Prophet Ehebruch zu einer Todsünde erklärt? Und Sejad war ein "Hurensohn", der Spross einer Straßennutte aus Taif. Sein Vater allerdings war Ebi Sofian, der letzte Bürgermeister Mekkas vor Mohammed und Vater Muawias. Unter dem Kalifat Alis war Sejad Provinzstatthalter in Persien gewesen. Mit Muawia arrangierte er sich unter der Bedingung dass sein Halbbruder ihn legitimieren ließe. Tatsächlich ließ Muawia einen betagten Bordellwirt aus Taif Anreisen, und der schilderte die Umstände von Sejads Zeugung so plastisch, dass er gleich danach an einer Straßenecke von Damaskus gefunden wurde einen Dolch im Rücken. Sejad aber wurde zum Statthalter von Alis Kernland ernannt und versprach dort "Recht und Ordnung wieder radikal herzustellen". Zunächst erließ er ein nächtliches Ausgangsverbot. So etwas hatte es im Orient noch nie gegeben, und das Volk von Basra wollte derlei auch gar nicht erst einreißen lassen. Es kam zur ersten Aktion gewaltlosen Widerstands in der Geschichte des Islam: Tagsüber blieb der Basar menschenleer, doch mit Einbruch der Dämmerung füllten sich die Strassen mit Menschen. So ließ sich Sejad nicht kommen. Am nächsten Morgen lagen in den Strassen von Basra eintausenddreihundert Erschlagene. Die Nacht darauf wurden noch einige hundert Tote gezählt, und in der dritten Nacht herrschte Grabesruhe. Der "Hurensohn" hatte sich durchgesetzt. Zehn Jahre lang verwaltete Sejad die Ostgebiete des Islam und sein Schreckensregiment gab Muawia genug freie Hand das übrige Reich nach seinen Vorstellungen umzumodeln. Die Stellung des Kalifen wurde präzisiert: Um zu zeigen, dass der Fürst der Gläubigen über den Gesetzen stand, blieb Muawia künftig beim Freitagsgebet der Chutba, sitzen. Zum Schutz vor Attentätern auf einem sehr hohen Stuhl, dem Vorläufer unserer Thronsessel.
Und in allen Moscheen der Welt sollte künftig im Freitagsgebet ausdrücklich der Name des Kalifen genannt werden damit wurde die Chutba gleichzeitig zur Erklärung der Machtübernahme und das islamische Wort für Thronbesteigung heißt wörtlich "die Chutba auf seinen Namen lesen lassen. Dann ließ Muawia die Kanzel des Propheten in Medina abbrechen und nach Damaskus bringen. In der Grossen Moschee wurde sie neu aufgestellt und bei dieser Gelegenheit um sechs Stufen erhöht. Damit war Damaskus zur Hauptstadt des Reichs erklärt und die eigentliche Heimat des Islam Provinz geworden. Mekka und Medina sollten in Zukunft nur noch als religiöse Pilgerplätze eine Rolle spielen. Vom Staat wurden sie wie Kolonien behandelt, und ein neues Karawanengesetz beraubte die arabische Halbinsel ihrer wichtigsten Wohlstandsquelle - nie wieder sollte der internationale Warenverkehr durch die Wüste ziehen. Der Islam hatte seine Heimat vergessen. In nicht einmal dreißig Jahren war aus der Wüste eine Weltmacht gekommen, doch ihre Mutterstädte sollten nichts davon haben. Während der nächsten Jahrhunderte, während die islamische Kultur ihren Höhepunkt erreichte und das christliche Abendland von den Brocken lebte, die vom reichen Tisch des Propheten fielen sank der Lebensstandard auf der arabischen Halbinsel stetig und unaufhaltsam. Bald erschienen sogar die übelsten Zeiten vor Mohammed wie ein goldenes Zeitalter, verglichen mit der schlimmen Wirklichkeit. Während das Kalifat in aller Welt zu einer anerkannten Supermacht wurde, traten in Arabien die vor-islamischen Zustände in ihr alteingesessenes Recht: Hier herrschten wieder die Stämme und sorgten ständige Stammesrivalitäten dafür dass es keinem zu gut ging. Und so sollte es bis in unsere Gegenwart bleiben. |
|
Der arabische Wahnsinn
|
|
|
Der Coup
Einen wüsteren Scherz hat sich die Geschichte nie wieder geleistet: Ausgerechnet Muawia, zusammen mit seinem Vater Ebi Sofian der letzte und hartnäckigste Gegner Mohammeds, trug nun rechtmäßig den Titel "Nachfolger des Propheten". Die bei der Gründung des Reiches den erbittertsten Widerstand geleistet hatten waren nun seine Herren, die Feinde des Islam "Beherrscher aller Gläubigen".
Nüchtern gesehen ist Muawias Machtübernahme ein einsamer Geniestreich. Buchhaltung kennt keine moralischen Stellenwerte, und vom Standpunkt der Geschäftspolitik gesehen lagen die Verhältnisse klar: Die Beni Omaja war mit dem Auszug Mohammeds aus Mekka das markt- und stadtbeherrschende Unternehmen geworden. Im gesamt arabischen Raum musste es dem Islam schließlich unterliegen und, getreu der Monopol-Politik Mohammeds, im größeren Konzern aufgehen. Das Management der aufgesaugten Firma erhielt neue Posten, aber es war doch logisch dass es versuchen würde, den Gesamtkonzern einmal so in den Griff zu bekommen, wie es seinen eigenen beherrscht hatte. Nichts anderes hatte Muawia getan, und nach allem, was wir von ihm wissen, hat er den Islam auch nie als Religion gesehen, sondern immer nur als das Geschäft des Propheten. Dass diese Geschäfte sich des Vehikels Religion so erfolgreich bedienten, amüsierte ihn nur.
Insgeheim dürfte der geistliche Führer des Islam Atheist gewesen sein und in seiner Verwaltung beschäftigte er fast ausnahmslos Christen. "Araber wollen immer so unabhängig sein und Muslims leider erst recht. Christen aber sind herrschaftsgläubig wie Schosshündchen" meinte er einmal als er auf die vielen Christen in seinem Hofstaat angesprochen wurde. Muslims aber ärgerten sich eben sosehr über Muawias Vorliebe für Christen wie für Hunde: Gemeinhin betreiben im Orient Hunde und Schweine die Straßenreinigung und gelten als unreine Tiere.
Ausgerechnet Christen arbeiteten für Muawia auch ein Konzept aus, nach dem er seinen Frieden mit der Religion machen wollte. In allen Moscheen wurden nun Geschichten aus dem Leben des Kalifen erzählt. Muawia sei nie ein Gegner des Propheten gewesen, sondern vielmehr ein Getreuer der, ersten Stunde. Ja, er sei sogar Mohammeds Geheimschreiber gewesen, und der Prophet habe ihm und nur ihm den Koran eigenmündig diktiert.
Manche Muslims glaubten diese Geschichte tatsächlich, obwohl Aischa in Medina erklären ließ, dass Muawias Tätigkeit. beim Propheten so geheim gewesen sein müsse dass sie selbst bis zur Stunde nichts davon wusste. In der Moschee von Medina schwor sie, dass ihr keiner der für Muawia so schmeichelhaften Aussprüche des Propheten bekannt sei, für die Muawia ausgerechnet sie als Zeugin benannt hatte. Es war der letzte öffentliche Auftritt der Prophetenwitwe. Von nun an verbot ihr Muawia, das Haus zu verlassen. Sie durfte das Grab ihres Gemahls nicht mehr besuchen und auch keinerlei Besuche mehr empfangen. In der Öffentlichkeit durfte sie nicht mehr "Mutter der Gläubigen" genannt werden, sondern nur noch "Mutter des Bürgerkriegs". Zweimal trat Aischa aus Protest gegen den Hausarrest in Hungerstreik doch Muawia ließ ihr ausrichten, er freue sich nur auf ihren Tod. Daraufhin beschloss Aischa, aus Trotz weiterzuleben. Sie starb schließlich im Jahr 679, dem siebenundfünfzigsten nach der Hidschra, eine verbitterte alte Frau, unförmig geworden durch Kummer und Zuckerwerk.
Nach ihrem Tod tat ihr Muawia noch einen letzten Tort an: Er ließ Aischas Memoiren umschreiben und genau jene Geschichten einfügen, die Aischa selbst als Lügen Muawias bezeichnet hatte.
Pikanter weise waren es auch griechische Christen, die Muawia zum Krieg gegen Konstantinopel rieten. Dieses außenpolitische Muskel zeigen hatte ausschließlich innenpolitische Gründe: Muawia konnte sich so als würdiger Nachfolger Abu Bekrs und Omars präsentieren, der den "Krieg gegen die Ungläubigen" auf seine Fahnen schrieb wie einst die Gefolgsleute des Propheten. Und vor allem spekulierte Muawia darauf, dass ein gemeinsamer äußerer Feind am besten die Brüche im Islam kitten würde.
Bereits 662 ließ er einige Raubzüge auf byzantinisches Territorium unternehmen. Ein Jahr später überfiel die islamische Flotte Sizilien. Sehr erfolgreich dürfte dieser "glorreiche Seekrieg" nicht gewesen sein, denn die angeblich so riesige Streitmacht des Islam griff keine einzige der großen Handels- und Hafenstädte an, sondern begnügte sich damit, einige Fischerdörfer zu plündern. Da dort natürlich keine großen Schätze zu finden waren, wurde die Bevölkerung auf die Schiffe verladen und auf dem Sklavenmarkt von Damaskus verkauft, obwohl der Prophet selbst Sklavenwirtschaft nicht sehr geschätzt hatte.
Ein Jahr später aber rückte Muawias Flotte den griechischen Kernlanden näher: Kreta und Malta wurden erneut geplündert und rund ein Dutzend Ägäis - Inseln besetzt.
Doch allzu ernst dürfte es Muawia mit seinem "heiligen Krieg" nicht gemeint haben. Er hätte sonst schwerlich seine beste Chance vergeben: Im Jahr 665 rief sich nämlich der griechische Statthalter in Armenien zum Gegenkaiser aus und sandte eine Delegation zu Muawia, mit der Bitte um Hilfe im Kampf gegen Konstantinopel. Als sich der Gesandte von seinem Kniefall vor dem Kalifen erhob, stand neben ihm schon ein anderer Botschafter Andreas vom Kaiser in Konstantinopel zu Muawia gesandt mit der Bitte, sich in diesem Streitfall wohlwollend neutral zu verhalten.
Muawias Antwort war klassisch: "Meine Entscheidung liegt in euren Kassen."
Beide Parteien dürften gezahlt haben, denn Muawia wartete zunächst einmal ruhig ab bis der Kaiser seine Rebellen erledigt hatte, aber dann erklärte er Konstantinopel aufs neue den Krieg, aus Rache für den Tod des armenischen Statthalters. 667 marschierte eine stattliche Armee quer durch Kleinasien und errichtete in Kalzedon genau gegenüber von Konstantinopel eine islamische Garnison. Doch dieser Erfolg konnte nicht von Dauer sein - bei der überstürzten Aktion war die Nachschubfrage übersehen worden, und so konnte die kaiserliche Armee noch im selben Winter den "Brückenkopf des Islam" aushungern und zerstören.
Kaiser Konstans konnte sich dieses Sieges nicht sehr lange freuen. Er liebte heiße Bäder und Badezimmer scheinen in Konstantinopel immer schon verhängnisvolle Räume gewesen zu sein: An einem Frühlingsabend des Jahres 668 bereitete ihm eine Dame namens Daphne ein kochendheißes Bad aus Schwefelsäure und Konstans war der siebte von insgesamt vierzehn byzantinischen Kaisern die in einer Badewanne verstarben.
In Konstantinopel stritten sich daraufhin vier Generäle um den Thron, und während sie damit beschäftigt waren sich gegenseitig umzubringen, eroberten Muawias Armeen ganz Tunesien und gründeten als Garnison die Stadt Kairuan.
Erst als in Konstantinopel wieder ein Kaiser auf dem Thron saß, 670, ließ Muawia auch die Feindseligkeiten gegen Byzanz wiederaufnehmen. Ohne Widerstand fuhr eine islamische Flotte durch die Dardanellen und begann mit der Belagerung der Kaiserstadt.
Die Belagerung von Konstantinopel ist eine einmalige Groteske der Weltgeschichte. Sieben Jahre lang lagerten islamische Truppen vor der Stadt. Pünktlich am 2. April kamen sie, und ebenso pünktlich zogen sie jeweils. am 28. September in ihre Winterquartiere nach Syrien. Viel mehr geschah nicht, denn kein Muslim wagte sich an die Mauern der Kaiserstadt. Die Griechen verfügten nämlich über eine schreckliche Waffe, das "griechische Feuer", die ersten Brandbomben.
Ihr Lieferant war ein gewisser Kalinikos aus Damaskus in Konstantinopel akkreditiert als Handelsbevollmächtigter des Kalifen Muawia. Im Namen seines Herrn hatte er dem Kaiser ein interessantes Geschäft angeboten: Öl aus der Erdölquelle des Kalifen die Muawia aus Omars und Osmans Nachlass übernommen hatte und die eigentlich die Moscheen des Islam zur Fastenzeit erleuchten sollte. Doch der Ölsegen scheint größer gewesen zu sein als der religiöse Bedarf. Auf jeden Fall ließ Muawia die Überproduktion an den Feind verkaufen, gleich in handliche Tonkrüge verpackt, die man nur noch mit einer Lunte versehen musste, um sie auf die anstürmenden Muslims schleudern zu können.
So verdiente der Kalif noch an jedem Geschoss, das auf seine eigenen Leute geschossen wurde. Er verdiente natürlich auch am Transport bei diesen Waffenlieferungen für den Feind: Nur seine eigenen Schiffe konnten die Belagerung durch seine Truppen durchbrechen und sie transportierten nicht nur als erste Tankerflotte die brisanten Ölkanister sondern fallweise auch Lebensmittel auf dass der Feind sich nicht durch Hunger ergeben müsse. Muawia selbst fand diese Art von Kriegsführung durchaus in Ordnung: "Es geht mir nicht um den Sieg, sondern um das Geschäft."
In der arabischen Welt ist die Erinnerung an diesen seltsamen Krieg lebendiger als in der westlichen. Als 1973 Jamani der Erdölminister König Feisals von Arabien um die Erde reiste und westliche Staatsmänner mit der Drohung von Erdölentzug schreckte, betonte er auch regelmäßig sowohl sein König wie er seien weitläufig mit Muawia verwandt. Anscheinend hielten unsere Politiker diese Erwähnung für eine Nebensächlichkeit, denn nach seiner Rückkehr erklärte der Minister in einem Zeitungsinterview, er habe genau damit "ein äußerst großzügiges Angebot
gemacht, das aber leider nicht verstanden wurde".
Der Kaiser von. Konstantinopel beendete schließlich den Krieg mit einem nicht weniger genialen Trick. Gesandte mit sehr viel Geld besuchten die Merdaiten.
Bei den Persern hatte dieser Stamm Marden geheißen, und schon die Erwähnung ihres Namens reichte aus Angst und Schrecken zu verbreiten. Sogar unser gutes heimisches Raubtier Marder bezog seine Gattungsbezeichnung von diesem Räuberstamm, der ursprünglich vom Südufer des Kaspesees aus sämtliche nach China reisenden oder von China kommenden Karawanen überfiel. Die Schahs von Persien hatten große Armeen ausgerüstet um mit diesem kleinen Stamm fertig zu werden, doch die Merdaiten hatten eine hervorragende Guerillastrategie entwickelt gegen die kein Kampfwagen gewachsen war. Schließlich traf der Schah ein Arrangement mit diesem Stamm, der Straßenraub für ein gottgefälliges Werk hielt: Gegen Zahlung einer riesigen Übersiedlungs-Beihilfe erklärten sich die Merdaiten bereit, mit Kind und Kegel an die byzantinisch-persische Grenze zu ziehen. Dort gründeten sie eine Stadt namens Mardin und veranstalteten nahezu ununterbrochen Raubzüge auf oströmisches Territorium. Mardin existiert heute noch ein romantisches Städtchen in Anatolien und im Volksmund heißt es auch noch Räubernest. Dabei haben die Merdaiten ihre Stadt schon 676 wieder verlassen. Wie viel ihnen der Kaiser von Konstantinopel für diese abermalige Übersiedlung gezahlt hat ist nicht bekannt. Auf jeden Fall tauchten die Merdaiten im Frühling 677 in Syrien auf und kurz darauf machten sie den gesamten Libanon und alle Strassen zwischen Damaskus und Jerusalem unsicher.
Muawia erklärte sich daraufhin sofort zu Friedensverhandlungen mit Konstantinopel bereit und akzeptierte sogar schmähliche Bedingungen: Für dreißig Jahre Waffenstillstand bezahlte er noch zweihunderttausend Mark fünfzig Sklaven und fünfzig Pferde. Dann widmete er sich dem Krieg gegen die Marden, mit dem gleichen Erfolg wie zuvor Perser und Byzantiner.
Die letzte Wanderung der Merdaiten blieb dies übrigens nicht. Schon dreißig Jahre später fand ein Kaiser in Konstantinopel, die Nordgrenze seines Reiches sei am besten mit diesem Räuberstamm geschützt, und daraufhin übersiedelten die Merdaiten nach Albanien.
Ihren furchterregenden Ruf haben sie nicht eingebüsst, und sprichwörtlich eigensinnig sind sie auch geblieben: Ihre Nachkommen leben heute noch; Karl May ließ die Mirditen als Räuber in den Schluchten des Balkan lauern; Albaniens Staatschef Hodscha hingegen bezeichnet seinen Stamm als die wilden Fahnenhalter des wahren Kommunismus.
Dabei waren die zugewanderten Merdaiten keinesfalls die einzigen, die Muawia das Leben im eigenen Land schwer machten. Mindestens ebenso gefährlich waren die Charidschiten.
Die Geschichtsschreiber sind mit ihnen nicht freundlich umgegangen. Schon der Name Charidschit ist ein Schimpfwort. "Spalter" werden sie sich selbst nicht genannt haben, die unter der Devise "Keine Herrschaft als die Gottes" selbstmörderisch kühn für den wahren Glauben kämpften. Dieses Motto aber ließ sie gegen jedes irdische Regiment anrennen, und Anarchisten haben noch nie Gnade vor Geschichtsschreibern gefunden die doch immer im Dienst irgendeines Systems stehen.
Ihre Kernmannschaft waren die letzten alten Kämpfer des Islam. Mit dem Propheten waren sie losgezogen in der Hoffnung das Reich Gottes auf Erden, von dem er aus propagandistischen Gründen oft sprach tatsächlich erleben zu können. Als dann aus dem Islam ein sehr irdisches von Bürgerkriegen zerrissenes Reich geworden war, schworen sie, auf eigene Faust und ohne jede Rücksicht Gottes Reich zu verwirklichen. Ihr Programm ähnelt sogar in Details dem späterer anarchistischer Vereinigungen: Im Reich Gottes sollte totale Demokratie herrschen, absolute Gleichheit und umfassende Brüderlichkeit. Kein Verwalter eines Gemeinwesens sollte sich an seinem Posten festbeißen dürfen - damit war das Prinzip der permanenten Revolution verankert. Und zur Verwirklichung dieses edlen Zieles wurde allen Machthabern der totale Krieg erklärt. Ausgetragen wurde der von der "Heiligen Armee", auch "Geheime Hand Allahs" genannt.
In der Geschichte schlugen die Aktivitäten der Charidschiten als endlose Kette von Aufständen und Attentaten nieder. Der "harte Kern" der Gruppe schien sein Hauptquartier an der Euphratmündung, in Basra oder Kufa zu haben - mehr wurde darüber nie bekannt.
Doch überall, so weit der Islam reichte, traten Charidschiten auf als tollkühne Attentäter oder heimliche M er hoher Würdenträger. Und wie jede anarchistische Gruppe wurden auch die Charidschiten ein bequemer, unwiderlegbarer Vorwand für einen schnellen Marsch des Islam in einen brutalen, autoritären Staat. Aus Angst vor dem Anarchismus schluckten die Stammesfürsten Gesetze, die Prinzipien des Islam geradezu auf den Kopf stellten.
Wer beispielsweise über den Kalifen auch nur lachte, war der Todesstrafe verfallen. Ohne Widerspruch durfte sich Muawia eine Leibgarde von 20.000 Mann aufstellen, und ebenfalls ohne Widerspruch wurde die Rechtsordnung des Islam abgeschafft: Von nun an brauchten Verhandlungen nicht mehr öffentlich stattzufinden; Verhandlungsunfähigkeit des Angeklagten war kein Grund mehr für die Aussetzung des Prozesses; stand der Angeklagte zusätzlich noch im Verdacht, Charidschit zu sein, durfte er sich vor Gericht auch nicht persönlich verantworten, sondern bekam einen vom Kalifen bestellten Pflichtverteidiger zugewiesen. In derartigen Verdacht zu geraten war nicht schwer. Nur ein Mann brauchte zu behaupten der andere sei Charidschit dann war der Verdächtige auch schon Beruf und Vermögen meist auch das Leben los. Der Denunziant aber erhielt 10.000 Mark in bar.
Muawia hatte jedoch auch subtilen Sinn für Humor - diese Gesetze hießen offiziell Gerechtigkeits-Reform und Gnaden - Erlass des Kalifen für die Sicherheit aller Gläubigen und wer daran Kritik übte, wurde als erwiesener Charidschit ohne Verfahren umgebracht. Schließlich sagte schon das Vorwort in schöner Ehrlichkeit :
Recht ist eine Machtfrage und Gerechtigkeit die wahre Peitsche der Herrschenden.
Noch eine andere Reform plante Muawia, und dabei war er sogar bereit, den Anschein der Rechtsstaatlichkeit zu wahren: Er wollte den Islam zu einem erblichen Familienunternehmen machen. Dabei allerdings begannen die Schwierigkeiten schon bei ihm selbst.
Er hatte das Attentat der Schwarzen Hand zwar überlebt aber nicht ganz unbeschädigt.
Der Mordanschlag hatte ihn zwischen die Beine getroffen, und sein Harem hatte seitdem nichts mehr von seinem Gebieter gehabt. Gründlich, wie Muawia war hatte er auch dafür gesorgt, dass den Damen selbst ersatzweiser Trost versagt blieb: Verfängliche Gemüse wie Karotten oder Gurken durften nur kleingeschnitten in das Frauengemach geliefert werden. Eine der Damen protestierte daraufhin mit einem Gedicht. Sie hieß Meisun und stammte aus einer syrischen Beduinensippe, und nach den Zelten schien sie stets Heimweh gehabt zu haben:
"Ich lachte einst im rauen Leinenkleide
und lernte weinen im Gewand aus Seide.
Ein kleines Zelt, in das der Ostwind fasst,
ist lieber mir als jeder Steinpalast,
und ein Kamel, das meine Sänfte stößt,
mir lieber als ein Ehemann, der döst.
Denn jeder grobe Kerl ist in der Tat
mehr wert als ein allmächtiger Kastrat."
Muawia hörte diese Verse nicht gern und schickte Meisun zurück in die Beduinenzelte. Mit ihr aber zog ihr Sohn Jezid, der einzige männliche Nachkomme des Kalifen. In der Wüste wuchs Jezid auf und als Muawia plötzlich wieder Vatergefühle entdeckte, war es schon zu spät, dem Sohn höfische Manieren beizubringen. Das einzige, was Jezid noch lernen konnte, war Saufen. Frühaufsteher in Damaskus gewöhnten sich bald daran, den Sohn des Kalifen mit ebenfalls feuchtfröhlichen christlichen Hofbeamten durch die Strassen torkeln zu sehen, laute Lästerworte gegen Allah und Christus grölend.
Einen solchen Kerl zum Kronprinzen machen zu wollen, war ein starkes Stück. Und auch das Argument, die natürliche Erbfolge lasse Jezid bereits als Auserwählten feststehen, verfing nicht. Wenn tatsächlich Blutsverwandtschaft für das recht auf das Kalifat ausschlaggebend ist, sind wir auf jeden Fall eher dran als dein Sohn, meinten in Medina die Söhne Abu Bekrs und Omars, vor allem aber Hussein, der zweite Sohn Allahs und letzte Enkel des Propheten.
Muawia griff tief in die Staatskasse. Wer Jezid als seinen Nachfolger anerkannte erhielt 5.000 Mark in die Hand, und daraufhin stellten sich natürlich etliche tausend Muslims zum Kniefall an, doch die entscheidenden Männer hielten sich zurück.
Die Zeit allerdings arbeitete für Muawia. Der Reihe nach starben die alten Kampfgenossen des Propheten, und die Plätze ihrer Gräber zeigen, wie weit es der Islam gebracht hat: Sie liegen in Samarkand begraben, im heutigen Russland, im Westen Tunesiens, in Sizilien und sogar an den Ufern des Indus. Viele der alten Garde starben bei Kämpfen, noch mehr ließ Muawia vergiften - nur sechs der über zweihundert Kampfgefährten von Bedr starben an Altersschwäche. Es starben der Reihe nach die Witwen des Propheten, Abu Bekrs und Omars und auch die Töchter Mohammeds und von ihrem Leben hatten sie alle nicht viel gehabt.
Ende März 680 starb auch Muawia, siebenundsiebzig Jahre alt. Dass um ihn sonderlich getrauert wurde, ist nicht bekannt. Jezid selbst begab sich, als sein Vater erkrankte schnell auf einen Jagdausflug und kehrte erst drei Tage nach dem Begräbnis zurück. Dann wunderte er sich, dass ihn die Damaszener nicht erschlugen, sondern als Kalifen anerkannten.
Wenn sie schon so blöd sind, haben sie mich wohl auch verdient, meinte er und verordnete als ersten Staatsakt für sich und seine Kumpane ein dreitägiges Saufgelage, verschönt durch dreihundert ausgesuchte Straßendirnen.
In Medina stieß Jezids Thronbesteigung auf Widerspruch. Hussein, der jüngere Sohn Alis und nunmehr letzte Enkel des Propheten, las sich Muawias Erbvorschriften noch einmal genau durch und erklärte dann, gemäss dieser Gesetze sei er Kalif. Jezid schickte sofort eine bewaffnete Truppe los sie solle Hussein klarmachen dass es sich hier nur um einen Irrtum handeln könne. Doch als die kleine Armee in Medina eintraf, war Hussein schon in Mekka, und dort wurde ihm ein begeisterter Empfang bereitet.
Die Mekkaner hatten Muawia nie verziehen, dass er seine eigene Vaterstadt zu einer drittklassigen Karawanenstation verdammte. Hussein versprach eine Wiederbelebung der Konjunktur, und damit hatte er alle Herzen gewonnen.
Doch auch in Kufa versprach man sich einiges von Hussein. Unter seinem Vater Ali war die einst kleine Garnisonstadt zu einem bedeutenden Umschlagplatz geworden, und unter Muawia hatte dort sein Statthalter Sejad übel gehaust.
Kaum war Hussein in Mekka eingetroffen, besuchte ihn schon eine Delegation aus Kufa: Geschlossen würde ihn die Stadt im Kampf um die Macht unterstützen.
Viele von Husseins Freunden meinten, der Enkel des Propheten solle dieses Angebot lieber nicht wörtlich nehmen. Die Kufaner hätten schon seinem Vater nur sehr wechselnde Treue geleistet und sollten daher lieber erst einmal selbst mit der Revolution gegen Jezid beginnen. Dann könne Hussein nachreisen.
Doch Hussein sprach ein großes Wort: "Ich folge dem Ruf Allahs. Mein Schicksal liegt in seiner Hand". Und machte sich auf den Weg, begleitet von seinen Frauen und Kindern und einer kleinen Schar Anhänger. Das war am 1. September 680.
Der Lieblingsenkel des Propheten war zu diesem Zeitpunkt keine strahlende Heldengestalt mehr. Von seinem Vater Ali hatte er die Anlage zu Hängebauch und Glatze geerbt, noch mehr aber dessen Naivität und diplomatisches Ungeschick. Er war nun Mitte der Fünfzig. Die letzten zwanzig Jahre hatte er zurückgezogen in Medina gelebt und dabei offensichtlich den Blick für die Wirklichkeit verloren. Sonst hätte er seinen Zug nach Kufa schon auf halbem Weg aufgeben müssen, denn von dort kamen schlimme Nachrichten.
Jezid hatte den hervorragenden Geheimdienst seines Vaters übernommen und war daher über die Vorgänge in Kufa genau informiert. Daraufhin ernannte er Obaidallah zum Statthalter den Sohn Sejads. Der war 32 und noch wesentlich brutaler als sein Vater unseligen Andenkens.
Die Kufaner schworen, den "Sohn des Hurensohnes" gar nicht erst in die Stadt zu lassen, sondern gleich vor den Mauern zu erschlagen. Doch niemand wusste, wie der Kerl aussah. So schöpfte niemand Verdacht, als am 7. September eine große Waffenhändler - Karawane in die Stadt zog. Am nächsten Morgen hatte Obaidallah mit seiner Truppe die Festung von Kufa in einem Handstreich genommen. Es kam zu kleineren Unruhen in einzelnen Stadtvierteln, die ganze folgende Nacht lärmten Verschleierte durch die Strassen. Am Morgen des 9. September steckten die Köpfe der prominentesten Parteigänger Husseins auf dem Tor der Festung, und ganz Kufa beeilte sich, den Kalif Jezid zu feiern.
Hussein zog dennoch weiter. Niemand wird es wagen, den Enkel des Propheten anzugreifen, meinte er und:
"Wenn ich mich wird das Volk sich schon zu erst vor den Mauern Kufas zeige, mir bekennen und den Aufstand beginnen.«
Daraufhin meinten einige seiner Begleiter, Hussein sei wahnsinnig geworden, und machten sich aus dem Staub. Sämtliche Beduinenstämme, die Hussein auf seinem Marsch nach Osten traf bereiteten ihm einen begeisterten Empfang und rieten ihm eindringlich ab, weiterzuziehen. Der Dichter Al-Feresdak reiste ihm aus Kufa entgegen: "Die Herzen der Leute mögen für dich sein, ihre Schwerter aber sind gegen dich". Hussein sagte nur: "Herzen wiegen schwerer als Schwerter".
Merkte Hussein nicht, dass sein Unternehmen glatter Selbstmord sein musste? Oder hatte er zu diesem Zeitpunkt bereits aufgegeben und suchte nun den Tod? Glaubte er vielleicht an ein Wunder oder war er nur einfach unfähig, sich mit Tatsachen abzufinden?
Von allen arabischen Wüstengebieten ist das um Scharaf zweifellos das schlimmste. Eine Mondlandschaft unübersehbarer Steinfelder, trostlos grau. Seit Jahrtausenden ist hier kein Gras gewachsen und noch heute bekommen Kamele Fetzen um die Hufe gewickelt, denn die Steine werden tagsüber glühend heiß. Wasser ist hier kostbarer als Gold - das einzige Wasserloch im Umkreis von hundert Kilometern ist in dein winzigen Dorf Schammar, und selbst dieses Wasser ist nur als starker Kaffee genießbar denn es ist salzig wie Meerwasser. Nach Osten werden die Steinhügel flacher und plötzlich tauchen dichte Dattelpalmen-Haine auf - der Schatt el Arab, der Zusammenfluss von Euphrat und Tigris. Von Fluss kann dabei allerdings nicht die Rede sein: Die ganze Gegend ist ein Labyrinth von kleinen Wasserläufen und Sümpfen, überwuchert von subtropischer Vegetation.
Den Urvätern die aus der Wüste kamen, war hier das Paradies, und auf halbem Weg zwischen Basra und Kufa liegt tatsächlich der Garten Eden, eine verwilderte Insel zwischen Sümpfen mit einem uralten, verkrüppelten Tamariskenbaum.
Dorthin wollte Hussein und dann flussaufwärts nach Kufa. Der Marsch durch die Wüste hatte seine kleine Karawane nahezu völlig erschöpft. Zweiundsiebzig Mann, vierzehn Frauen, zwölf Kinder, ein paar Pferde und vierzig Kamele stolperten mühsam dahin.
In Scharaf hatten sie für die letzten sechs Tage der Wüstenreise Wasser getankt, doch schon am nächsten Tag rief der Vorreiter, am Horizont seien Palmen in Sicht. Hussein glaubte an eine Fata Morgana. Da setzten sich die Palmen in Bewegung und kamen in scharfem Trab auf ihn zu.
Es waren ungefähr fünfhundert Reiter. Auf ihre Pferde hatten sie Schattendächer aus Palmwedeln gemacht. Ihr Anführer grüßte Hussein respektvoll - er hieß Horr und war mit einer von Husseins Frauen weitläufig verwandt und dann fragte er ob ihm Hussein nicht mit etwas Wasser aushelfen könne.
Bereitwillig teilte Hussein seine Wasservorräte. Dann war Gebetszeit. Ob Horr und die Seinen mitbeten oder weiterziehen wollten? Horr sagte: "Solange du lebst, will ich bei deinen Gebeten dabei sein".
Ob Horr vielleicht auch mit nach Kufa ziehen wolle? Selbstverständlich, meinte Horr. Er habe sogar den Auftrag Hussein dorthin zu geleiten.
Erst am Abend merkte die Karawane, dass sie verhaftet war. Husseins Freunde rieten zu einem bewaffneten Ausbruchsversuch. Hussein weigerte sich: "Auf keinen Fall greife ich als erster zum Schwert". Da sagte Horr, er könne trotz aller Befehle nicht verhindern, dass Husseins Karawane nach Medina fliehe... Hussein lehnte auch dieses Angebot ab: "Ein Enkel des Propheten kehrt nicht um".
Damit war die Entscheidung gefallen. Am nächsten Morgen erhielt Horr aus Kufa neue Befehle: Husseins Karawane dürfe kein Wasser mehr erhalten, unnötige Gewalt sei aber nach wie vor zu vermeiden. Da kamen auch schon die echten Palmhaine in Sicht. Nun erst versuchte Hussein nach Westen zu entkommen, doch Horr ließ diesen Weg versperren und auch den nach Osten, zu den Wasserstellen. So zog der kleine Haufen Husseins mit seiner übermächtigen Eskorte am Rand der Wüste langsam nach Norden dreißig Kilometer an Kufa vorbei. Am 2. Oktober kamen sie schließlich zu dem kleinen Dorf Kerbela, vor dem Hussein sein Lager aufschlug von Horrs Truppen umringt und nun ohne Wasser.
Zunächst versuchte Hussein mit Obaidallah zu verhandeln. Man solle ihm die Chance geben mit Jezid selbst zu sprechen ihn nach Medina zurückkehren lassen oder ihn an irgendeine Front schicken. Doch alle diese Angebote kamen nun zu spät.
Zu Horrs Truppen war noch eine Armee von viertausend Mann gestoßen, und Hussein hatte nur die Wahl, Jezid bedingungslos anzuerkennen oder zu sterben.
Am Morgen des 10. Oktober 680 stellte Hussein seine zweiundsiebzig Mann zur letzten Schlacht auf, gegen viereinhalbtausend Gegner. Auf einem Kamel ritt er die Front seiner Feinde ab: "Falls ihr nicht wisst, wen ihr umbringen wollt: Ich bin der Enkel des Propheten".
Da löste sich ein Mann aus dem waffenstarrenden Ring: "Besser jetzt der Tod und dann das Paradies, als mit diesem Wahnsinn ,leben und dann die Hölle! Es war Horr, der ihn so unerbittlich bewacht hatte und nun als einer der ersten für Hussein starb. Das Gemetzel dauerte den ganzen Tag, denn nach altarabischer Sitte kämpfte nur Mann gegen Mann.
Am Nachmittag lebte nur noch Hussein, schwerverwundet und blutüberströmt. Seine zweiundsiebzig Begleiter waren tot, aber auch 88 Feinde gefallen. Eine Pfeilspitze steckte in seinem Kiefer, und er selbst war nur noch halb bei Bewusstsein. Da gab Schemmer, einer der Generäle Obaidallahs, den Befehl, ihn zu töten . Rund fünfzig Mann stürzten sich auf Hussein.
Der Enkel des Propheten wurde von dreiunddreißig Lanzenstichen und vierunddreißig Schwerthieben zerhackt. Der Kopf wurde abgeschlagen und nach Kufa geschickt. Über den Körper ritten zehn Freiwillige so lange, bis nichts mehr davon zu sehen war.
Währenddessen kam es in den Zelten Husseins zu schrecklichen Szenen. Plündernde Soldatenrissen den Frauen die Kleider vom Leibe, und nur ein einziger Sohn Husseins, Omar, überlebte das Massaker.
Am nächsten Morgen wurden die, Bürger von Kufa in die Audienzhalle des Statthalters befohlen. In Dreierreihen zogen sie am Thron Obaidallahs vorüber. Davor lag Husseins Schädel, und Obaidallah stocherte fortwährend mit dem Schwert daran herum.
Ein alter Mann konnte das nicht mehr mit ansehen: "Hör auf, mit dem Kopf zu spielen" schrie er. "Bei Allah, ich sah den Propheten oft diese Lippen küssen". Dann stürzte er von Weinkrämpfen geschüttelt aus der Halle: "Heute sind die Araber Sklaven geworden! Nach soviel Ruhm sind sie nur noch feige Hunde!"
Tatsächlich war der 10. Oktober 680 der Schicksalstag des Islam. Von nun an zerfiel der Islam endgültig in rivalisierende Gruppen, und es sollte nicht mehr einen Nachfolger des Propheten geben, sondern stets mindestens zwei, den Kalif und den Imam. Denn die Parteien, die sich nach der Tragödie von Kerbela bildeten, bestehen noch heute.
Die einen nannten sich Sunniten, nach der Sunna der Überlieferung. Sie sollte Lücken und rechtliche Unklarheiten des Korans schließen, vergleichbar der Rechtspraxis in angloamerikanischen Ländern, die sich an Präzedenzfällen, Musterurteilen in ähnlich gelagerten Verfahren orientiert. So sollte beispielsweise die Nachfolgerfrage beim Kalifat nach dem angeblich vom Propheten einmal geforderten Prinzip der "Würdigkeit" geregelt werden. Ein schönes Prinzip, sollte man meinen beinahe demokratisch. Ihrem Programm nach wären die Sunniten zweifellos die progressive Richtung des Islam.
Tatsächlich aber musste die Sunna zum Konservativismus führen. Will man den Islam mit den christlichen Religionsgemeinschaften vergleichen stehen die Sunniten als die Katholiken des Islam da. Wobei die Stellung des Kalifen allerdings noch päpstlicher ist als die des Papstes, denn wie dieser ist er geistliches Oberhaupt und als solches unfehlbar, zusätzlich aber auch noch Chef der staatlichen Macht. So innig sind beide Funktionen verbunden, dass jede Kritik am Staat auch Gotteslästerung ist. Die Vereinigung von geistlicher und Staatsmacht war immer ein guter Nährboden für Herrscherwillkür mit allen üblen Folgen, und Gamal Abd-el Nasser, der Vater des modernen Ägypten schrieb 1961:
"Die Rückständigkeit unserer Länder danken wir zweifellos auch der Sunna. Von allen bekannten Religionsgemeinschaften ist der Islam die geeignetste ein modernes Staatswesen mündiger Bürger entstehen zu lassen. Doch jeder Schritt in diese Richtung wird gegen einen Islam getan werden müssen, wie ihn die Sunna darstellt" (Islam and Modern Arabic Policy, Kairo 1961).
Die Schiiten trennten von Anfang an säuberlich zwischen Staat und Kirche, aber absolut nicht absichtlich. Denn für sie waren die einzig legitimen Anwärter auf das Kalifat Nachkommen des Propheten, also Alis. Die aber sollten nie zum Zug kommen.
Daher unterschieden die Schiiten nur sehr unfreiwillig zwischen weltlicher und geistlicher Macht.
Ihr Oberhaupt war der jeweilige Thronanwärter aus der Banu Haschem des Propheten, als religiöser Führer Imam genannt. Sie waren seine Partei, denn nichts anderes besagt das Wort Schia, organisiert wie eine moderne Mitgliedspartei, mit Ortsgruppen und Vereinsbeiträgen. Und vor allem auch mit einer Lobby, die ihr Süppchen oft genug auf Kosten der Genossen kochte und schließlich aus dieser Partei ganz etwas anderes machen Sollte, als ursprünglich gemeint war.
Doch das ursprüngliche Ziel der Schia war auch illusorisch. Mit Mohammed schien das Geniepotential der Familie erschöpft. Schon Hussein war keine Leuchte praktischen Verstandes, und von seinen Nachfolgern ist noch weniger Nennenswertes zu berichten. Für die sunnitischen Kalifen aber mussten Mohammeds Erben immer gefährliche Konkurrenten sein, und daher mussten die Imame auch vor den Kalifen geschützt werden. Das ging nicht ohne Geheimhaltung und hermetische Abriegelung. So waren die Imame immer Gefangene ihrer Beschützer und sehr bald nur noch Produkte ihres Hofstaates. Manche von ihnen starben schon im Kindesalter, andere verschwanden Spurlosen. Es heißt, sie seien von Allah in den Himmel entrückt worden. Wahrscheinlich ist, dass dabei die Kalifen nachhelfen ließen.
Bald gab es Gruppen innerhalb der Schia, die das hoffnungslose Spiel aufgaben und einfach erklärten: Mohammeds Erben werden erst am Ende der Welt herrschen. Sie suchten sich einen der verschwundenen Thronanwärter aus und erklärten ihn zum "Imam der Zeit" - etwa Christus vergleichbar, der nach seinem gewissen Tod und seiner mysteriösen Auferstehung ja auch in den Himmel aufgefahren sein soll, "von dannen er wiederkommt", wie es im christlichen Glaubensbekenntnis heißt.
Wunderbare Dinge werden sich bei der Wiederkehr des "Imam der Zeit" ereignen. Sogar das Paradies soll wieder installiert werden und die Erde ein einziger Garten der Fröhlichkeit sein. Bis zu diesem goldenen Zeitalter aber waren die Erben Mohammeds auch aus der Politik der Schia ausgebootet. Mit den mittlerweile zwar unrechtmäßig, aber auch unübersehbar herrschenden Machthabern fanden sich die Schiiten wie mit einem notwendigen Übel ab, ohne jedoch je in die blindgläubige Untertanentreue der Sunniten zu verfallen.
Streitfrage sollte nur in alle Ewigkeit bleiben, welcher Imam nun der "Imam der Zeit" sei.
Eine Gruppe entschied sich für den siebten Namen Ismael die Mehrzahl der Schiiten einigte sich auf die Nachkommen seines Bruders und erklärte den zwölften Imam zum künftigen Messias. Einig waren sich beide Fraktionen nur darüber, dass Mohammeds Schwiegersohn Ali der erste Imam gewesen sei.
Mit der Hoffnung auf einen Messias hielt auch die Mystik in das klare Gedankengebäude des Islam ihren Einzug. Wenn Irrationalität das Kennzeichen einer Religion ist, war der Islam spätestens mit dem Begriff "Imam der Zeit" eine geworden.
Sunniten und Schiiten sind die feindlichen Brüder im Islam wie Katholizismus und Protestantismus im Christentum, und sie haben einander ebenso begeistert die Schädel eingeschlagen wie die Christen.
Noch unser Jahrhundert erlebte mit Staunen eine Staatsgründung, die letztlich mit dem Feuer dieses uralten religiösen Zwistes geschmiedet wurde.
Wieder sollte ein Hussein dabei eine tragische Rolle spielen, und dieser Hussein war sogar mit dem alten Hussein weitläufig verwandt. Er stammte ebenfalls aus der Banu Haschem war aber klugerweise nie aus Mekka gezogen und hatte es dort zum Scherif gebracht, zum Bürgermeister und Gerichtsherren.
Zu ihm schickten die Engländer im Ersten Weltkrieg ihren skurrilsten Agenten. Der hieß Lawrence und hatte eine bemerkenswerte Vorliebe für Schminke lange, wallende Gewänder und schlanke Araber.
Die beiden gefielen einander und Lawrence zuliebe begann Hussein einen Aufstand gegen Konstantinopel, das damals auch Arabien beherrschte. Zur Belohnung durfte sich Hussein nun König von Arabien nennen und zwei seiner Söhne wurden als Könige in Jordanien und im Irak eingesetzt. Das stieg Hussein zu Kopf: 1924 erklärte er sich plötzlich zum Kalifen im Sinne der Sunna.
Das behagte einem Stammesfürsten namens Abdul Aziz ibn Saud gar nicht. Er fand, es könne doch nicht angehen, dass ausgerechnet ein Nachkomme des Propheten, der doch eigentlich der Schia verpflichtet sein müsse, nun sunnitische Politik betreibe, erklärte Hussein den Krieg und jagte ihn aus dem Land.
Natürlich wandte sich Hussein hilfesuchend an seine englischen Beschützer. Die erklärten aber, dass sie sich noch nie in religiöse Streitfragen gemischt hätten, und boten ihm ein komfortables Exil in Zypern an.
Seitdem heißt das letzte Kalifenreich der Weltgeschichte Saudi-Arabien, doch geistliche Oberhoheit hat Ibn Saud auch nie beansprucht.
Des ersten Hussein schrecklichen Tod habe ich selbst einmal miterlebt, vor etlichen Jahren in einem kleinen Dorf bei Isfahan in Persien. An einem Abend kurz nach dem islamischen Neujahr lud mich ein ächzender Bus nach ganztägiger Rumpeltour vor einer kleinen Herberge ab.
Schreckliches musste hier geschehen sein, denn das Dorf schien ein einziges Totenhaus. Während ein Abendländer bei Trauer sprichwörtlich "erstarrt", geraten Muslims bei solchen Anlässen erst recht in Rage. Aus dem Halbdunkel der Dorfstrasse gellten herzzerreißende Klagerufe und aus den Häusern grässliches Geschepper - hinter den Lehmmauern schienen die Frauen des Ortes sämtliche Töpfe und Pfannen pausenlos aneinander zuschlagen. Tasidscheh, sagte der Busfahrer und zuckte die Achseln. Tasidscheh, heulte auch der Wirt und hatte rotgeweinte Augen. Hussein stirbt, schluchzte er, als er Tee brachte.
Ich blätterte in meinem Reiseführer. Richtig, da stand: Tasijeh 12-tägiges Trauerfest der Schiiten anlässlich des Todes von Hussein (680).
"Hussein wird sterben", wimmerte der Wirt, als er das Essen brachte. Ich versuchte ihn zu trösten: "Aber Hussein ist doch schon über tausend Jahre tot".
Der Wirt sah mich an wie einen Wahnsinnigen: "Was? Über tausend Jahre? Da! Er stirbt doch gerade!"
Der Wirt zeigte auf einen alten Mann, der unter dem Vordach einer großen Runde Jüngerer etwas erzählte. Vor ihm stand ein großer Kalian, die berühmte Wasserpfeife aus Kirschholz über einem reich geschmückten Messingtopf. Es roch nach Gandscha, dem verführerischen Rauch von Hanfblättchen. Der Alte nahm gerade einen tiefen Zug. In der glosenden Pfeife schien er Furchtbares gesehen zu haben, denn als er weitererzählte, schrie seine Gemeinde wild auf. Nein, nein, jaulte der Wirt und trommelte verzweifelt mit seinen Fäusten an die Wände seines Lokals. "Warum muss er denn sterben!?!?!. Es gab Aaschura, einen Eintopf aus Grütze und Bohnen, und so, erklärte mir der Busfahrer, hieß auch der Tag.
Genaugenommen ist Aaschura der Gedenktag für eine ganze Masse menschheitserschütternder Ereignisse, denn gefeiert wird die Austreibung aus dem Paradies, die Landung der Arche Noahs, Abrahams misslungenes Opfer und vor allem eben Husseins schreckliches Ende. Damals gab es noch kein Fernsehen und die meisten im Dorf waren fundierte Analphabeten. Hier leuchtete noch die ungebrochene Strahlkraft der Erzählung und nie Wieder habe ich ein Publikum gesehen, das sich so begeistert mitreißen ließ.
Die Leute hingen förmlich an den Lippen des Alten, und der sprach mit Händen und Füssen, so dass sogar ich verstand, worum es ging. Die Gemeinde weinte über die lang vergangene Bluttat, als geschähe sie heute und ihr, und sooft der Alte eine Pause machte, mussten sich alle mit einem tiefen Zug aus der Pfeife trösten. Minuten später aber heulten sie schon wieder geschlossen los, während Knallfrösche und rasselndes Blech auf den Strassen eine kriegerische Geräuschkulisse lieferten.
Obwohl ich von der Reise todmüde war, konnte ich die Nacht über kein Auge schließen - pausenlos krachte es auf der Strasse, um die Trauernden munter zu halten. Um Mitternacht bewegte sich ein gespenstischer Zug durch die Strassen. Voran gingen vier Männer mit nackten Schultern und schlugen. sich selbst mit Stricken den Rücken. Ihnen folgten viele vermummte Gestalten mit langen Stangen. Darauf steckten grausige Masken aus Pappmache, grün bemalt die Köpfe Husseins und seiner Getreuen. Am Schluss trippelten Kinder Arme und Köpfe mit Lumpen verbunden, um zu zeigen, dass nicht einmal Husseins Kleine geschont wurden.
Der Zug schien aus dem Mittelalter zu kommen so müssen bei uns einst die Geissler durch die Städte gezogen sein, unversöhnlich in ihrem Glauben. Nun verstand ich, was mir kurz zuvor ein Freund in Teheran gesagt hatte: "Solange die Welt besteht, wird zwischen Sunna und Schia unversöhnlicher Hass sein".
Am nächsten Morgen konnte unser Wirt sich vor Müdigkeit kaum auf den Beinen halten, aber sein Gesicht strahlte: Die ganze Nacht hatte er seine Bratpfannen aneinandergeknallt und sich damit als gläubiger Schiit gezeigt. Ich machte ihm ein Kompliment für soviel religiösen Eifer. Er wehrte ab: "Aber das ist doch gar nichts". Dann strahlte er: "In Mesched hätten Sie sein müssen da bringen sich die Leute vor lauter Gläubigkeit gegenseitig um!"
Und dann gab er mir noch eine Tüte Anisplätzchen mit - die Totenkuchen Husseins.
Mesched in Nordpersien ist einer der großen Wallfahrtsorte der Schiiten, und hier soll es tatsächlich oft zu Tasidscheh Tote gegeben haben. Es wird von Gläubigen berichtet, die sich lebendig begraben ließen, von Fanatikern, die sich selbst zu Tode prügelten, und von Laienspielern, die Husseins letzten Kampf so realistisch darstellten, dass Sie selbst dabei ums Leben kamen. Nichts spricht dagegen, solchen Berichte zu glauben, zumal ein neues persisches Gesetz diese Bräuche ausdrücklich verbietet. In der Welt des Islam sind eintausenddreihundert Jahre keine lange Zeit vor der Ewigkeit der Blutrache, und die Erinnerung an Kerbela ist lebendig, als wäre es gestern gewesen.
Kerbela selbst ist wohl das größte Gräberfeld der Erde. Für den frommen Muslim ist es Herzensangelegenheit, in der Nähe großer Männer begraben zu sein. Die werden vielleicht am Tag der Auferstehung ein gutes Wort bei Allah für ihre Nachbarn einlegen. So bestimmen viele Schiiten in ihrem Testament Kerbela zur letzten Ruhestätte.
Die Toten kommen auf Kamelen aus der Wüste in Säcke eingenäht und in Ätzkalk getaucht. Obwohl die Karawanentreiber ständig Weihrauch verbrennen, kann man deutlich riechen, dass hier ein Gläubiger seinen letzten Weg zurücklegt.
Sie kommen in rohgezimmerten Truhen auf den Gepäckträgern klappriger Taxis aus Bagdad, in ganzen Gruppen auf dem Verdeck uralter Lastwagen. Sie kommen aus Pakistan und Persien in blechbeschlagenen Kisten und werden auf dem verschlafenen Bahnhof gestapelt, um dann irgendeines Tages vor die Stadt gekarrt zu werden. Dort, vor den alten Lehmmauern, wurde jahrhundertelang Grab an Grab gereiht, und heute haben die Toten Kerbela mit einem kilometerbreiten Ring umzingelt. Keine Blume wächst da, nicht einmal ein Grashalm. Die alten Araber haben die Gräber ihrer Toten mit Steinen bedeckt, um sie vor den Schakalen der Wüste zu schützen. Daher besteht die Umgebung Kerbelas aus kleinen Ziegelhaufen. Dazwischen steht ab und zu ein kleines Mausoleum eines reicheren Toten, aber auch das ist nur aus luftgetrockneten Lehmziegeln erbaut und wird bald zerfallen sein.
Die Totenstadt von Kerbela ist von trostloser Größe - namenlos warten hier Millionen unter zerbröckelnden Backsteinen auf den Tag, an dem Allah jeden von ihnen wiedererkennen wird, und in der Sonne leuchtet die Kuppel des grandiosen Domes, den spätere Herrscher über dem Platz errichtet haben, wo Husseins Leichnam zertrampelt wurde.
Um dieses blutgetränkte Stück Wüste ist eine kleine Stadt entstanden. In den Suks, den engen Gassen des Basars, hocken Pilger aus Persien, Pakistan und Indien. Viele von ihnen werden nicht mehr heimkehren. Sie wollen hier bleiben, dann ist einmal der letzte Weg nicht so lang. Und außerdem: Es gibt ja eine Menge betrügerischer Bestattungsunternehmer, die ihre Kunden gar nicht bis Kerbela bringen, sondern einfach unterwegs verscharren. Nein, meinte ein alter Pakistani, so ein Risiko wolle er gar nicht erst eingehen.
Er hockte nun schon fünf Jahre in Kerbela; in einer Seitengasse des Basars hatte er ein kleines Zimmer gemietet, bei einem Beerdigungsunternehmer - die Stadt lebt vom Tod. Er selbst verdiente sich inzwischen als Totengräber etwas Geld, und wenn ihm das Warten auf den eigenen Tod langweilig wurde, gab es da immer noch ein Haus mit freundlichen Damen. Nein, nicht "Töchter des Windes", damit würde er sich als Frommer nicht einlassen. Es handle sich vielmehr, erklärte er, um ein Heiratsinstitut, wo man sich nach Erledigung. sämtlicher Formalitäten für eine Nacht verheiraten könne.
Ob dieser schöne Brauch noch besteht, weiß ich nicht. Früher war Ungläubigen der Besuch von Kerbela verboten. Vor einigen Jahren durfte man für etwas Bakschisch sogar schon auf das Minarett der Hussein -Moschee steigen. Von dort hat man einen wundervollen Blick auf die goldene Kuppel über Husseins Todesstätte und auf die riesige Totenstadt. Bei klarem Wetter sieht man am anderen Ufer des Euphrat fast schon am Horizont, einige zerklüftete Hügel. Unter ihnen ist Babylon begraben, die Wiege der Kultur.
Am meisten ergriffen aber hat mich ein kleines Gedicht, eingekratzt in eine halb zerfallene Lehmmauer. Fromme Hände dürften es immer wieder erneuert haben, denn es ist so alt wie der Bruderzwist des Islam, die Klage eines Augenzeugen:
"Gott, war es das, wofür in deinem Namen wir statt der Pfeffersäcke einst das Kriegsschwert nahmen?
Dass des Propheten Feinde nun auf seinem Thron erschlagen können des Propheten Enkelsohn?
War unser Glaubenskampf nur zu dem Zwecke der Machtergreifung wilder Hurenböcke?
Für Gottes Reich auf Erden traten wir in Sold, doch wir vermehrten nur der Gauner Gold.
Nun bringt der Bruder seinen Bruder um, ein stetes Morden.
O Gott, was ist aus dem Islam geworden? "
|
|
Die geheimen Verführer der Diktatur
|
|
|
Die grüne Krake
Auch aus dem Flugzeug wirkt das "Wunder in der Wüste" kaum weniger beeindruckend, als es vor Jahrhunderten auf den Beduinen gewirkt haben mag, der per Kamel aus der Wüste kam: Im horizontweiten Braungrau des Antilbanon leuchtet plötzlich Grün. An den Berghängen beginnt es, zaghaft, ein schmaler Zipfel. Es wächst einen Wasserlauf entlang ins Tal, wird breiter,
und nach vielen Windungen vereinigt es sich mit den anderen grünen Armen zur Oase von Damaskus. Aus der Vogelschau sieht das Tal tatsächlich aus wie ein großer, grüner Tintenfisch im Steinmeer der Wüste, und "grüne Krake" hieß es auch schon seit undenklichen Zeiten. Damaskus hat aber auch poetischere Namen, beispielsweise "Garten des Islam".
Wer den Zauber dieser wahrscheinlich ältesten noch lebenden Stadt der Menschheit erfahren will, muss aus der Wüste kommen. Er muss aus der mörderischen Sonnenhitze kommen, um das "Wunder von Rabueh" empfinden zu können: Zahllose kleine Wasserfälle, die im Schatten alter Eukalyptusbäume fast auf die Strasse spritzen, die gebändigt kleine Teiche speisen und die zahllosen Kanäle in den üppigen Gärten. Hier ist die Heimat der Rosa Damascena und hier wird sie in Feldern gebaut, denn diese Blume ist eine Nutzpflanze. in den Suks, den engen Basargassen, wird die Rosa Damascena verwertet und wie vor Jahrhunderten auf den Markt gebracht: Als Rosenöl, einst unentbehrlicher Konditorbedarf als gezuckerte Rosenblätterpaste, als Rosenhonig, als Konfekt und als Rosenwasser, Seifenersatz der Superreichen von ehedem.
Das Herz der grünen Krake ist die Altstadt von Damaskus, graubraun wie die Wüste, aber durchpulst von ewigem Geschäftsleben. Der "fruchtbare Halbmond", das Zweistromland und wie die Levante im Gegensatz zur Heimat des Islam genannt werden, hat hier sein Zentrum. Es kann sich sehen lassen - obwohl die Stadt unzählige Male zerstört und wiederaufgebaut wurde, ist beinahe jede Straßenecke von uralten Erinnerungen geheiligt.
Christliche Besucher können hier noch das Tor bestaunen, vor dem Saulus vom Pferd fiel und Paulus wurde, und sie können in den kleinen Raum "an der geraden Gasse" treten, wo sich der Frischbekehrte von seinem Schock erholte.
Wenn sie dann schon so weit in die Altstadt vorgedrungen sind und ihnen nicht bereits die Augäpfel schmerzen ob der verwirrenden Vielfalt von Köstlichkeiten auf den Basaren, können sie noch durch einige römische Torbogen zum fünften Weltwunder gehen, der Moschee der Omajaden.
Nur zwei der sieben Weltwunder Herodots hatten die Antike überlebt: der Koloss von Rhodos und die unverwüstlichen Pyramiden. Dem Koloss haben die Muslims den Garaus gemacht, aber als ihre Schöngeister eine neue Kartei der Weltwunder anlegten, rechneten sie den Verschrotteten mit. Als Numero drei führten sie stolz die Kaaba auf, als viertes der Wunder Salomons Tempelberg und als fünftes die Moschee von Damaskus. Zumindest da haben sie nicht übertrieben! Obwohl auch die Omajaden Moschee wiederholt schwer ruiniert wurde, wirkt sie auch heute noch atembeklemmend schön. Ein riesiger, lichtdurchfluteter Hof, an dessen Pfeilerwänden Einlegarbeiten aus buntem Marmor leuchten, dahinter eine große dreischiffige Halle mit einem Wald herrlicher Säulen. Unter einer zierlichen Marmorkuppel soll Johannes der Täufer begraben liegen, und ein kleiner Brunnen davor ist das älteste Taufbecken der Christenheit. Gut zweitausend Perserteppiche glühen in allen Farben des Orient, an einigen Wänden aber leuchten zwischen den Marmorplatten Mosaike, Stadtbilder in bester römischer Tradition.
Die Herren aus der Wüste brachten keinen eigenen Baustil mit, und daher wurden Kunsthistoriker nie müde, am Beispiel der Omajaden-Moschee die Übernahme römischer Kunst zu beweisen. Doch haben die Omajaden nicht einfach übernommen diese Großzügigkeit, diese zurückhaltende Pracht haben selbst die besten Baumeister des alten Rom nicht zustande gebracht.
Hier wurden andere Vorstellungen verwirklicht, geboren aus der Weite der Wüste, wenn auch mit von Römern geerbten Mitteln. Wer die drei Schicksalsstädte des Islam kennt Mekka, Medina und Damaskus, wird verstehen dass Damaskus die Hauptstadt des Reiches Islam werden musste. Es liegt am Schnittpunkt aller Handelswege der alten Welt, und seine Oase kann allein mehr Menschen ernähren als alle Oasen der arabischen Halbinsel zusammen.
Wer die Araber kennt, weiß allerdings auch, dass Damaskus als Hauptstadt nie unwidersprochen hingenommen werden konnte. Zu unarabisch ist diese Metropole, zu weltstädtisch allen Völkern und Religionen gegenüber, auch heute noch, nach eintausenddreihundert jähriger Herrschaft des Islam.
Zu Recht mussten die Gläubigen von Mekka und Medina den Omajaden vorwerfen, in der Hauptstadt des Unglaubens zu residieren, von ihren Handelsinteressen einmal ganz abgesehen.
Diese Problematik fand ihren Niederschlag in den Geschichtsbüchern und macht es heute noch schwierig, die Zeit zu beurteilen, in der aus dem Islam die absolute Weltmacht ihrer Zeit wurde. Alle Parteien häuften Unrecht auf sich - die von Damaskus aus Macht erwarben und verteidigten, die für den wahren Glauben zu kämpfen vermeinten und jene die um ihre tatsächlichen oder eingebildeten Rechte kämpften. Wer in diesem ununterbrochenen Ringen unterlag, war auf jeden Fall ein Bösewicht. Wer siegte, ein stets nur sehr zweifelhafter Held. Bluttriefende Tyrannen fanden Gnade vor der Nachwelt, weil sie etwas Kultur hinterließen und sich außer mit Mördern auch mit Künstlern umgaben, Friedliebende wurden als Feuerteufel des Bürgerkrieges gebrandmarkt, und allen gemeinsam ist der Fanatismus, der seitdem als typisch arabischer Charakterzug gezählt wird. Nicht ganz zu Unrecht: Sämtliche Feindschaften der damaligen Altvorderen vererbten sich mit zäher Hartnäckigkeit auf ihre Kindeskinder bis in die Gegenwart. Sämtliche Konflikte der heutigen arabischen Länder und Stämme leiten sich aus der Zeit nach dem Propheten ab und werden auch in Diskussionen immer wieder auf die islamische Erbsünde zurückgeführt. Beispielsweise stehen die syrisch – saudi - arabischen Beziehungen noch heute im Schatten des Konfliktes zwischen Mekka Medina und Damaskus aus der ersten Omajadenzeit.
Kaum war Hussein in Kerbela gefallen, rief sich in Mekka Abdallah Ben Zubair zum Kalifen aus. Schließlich hatte er nun die gleiche Erbberechtigung wie Jezid, denn er war ein Enkel Abu Bekrs. Zufällig war er auch genauso alt wie die Zeitrechnung des Islam, denn er wurde gleich nach dem Umzug, am 13. September 622 geboren. Seine Mutter Asma hatte als Hochschwangere den Propheten und ihren Vater in der Höhle versorgt und sich damit in der Geschichte des Islam als eine der wenigen Frauen einen bleibenden Namen gemacht. Sein Vater ist uns schon bekannt: Az-Zubair der gemeinsam mit Aischa den Bürgerkrieg gegen Ali vom Zaun gebrochen hatte und in der Schlacht des Kamels gefallen war.
Von Abdallah selbst wird eine seltsame Geschichte berichtet: Als er noch ein Knabe war, spielte er oft mit anderen Kindern im Haus des Propheten. Einmal musste Mohammed zur Ader gelassen werden, und der Hausarzt gab dem Kleinen die Schale mit Blut - er solle sie irgendwo unauffällig wegschütten. Kaum aber war das Kind um die Ecke des Hauses gegangen, trank es das kostbare Prophetenblut. Wahr oder erfunden – auf jeden Fall legitimierte diese Anekdote Abdallah in den Augen der Bürger von Mekka und Medina, und vor der Kaaba wurde ihm als Kalifen gehuldigt.
Jezid in Damaskus sah das gar nicht gern. Nach einem Jahr und vergeblichen Verhandlungen schickte er eine stattliche Armee gegen die heilige Stätte. Das Kommando führte Hassem, und sein Befehl lautete: "Pardon wird nicht gegeben. Vergesst, dass ihr gegen die heilige Kaaba zieht, sondern denkt daran, dass ihr nur den Befehl eures Führers vollzieht".
So gründlich hatte sich der Islam in den fünfzig Jahren nach Mohammed geändert. Die Muslims stellten auf den Bergen rings um Mekka Katapulte auf und schossen die Kaaba zu einem Trümmerhaufen. In die Stadt selbst aber kamen sie nicht, obwohl seit Mohammeds Machtergreifung die Stadtmauern "in Aussicht auf den nunmehr ewigen Frieden" geschleift waren. Die Mekkaner erwiesen sich als so gefährliche Straßenkämpfer, dass sich die Belagerer bald darauf beschränkten, die Stadt so gründlich wie nur möglich von der Außenwelt abzuschließen. Selbst damit hatten sie nicht sehr viel Erfolg: Getreu den Geboten des Koran zogen islamische Pilgerscharen durch den islamischen Belagerungsring, und so entwickelte sich ein reger Lebensmittelschmuggel.
Am 27. November 683 ruhten plötzlich die Katapulte in Damaskus war Jezid gestorben, 38 Jahre alt und höchstwahrscheinlich an Delirium tremens. Zu seinem Nachfolger hatte er noch schnell seinen Sohn ernannt, doch der war erst dreizehn Jahre alt und überdies noch schwachsinnig.
Am Abend dieses Tages kam es vor den Trümmern der Kaaba zu einer eigenartigen Begegnung. Hassem, der Belagerer, traf sich mit Abdallah Ben Zubair und trug ihm in aller Form das Kalifat an.
Abdallah witterte eine Falle und lehnte ab. Doch Hassem hatte es durchaus ernst gemeint. "Ich bin ein Feind jeglichen Bürgerkriegs" erklärte er. "Und daher ist mir jede Zentralgewalt lieber als keine. Dem stünde ja nichts im Wege, meinte Abdallah. Er sei durchaus bereit, Kalif zu bleiben allerdings nur mit dem Regierungssitz Mekka. Da zählte Hassem noch einmal sämtliche verkehrstechnischen und andere Gründe auf, die gegen Mekka und für Damaskus sprachen - Abdallah blieb störrisch.
Darauf zog Hassem beleidigt ab und am nächsten Tag mit seinen Truppen in Richtung Damaskus. Als er dort ankam, war Jezids Sohn gerade gestorben oder umgebracht worden. Der Hofstaat befand sich in voller Auflösung, und die Angehörigen der Sippe Omaja packten bereits ihre Koffer für die Flucht. Einen entfernten Onkel Jezids traf Hassem noch in seinem Palast an. Er hieß Merwan, und ihn ernannte der General zum Kalifen.
Das machte das Chaos nur noch größer. Viele Städte bekannten sich zu Abdallah Ben Zubair als Beherrscher aller Gläubigen. Etliche entschieden sich für Hassems Wahl, in Basra wurde Obaidallah, der Killer von Kerbela, ausgerufen und bald wusste niemand mehr, wo nun welche Front verlief zumal sich auch noch Schiiten und Charidschiten in die Kampfhandlungen einmischten.
Der einzige, der während der nächsten zehn blutigen Jahre halbwegs ruhig und friedlich lebte war Abdallah je nach politischem Standort der Chronisten rechtmäßiger Kalif oder Anmasser der höchsten Würde des Islam. Er schien an weltlicher Macht nicht interessiert. Wiederholt hätte er beste Chancen gehabt sich aus den Trümmern des islamischen Reichs ein eigenes Imperium zusammenzubasteln doch er begnügte sich damit, in Mekka zu bleiben und sich dort als religiöses Oberhaupt huldigen zu lassen. Er baute die Kaaba wieder auf, größer, als sie zu Mohammeds Zeiten gewesen, doch angeblich nach den Plänen des Propheten. Der heilige Schwarze Stein war während der Kampfhandlungen zerborsten. Abdallah ließ die Trümmer sammeln und mit einer silbernen Klammer zusammenfügen. In dieser Klammer, ungefähr einen Meter hoch und siebzig Zentimeter breit, ruht der Schwarze Stein heute noch. Zu Abdallahs Zeiten wirkte er nach der Beschreibung eines Dichters "wie ein großes Juwel, aus einer silbernen Wand ragend". Seither haben ihn Millionen Hände berührt und gestreichelt - heute ist der Schwarze Stein ein tiefes, schwarzes Loch in Abdallahs silberner Fassung.
Währenddessen ertranken die islamischen Länder in Strömen von Blut. Drei manchmal sogar vier Anwärter kämpften um das Kalifat. Merwan, der Omajade, starb bereits 685, nachdem er zwei Jahre lang mit Hassems Armee von Aufstand zu Aufstand geeilt war, ohne außerhalb von Damaskus und Syrien als Kalif anerkannt zu werden. Nach seinem Tod wurde sein Sohn Abd-el Melik von Hassem zum Kalifen aufgerufen. Seine Regierungserklärung gab keinesfalls zu Optimismus Anlass: "Vierzig Jahre bin ich nun alt, und seit meinem zehnten Lebensjahr herrscht Bürgerkrieg. Ich habe mir geschworen, diesem Wahnsinn ein Ende zu machen, und wenn dabei die Menschheit ausstirbt".
Tatsächlich sollte sich Abd-el Melik durchsetzen, und die Historiker haben ihm dafür den Beinamen "der Grosse" verliehen. Mit der gleichen Berechtigung, wenn nicht mit mehr, müsste er auch "der Blutige" heißen, denn bei der Wahl seiner Methoden war er nicht zimperlich. Doch in den Geschichtsbüchern gilt Erfolgshaftung und der Grundsatz zweifelhafter Moral, dass der Zweck die Mittel heilige. Dass Abd-el Melik die absolute Staatsmacht wiederherstellen wollte, war klar, und auch über das Wie ließ er keinen Zweifel aufkommen. Sein Machtmittel war das Militär, und die Soldaten waren keine Glaubensstreiter mehr, sondern Söldner, ein bunt zusammengewürfelter Haufen bezahlter Mordangestellter, durch eisernen Drill zusammengehalten. Um freie Hand zu bekommen, schloss Abd-el Melik mit dem Kaiser von Konstantinopel einen langjährigen Friedensvertrag und verpflichtete sich, dem Herrscher der Ungläubigen jährlich ein Viertel der Staatseinnahmen abzuliefern. Dafür wurden die Länder des Islam zu Feindesland erklärt und zur Plünderung freigegeben.
Zunächst wurde das Euphratgebiet verheert. Dort hatte sich Obaidallah zum Kalifen ausrufen lassen. Da aber hatten die Schiiten geputscht. Obaidallah wurde erschlagen und sein Kopf im Palast zu Kufa an dieselbe Stelle gelegt, wo einst vor ihm Husseins Haupt gelegen hatte. Dann putschten die Anhänger Abdallahs und brachten den Kommandanten der Schia um. Und als Abd-el Meliks Armee vor Kufa aufmarschierte, putschten seine Parteigänger in der Stadt. Anfang Dezember im Jahr 691 zog Abd-el Melik in der Stadt ein, und die Würdenträger Kufas versammelten sich nach alter Sitte in der Audienzhalle.
Vor Abd-el Melik lag der abgehauene Kopf des Statthalters von Abdallahs Gnaden, und eine bis an die Zähne bewaffnete Leibgarde sorgte dafür, dass die Kufaner dem neuen Beherrscher der Gläubigen gebührend zujubelten. Nur ein alter Mann weigerte sich, auch nur ein einziges Mal "Hoch" zu rufen.
"Ich war im Lauf der letzten zehn Jahre einige Male in dieser Halle", sagte er. "Das erste Mal lag genau hier Husseins Kopf und Obaidallah saß auf dem Thron. Das zweite Mal lag hier Obaidallahs Kopf und ein Schiit saß dahinter. Dann lag hier der Kopf des Schiiten, und Abdallahs Statthalter saß dort. Jetzt liegt sein Kopf vor dir. Das alles macht mich so nachdenklich, dass ich erst das nächste Mal wieder jubeln werde". Abd-el Melik wurde blass. Er erklärte die Zeremonie für beendet und gab den Befehl, die Halle so gründlich zu zerstören dass niemand mehr ihre Lage feststellen könne. Die nächsten zwei Jahre soll er ständig seinen Hals massiert haben.
Mit dem Fall von Kufa und Basra war aber auch Abdallahs Zeit abgelaufen. Nur noch Mekka hielt zu ihm und dorthin schickte Abd-el Melik nun die frei gewordene Armee unter dem Kommando von Hedschadsch, dem brutalsten Haudegen islamischer Geschichte. Schon bei den vorangegangenen Kriegen Abd-el Meliks hatte er sich den zweifelhaften Ehrentitel "sadistischer Bluthund" erworben, und er war so stolz darauf, dass er ihn auch stets unter seine Unterschrift setzte.
Kaum hatte er Mekka eingeschlossen und auf den Berghöhen erneut Katapulte installieren lassen schrieb er auch mit diesem Absender einen Brief an die Belagerten: Wer freiwillig zu ihm überlaufe, erhalte Schonung seines Lebens und Eigentums. Im übrigen aber dürfe kein Pilger mehr in die Stadt.
Am nächsten Morgen begann das Bombardement. Schwere Steinbrocken flogen den ganzen Tag über von den Hügeln in die Wohngebiete. Die Kaaba wurde diesmal geschont dafür aber ging nahezu die ganze Stadt in Trümmer. Außerdem war die Blockade wirklich lückenlos. Schon nach einem Monat gingen die Lebensmittelvorräte zur Neige während die Belagerer sogar mit frischen Süßigkeiten aus Damaskus versorgt wurden. Dieser Nervenkrieg dezimierte natürlich die Anhänger Abdallahs und ganze Scharen verließen die Stadt. Immerhin blieben genügend Verteidiger um Eindringlinge schon in den zertrümmerten Vorstädten zurückzuschlagen.
Abdallah Ben Zubair war bereits siebzig Jahre alt, eine imponierende Gestalt mit langem, weißen Bart. Er muss eine faszinierende Persönlichkeit gewesen sein, denn er konnte sich acht Monate und siebzehn Tage im belagerten Mekka halten, ohne seinen Kämpfern auch nur den kleinsten materiellen Vorteil versprechen zu können. Doch Hedschadsch hatte alle Vorteile auf seiner Seite. Außerdem schickte er immer wieder verlockende Angebote in die Stadt, ab und zu von kleinen Kostproben der Näschereien in seinem Lager begleitet. Schließlich konnten nicht einmal mehr Abdallahs Söhne der Verführung widerstehen. Sie sahen die Aussichtslosigkeit der Lage ein und flüchteten. Zurückblieben etwa fünfzig kampffähige Männer und AbdaIlah.
Auch Abdallahs Mutter lebte noch. Sie war schon gut neunzig Jahre alt, die letzte, die den Propheten noch einigermaßen gekannt hatte. Zu ihr kam Abdallah: "Mutter, nahezu alle haben mich verlassen, sogar meine Familie. Der Feind erbietet sich, mein Leben zu schonen und meinen Unterhalt zu garantieren, wenn ich mich ergebe. Wie denkst du darüber?"
"Du musst selbst wissen, was du zu tun hast", sagte die alte Frau.
"Wenn du von deiner Sache überzeugt bist, musst du auch für sie sterben können. Freie Männer ergeben sich nicht, nur weil sie von feigen Kameraden verlassen wurden. Wenn es dir aber nur um rein irdischen Vorteil gegangen ist, musst du vernünftigerweise auch jetzt einen Kompromiss schließen". Behutsam küsste Abdallah ihren grauen Scheitel: "Dann trauere nicht um mich, Mutter".
Mit dem Schwert in der Hand ging er vor die Stadt. Einige Minuten später war er tot. Das war am 3. Oktober 692.
Fedajin und das überflüssige Jerusalem
Am 13. November 1974 hielt der ehemalige Bauingenieur Jassir Arafat seinen Einzug bei der UNO in New York. Applaus wie für einen Staatschef begrüßte den verwegen aussehenden Guerillero, und auch der für Staatsoberhäupter reservierte hochlehnige Armstuhl stand bereit. Demonstrativ nahm Arafat darauf nicht Platz. Stehend hielt er seine Rede voll arabischen Pathos: "Unsere Gegenwart ist eine atemberaubende Wiederholung aItarabischer Geschichte..."
Zumindest bei den Fedajin, seinen gefürchteten palästinensischen Freischärlern, hat Arafat selbst die Neuauflage eines blutigen Kapitels islamischer Geschichte besorgt. Fedajin bedeutet, wörtlich übersetzt, "Opferbereite", und ihr Selbstverständnis umschrieb Arafat mit dem Satz: "Ein ehrenvoller Tod im Kampf ist mehr wert als Leben Im Elend."
Unter genau diesem Motto zogen schon 1289 Jahre früher arabische Freischärler in den aussichtslosen Kampf, und auch sie nannten sich Fedajin. Damals aber kämpften sie nicht gegen die Israelis, sondern gegen ihre eigenen Glaubensgenossen, und sie kamen auch nicht aus Palästina sondern aus Kufa und Basra im heutigen Irak. Gemeinsam war den alten wie den neuen Fedajin nur ihre selbstmörderische Verzweiflung.
Mohammeds Enkel Hussein war aufgrund einer Einladung aus Kufa in den Tod marschiert, und während der frühen Jahre des Islam hatten sich die Kufaner den Ruf fundierter Charakterlosigkeit redlich erworben. Möglicherweise nicht ganz zu Recht, denn die Bevölkerung der schnell aufgewachsenen Stadt war hoffnungslos in Parteien zerfallen, ein getreues Spiegelbild des gesamten Islam. Sunniten also Parteigänger der Omajaden und Schiiten hielten sich annähernd die Waage, und bei der Tragödie von Kerbela sorgten nicht nur Obaidallahs Söldner, sondern auch Kufaner dafür dass in der Stadt alles ruhig blieb. Als sich dann in Mekka Abdallah und in Kufa Obaidallah zu Kalifen proklamierten spaltete sich aus den großen Parteien noch eine dritte ab, die für Abdallah eintrat und zeitweise die Geschicke der Stadt bestimmte. Einig waren sich alle drei nur gegen die vierte, kleinste Gruppe, die Charidschiten. Gegen diese angeblichen Terroristen fanden sich sogar Sunniten und Abdallahs Parteigänger zu einer grotesken Koalition.
In der Schia kam schon bald nach Kerbela schlechtes Gewissen auf. Kufa hatte Hussein im Stich gelassen. Nun, wo es eigentlich zu spät war, beschlossen die Schiiten Husseins Kampf fortzusetzen. Anfang Oktober 685 trafen sie sich vor den Stadtmauern von Kufa. Unter den Burnussen klirrten Schwerter. Natürlich war die Versammlung nicht geheim geblieben, und so meldete sich schon als zweiter Redner ein Abgesandter Abdallahs aus Mekka. Er machte den Vorschlag, seine Partei und die Schiiten sollten gemeinsam gegen die Omajaden ziehen. Doch die Schia meinte dies sei ein allzu weltlicher Kompromiss. Allein wollten sie Hussein rächen, und mit diesem Programm setzten sie sich zwischen sämtliche Stühle.
Das dürfte ihnen selbst klar gewesen sein, denn bei ihrem Auszug aus Kufa, am 20. Oktober 685, erklärte ihr Anführer: "Wir haben alle Brücken hinter uns abgebrochen. Wir haben alles verloren und nichts mehr zu gewinnen als den Tod".
Rund 16.000 Mann hatten sich gemeldet, und bevor sie in Richtung Damaskus marschierten, lagerten sie noch zwei Tage in Kerbela. In Syrien aber hatte gleichzeitig Abd-el Melik den Thron bestiegen. Einige Kilometer vor Damaskus lagerte Obaidallah mit seinen Truppen, ebenfalls ein Anwärter auf das Kalifat. Kaum erhielten die beiden Nachricht über den Anmarsch der Freischärler, beschlossen sie, ihren Machtkampf auf später zu verschieben. Als hätte es zwischen den beiden nie Differenzen gegeben, vereinigten sie ihre Armeen, und Anfang Dezember erwarteten bei Ain-el-Warda am Euphrat rund 60.000 gut gerüstete Soldaten die Fedajin.
Drei Tage dauerte die hoffnungslose Schlacht. Schon am ersten Tag waren die Fedajin eingekreist, doch sie kämpften so verbissen, dass sich die überlegene Armee hütete, ihnen allzu nahe zukommen. Sie schoss einen Regen von Pfeilen auf die Schiiten.
Da zog der Anführer der Fedajin sein Schwert und zerbrach dessen Scheide- das alte Zeichen, dass nun der letzte Kampf angebrochen sei. Dass dabei die unversöhnliche. Feindschaft quer durch die Stämme ging, beweist eine kleine Episode am Rande: Ehe es zum Gemetzel kam, wurden die mitgewanderten Kinder der Fedajin Stammesbrüdern auf der anderen Seite der Front in Obhut gegeben.
Nur ungefähr 120 der 16.000 überlebten das Massaker. Als sie nach Kufa zurückzogen, angeblich traurig darüber, dass sie noch lebten, kam ihnen ein stattlicher Heerzug entgegen ebenfalls Schiiten, die sich dem Kampf anschließen wollten. So schlecht war das ganze Unternehmen organisiert, dass sich nicht einmal der geplante Abmarschtag bei der Schia herumgesprochen hatte. Dennoch wurde der Wahnsinnsmarsch der Fedajin das große Heldenepos des Nahen Ostens. Noch heute kann fast jedes Kind in Syrien und im Irak die traurige Geschichte auswendig. Ich selbst hörte sie in einem palästinensischen Flüchtlingslager, ein langes Gedicht in Singsang:
"Wir haben nichts zu gewinnen. Wir haben nur unsere Verzweiflung. Wir haben unser Land verloren und unsere Freude.
Wir haben nur noch unsere Ehre, und deshalb werden wir sterben. Ihr könnt uns erschlagen, ihr könnt unsere Hütten zerstören, ,aber vorher werden wir euch noch verwunden. Mit blutiger Schrift werden wir in euer Fleisch schreiben, dass wir gekämpft haben. Ihr werdet uns Teufel nennen und Verbrecher, aber Allah ist mit uns. Ihr werdet den Tag mit unserem Blut röten, aber wir werden nachts eure Häuser verbrennen, die ihr dort gebaut habt, wo Allahs Land ist".
An dieser Stelle wurde ich stutzig und fragte meinen Begleiter, ob dieses Gedicht wirklich von den alten Fedajin handle und nicht von den Palästinensern. Nein, meinte er. "Diese Verse sind wirklich über tausend Jahre alt". Er musste es wissen, denn er war Historiker, außerdem kein Palästinenser, sondern UNO-Beamter. Wort für Wort übersetzte er, was der kleine Junge vor mir sang, die alte, neue Geschichte vom hoffnungslosen Kampf. Am Schluss wollte ich dem kleinen Sänger eine Tafel Schokolade geben. Er lehnte ab: "I am a Fedajin", krähte er.
Dass diese alten Verse noch heute so aktuell sind liegt ebenfalls an Abd-el Melik. Er nämlich ließ auf dem alten Tempelberg der Juden in Jerusalem den Felsendom errichten.
Das Bauwerk selbst ist eine architektonische Revolution im Islam: ein riesiger Zentral-Kuppelraum, von einem zweireihigen Arkadengang umgeben, mit prachtvollen Mosaiken und Marmor-Intarsien übersät. Eine derartige Pracht hatte es in der arabischen Welt noch nie gegeben. Zweifellos war die Hagia Sophia in Konstantinopel eine Patentante dieses Kunstwerks, und doch sind seine Formen so eigenständig, dass man sie nur als islamisch bezeichnen kann. Immer wieder wurde versucht, dieses einmalige Stück Architektur nach zubauen - seine Wirkung wurde nie wieder erreicht. Der Felsendom gehört zu den kostbarsten Architekturschätzen der Welt.
Natürlich wurde er nicht aus einer Kunstbegeisterung Abd-el Meliks errichtet, sondern aus politischem Kalkül. In Mekka, der heiligsten Stätte des Islam, saß ja Abdallah und auch die Bewohner von Medina waren auf die Omajaden nicht gut zu sprechen. So plante Abd-el-Melik allen Ernstes, das Zentrum des Islam von Mekka nach Jerusalem zu verlegen. Schließlich hatte ja schon der Prophet eine Zeitlang Jerusalem zur Hauptstadt seiner Bewegung machen wollen. Genau diesen Plan griff Abd-el Melik wieder auf.
Künftig sollten die Muslims statt um die Kaaba um den Opferfelsen Abrahams marschieren, von wo aus ja auch der Prophet seine Himmelfahrt angetreten hatte, und die wahre Heimat des Islam sollte wieder der Wüste und ihren zerstrittenen Stämmen überlassen werden.
Dann aber eroberten seine Truppen Mekka. Fast am selben Tag, an dem Abdallah fiel, wurde der Schlussstein in die Kuppel des Felsendoms gesetzt. Doch da war der Prachtbau peinlicher weise überflüssig geworden. Sogar sein Auftraggeber hatte daran jedes Interesse verloren - Abd-el Melik blieb den Einweihungsfeierlichkeiten fern.
"Mich reut das vergeudete Geld", schrieb er. "Mögen sich andere den Kopf darüber zerbrechen, was aus dieser Fehlplanung werden soll".
Sie wurde der zweitheiligste Platz des Islam. Und dass der Felsendom derzeit auf israelischem Territorium liegt, golden leuchtend über der Klagemauer, schafft uns Kopfzerbrechen.
Im Jahr 695 dem zehnten nach seinem Machtantritt, war Abd-el Melik tatsächlich Alleinherrscher im Islam. Nur mit den Charidschiten wurde auch er nicht fertig. Der dreißigjährige Bürgerkrieg hatte ihnen großen Zulauf gebracht, und weite Landstriche Persiens wurden praktisch von ihnen kontrolliert.
Zeitgenössische Chronisten bezeichnen sie stets als ein Rudel verzweifelter Räuber, doch die Landbevölkerung schien da anders zu denken. Sonst hätte sie kaum die Charidschiten gedeckt. Stets hatten die Bauern die Zeche der islamischen Armeen bezahlen müssen, und mit diesen Steuerforderungen verglichen scheinen die Charidschiten das billigere Übel gewesen zu sein. Sie hatten eine perfekte Guerillastrategie entwickelt, vergleichbar in unserem Jahrhundert am ehesten den Partisanen Titos und den Kämpfern Mao Tsetungs und wie diese bewegten sie sich in den Dörfern "gleich Fischen im Wasser".
Abd-el Melik schickte Hedschadsch, der sich in Mekka ja so glänzend bewährt hatte, nach Kufa. Er solle dort eine Armee gegen die Charidschiten ausheben.
Die Kufaner wollten nicht recht. Zweimal ließen sie ein regelrechtes Ultimatum verstreichen. Da bestieg Hedschadsch die Kanzel der Moschee und hielt eine kurze Rede über die Freuden des Militärlebens.
Während er sprach, wurde gleich in der Moschee einem Dutzend Wehrdienstverweigerer der Kopf abgeschlagen. Daraufhin drängten alle so stürmisch zu den Waffen, dass es eine Stunde später auf der Euphratbrücke zu einem Verkehrschaos kam.
Dass eine so bewirkte Kampfmoral gegen die Charidschiten nicht ausreichte, musste bald auch Hedschadsch erfahren. Schließlich schickte ihm Abd-el Melik eine ausgesuchte Armee syrischer Haudegen, und erst diese konnten einige kleine Siege erringen. Vor allem aber verwüsteten sie die persischen Länder so gründlich, dass für die nächsten zwanzig Jahre nicht einmal an ein bescheidenes Steueraufkommen aus diesen Gegenden zu denken war.
Damit musste sich Abd-el Melik nach neuen Einnahmequellen umsehen. Wollte er die riesigen Armeen, die er für den Bürgerkrieg ausgehoben hatte, bei Sold und somit bei Laune halten, musste er das Reich expandieren. Am wenigsten Widerstand hoffte er dabei in Tunesien zu finden, in der letzten afrikanischen Provinz des alten Römischen Reiches.
Tunesien war reich, der Ölgarten der Antike. Wer heute das karge Land bereist, kann sich kaum vorstellen, dass es einst der unendliche Garten war, ein einziger Hain jahrhundertealter Olivenbäume, mit leuchtenden Orangen in samtigem Grün, wie seine ersten islamischen Besucher schrieben. Sie waren nicht friedlich gekommen - von Ägypten aus hatten islamische Truppenverbände immer wieder das Land geplündert und schließlich sogar eine Karawanserei gegründet, das heutige Kairuan. Den Hauptstützpunkt Konstantinopels, Karthago, aber hatten sie gemieden.
Dann kam der Bürgerkrieg, und damit hatte Tunesien für eine Weile Ruhe. Allerdings verminderte sich auch die Streitmacht Konstantinopels - auch dort wurden infolge permanenter Thronstreitigkeiten sämtliche Truppen benötigt und Tunesiens Bauern sahen sie ohne Kummer ziehen.
Doch in das Machtvakuum stießen Berber aus dem Atlasgebirge. Sie nannten sich Zenata und waren Kamelzüchter. Mühelos überrannten sie sowohl die islamischen als auch die letzten römischen Stützpunkte. Innerhalb eines halben Jahres hatten die Zenata ganz Tunesien erobert.
Das erstaunlichste an der ganzen Geschichte aber ist, dass ihr Anführer eine Frau war.
Ihr Name ist nicht bekannt, nur der Titel, den ihr die Muslims gaben: Kahina, und das heißt Prophetin, aber auch Hexe.
Gegen sie zogen nun Abd-el Meliks Truppen, gierig auf die Schätze des reichen Landes. Doch als sie in Tunesien einfielen, erkannten sie die Gegend nicht wieder. Kahina hatte eine Vision gehabt: Wenn wir das Land in eine Wüste verwandeln, werden die Muslims kein Interesse mehr daran haben, und wir können in alle Ewigkeit hier ruhig unsere Kamele weiden. So ließ Kahina das Land buchstäblich in eine Wüste verwandeln.
Doch ihre Rechnung ging nicht auf: Einen Ölbaum zu fällen gilt im gesamten Orient als nicht wiedergutzumachendes Verbrechen und so hatten die Berber bald nicht nur die islamische Armee gegen sich, sondern auch die verarmten Bauern.
Dabei unterschieden sich die Manieren der Muslims nicht allzu sehr von denen Kahinas. 698 wurde Karthago erobert und wieder einmal dem Erdboden gleichgemacht. 844 Jahre zuvor hatten die Römer diese Stadt der Phönizier zerstört und über ihre Trümmer die Pflugschar geführt, doch die Lage der Stadt war zu günstig. Sie bauten Karthago wieder auf, prächtiger als es je zuvor gewesen. Nun machten die Muslims der Stadt ein Ende, und diesmal sollte es für immer sein. Einige Marmorsäulen, die kräftiger waren als die Brechstangen, ragen noch heute in den blauen Himmel. Das Erbe der alten Metropole aber trat ein zuvor unbedeutendes Fischerdorf an fünfzehn Kilometer westlich das heutige Tunis.
Die Zenata setzten daraufhin ihr Verwüstungswerk verstärkt fort und dadurch trieben sie die Tunesier als Freiwillige in die Armee des Islam. Im Jahr 702 war Kahinas Lage aussichtslos geworden. Da schickte die Amazone die Hälfte ihrer Söhne mit ihren sämtlichen Kamelen los: Sie sollten sich bei der islamischen Armee als Überläufer melden. Dieser scheinbare Wahnsinn hatte Methode und wird seitdem noch gerne in arabischen Kriegen praktiziert wie immer der Kampf ausgehen mag, ist ein Teil des Stammes gerettet und damit auch das Vermögen der Sippe.
Mit ihren restlichen Kriegern verschanzte sich Kahina im Kolosseum von El Dschem. Dort hatten die Römer das größte Stadion Afrikas errichtet aus weißem Marmor und mit vierzigtausend Sitzplätzen. Vier Tage lang stürmten die Muslims vergeblich gegen das riesige Mauerrund.
Da flogen plötzlich die schweren Tore auf. Aus dem Stadion preschten die Zenata, an ihrer Spitze Kahina auf einem schwer gepanzerten Kamel. Die Dame war splitternackt.
"Jetzt fahren wir miteinander in die Ewigkeit!" schrie die Amazone. Tatsächlich gerieten die Araber beim Anblick dieser nackten Hexe in so große Verwirrung, dass Kahina quer durch die Schlachtreihen entkam. Doch als sie schon das freie Feld erreicht hatte, traf Sie ein Pfeil in die Schulter.
Ihr abgeschlagener Kopf wurde nach Damaskus geschickt. Ob wohl er in Salz eingelegt war, soll er nicht mehr gut ausgesehen haben. Der Schauplatz ihres Todes jedoch ist heute noch eine Sehenswürdigkeit: Wer über die schnurgerade Strasse von Tunis nach El Dschem fährt, sieht schon von weitem das Kolosseum leuchten, umgeben von einem winzigen Dorf und der unendlichen Wüste, die Kahina aus dem Land gemacht hat Eine Szenerie von grandioser Absurdität: Sämtliche Bewohner im Umkreis von fünfzig Meilen würden nicht einmal eine einzige Sitzreihe füllen. Doch war hier einst eine blühende Stadt, die es durchaus mit anderen Metropolen der Antike aufnehmen konnte. Noch weit draußen in der Wüste weht der Wind manchmal Ruinen frei; bizarre Mosaikfische leuchten dann auf dem Boden vertrockneter Springbrunnen.
Die Nachkommen der Zenata werden übrigens auch heute noch von Frauen beherrscht: die Tuareg, die legendären "blauen Nomaden" der Sahara.
Abd-el Melik gilt auch als Schöpfer der islamischen Verwaltung. Tatsächlich wurde das Riesenreich bisher nach den Prinzipien Mohammeds regiert und nach den Reformen Omars. Am ehesten lässt sich seine Struktur mit dem Organisationsschema eines modernen multinationalen Konzerns vergleichen: einer zentralen Holding-Gesellschaft mit vielen Töchtern, die auf eigenes Risiko zu wirtschaften und nur einen bestimmten Gewinnanteil an die Mutter abzuführen haben. So wurde in den eroberten Gebieten die vorgefundene Verwaltungsstruktur beibehalten, der Besamtenstab, das Münzwesen und sogar die Amtssprache.
Die Statthalter waren zwar stets Araber, doch Sie herrschten als ziemlich autonome Manager, konnten Gesetze und Verordnungen erlassen und mussten nur alle fünf Jahre ihrem Kalifen Bucheinsicht gestatten.
Die Vorteile dieses Systems waren eine relativ kleine Zentralverwaltung und eine große jeweils den örtlichen Erfordernissen angemessene Beweglichkeit. In den Augen Abd-el Meliks überwogen allerdings die Nachteile des Föderalismus: Zu viele Provinzstatthalter führten ein allzu selbstherrliches Regime, und manche versuchten sogar den Kalifen durch Zurückhaltung der Steuergelder zu nötigen.
So verordnete Abd-el Melik dem Riesenreich eine straffe Zentralverwaltung nach römischem Vorbild, gewürzt mit persischer Despotie. Zunächst wurde das Steuerwesen reichseinheitlich organisiert und sämtliche Steuereintreiber direkt dem Kalifen unterstellt. Ein zentrales Finanzministerium teilte nun den Statthaltern einen jährlichen Etat zu und sorgte dafür dass sie damit nicht etwa eigene Unabhängigkeitsbemühungen finanzieren könnten. An Steuern waren zu zahlen:
Die Armensteuer Mohammeds. Sie betrug zehn Prozent des Bruttoeinkommens, galt für alle Untertanen und konnte auch in Naturalien entrichtet werden. Eigentlich sollte sie den Armen zugute kommen tatsächlich aber wurde nur etwa ein Drittel davon für soziale Maßnahmen verwendet.
Die Grundsteuer. Sie wurde nach Schätzungen von Staatsbeamten fest-gesetzt, musste in Geld entrichtet werden und betrug für Muslims 10 Prozent für Nichtmuslims aber 25 Prozent des angenommenen Einkommens.
Die Kopfsteuer Dschisdscha. Sie galt nur für Ungläubige und wurde jährlich von Beamten festgesetzt. Sinniger weise betrug sie 25 % vom Verkehrswert, den der jeweilige Mann auf dem Sklavenmarkt hätte einbringen können. Da sie in Geld zu entrichten war, brachte sie auch viele Bewohner des islamischen Reichs auf den Sklavenmarkt. Sie wurde die wohl verhassteste Steuer in der ganzen düsteren Finanzgeschichte der Welt.
Außerdem mussten die "eroberten Provinzen" ausgiebige Tributzahlungen leisten, und das jedes Jahr. Sehr bald erwies sich die Finanzreform der Omajaden als gigantisches Ausplünderungssystem: Persien beispielsweise musste bis zu 80 Prozent seines Bruttosozialprodukts nach Damaskus abliefern, Ägypten immerhin noch 75. Nur die arabische Halbinsel, Syrien Palästina und die Städte Kufa und Basra blieben davon verschont.
Dort musste bald ein Einwanderungsverbot erlassen werden.
Der Geldbedarf des islamischen Reichs stieg aber auch ins Unermessliche. Die Araber waren als Herrenmenschen über die Welt gekommen, und nun beanspruchten sie allein aufgrund ihrer Standeszugehörigkeit bereits Staatsgehälter von der Höhe, die Omar einst für die alten Glaubensstreiter festgesetzt hatte. Abd-el Melik zahlte sie freiwillig - schließlich waren die so gekauften Araber "die Stützen der gerechten Herrschaft". Zusätzlich zu diesem Volkszugehörigkeitsgehalt bezogen viele noch Sold als Offiziere der Armee: Aus dem ursprünglichen Verband arabischer Kaufleute war ein Militärorden geworden.
Interessant in diesem Zusammenhang mag sein, dass auch Adolf Hitler für den Fall des Endsieges ein "Grundgehalt für deutsche Volkszugehörigkeit" plante, das die übrige Welt hätte zahlen müssen. Und wir sollten über Abd-el Meliks Imperialismus keineswegs vom Sockel unseres Lebensstandards herab lachen: Politiker aus sogenannten Entwicklungsländern sehen in unserem System nicht zu Unrecht nur eine fein drapierte Variante der brutalen Raffgier des großen Kalifen.
Auch andere Maßnahmen Abd-el Meliks wirken erstaunlich modern. Er organisierte den Diwan neu und schuf außer dem Finanzministerium auch Ministerien für Verteidigung (so hieß es tatsächlich, obwohl seine Aufgabe natürlich der nackte Raubkrieg war), Wirtschaft, Soziales, Wissenschaft und Forschung, Äußeres und schließlich eines für das Postwesen.
Die Organisierung einer Staatspost war sein besonderes Anliegen, und die Planungsabteilung des zuständigen Diwan stöhnte bald über die Einfälle des Kalifen. So wollte Abd-el Melik die Beförderung geheimer Staatspost durch Brieftauben besorgen lassen. Eine an sich sinnige Idee, nur gehörte seit undenklichen Zeiten die Falkenjagd zu den Spezialitäten arabischer Länder.
Dadurch kamen Abd-el Meliks Erlässe selten in die richtigen Hände: Meist flogen die Tauben des Kalifen in die Klauen charidschitischer Falken, und das Projekt wurde bald aufgegeben.
Immerhin wurde im Lauf dieser Taubenjagd von den Hofkanzleien ein exzellenter Code entwickelt. Die Ver- und Entschlüsselungsabteilung entwickelte sich bald zu einem hervorragenden Staatsarchiv. Sämtliche offizielle Schreiben wurden hier in Abschriften gelagert und konnten auch von Historikern ausgewertet werden, und damit schuf der Islam die beste Geschichtsschreibung, die es bisher gab.
Außerdem wurde ein einheitliches Münzsystem eingeführt und Arabisch zur ausschließlichen Amtssprache erklärt. Sämtliche Bücher, die den Feuersturm der ersten Glaubensstreiter überstanden hatten, wurden nun ins Arabische übersetzt, und dieser Fleißarbeit der Hofkanzleien haben wir zu danken dass wenigstens einige Werke der alten griechischen Philosophen erhalten blieben. In arabischen Abschriften kamen sie in das Abendland, und dort erst wurden sie in ihre ursprüngliche Sprache zurückübersetzt.
Überhaupt entdeckten die Araber mit Abd-el Melik die Werte der von ihnen so lange bekämpften Kulturen. Selbstlos war diese Kunstbegeisterung natürlich nicht: Die neuen Herrenmenschen waren aus den Zelten in Paläste übersiedelt, und da keine arabische Bautradition vorhanden war, mussten die Baumeister zwangsläufig auf römische und persische Vorbilder zurückgreifen. Unter dem Halbmond verschmolzen diese ursprünglich sehr verschiedenen Stile zu einer faszinierenden Einheit, und die omajadischen Wüstenschlösser längs des Jordan sind heute noch großartige Architektur-Fossilien.
Gläubigen Zeitgenossen mögen diese Kunstwerke ein Gräuel gewesen sein. Der Prophet hatte Abbilder verboten und nur Ornamente gestattet. Über die Mosaike und Wandmalereien der Wüstenpaläste aber huschen wieder die bunten Fabeltiere der Antike, tummeln sich abenteuerliche Heldengestalten, und in den großen Höfen ragten sogar richtige Statuen. Unter dem Vorwand die arabische Kultur gehöre der ganzen Welt, hat die Nachwelt diese Pracht recht respektlos geplündert: vom größten Palast al-Muschattah bei Amman, landete ein stattlicher Fassadenteil im Museum von Berlin, ein zartes Spitzenwerk aus sprödem Kalkstein.
Auch die Musik wurde wieder entdeckt. Der Prophet hatte sie für Zeitverschwendung gehalten und verboten. Doch kein Volk hat je ohne Musik leben können, und so umgingen die Araber das aller höchste Verdikt mit einem Trick: Sicher hatte Mohammed nur Harmonien gemeint Gesang konnte doch keine Sünde sein, zumal man sich auch den Koran am besten mit Melodie Unterlagen merken konnte. So entwickelte sich der spezifische Musikstil des Ostens.
Auch die Instrumente empfinden stets nur die Beweglichkeit der menschlichen Stimme nach, linear und kammermusikalisch im Gegensatz zu den Akkord-Türmen abendländischer Musik. Dadurch blieb die Improvisation als Grundelemente des Musizierens erhalten, und Komponist und Ausführender sind stets ein und dieselbe Person. In der östlichen Musik, so befremdlich sie unseren Ohren manchmal klingt, blieb der schöpferische Atem reiner erhalten als in unserer Arbeitsteilung zwischen Komponisten und ihren Vollstreckungsgehilfen im Orchester.
Als Abd-el Melik 705 verstarb, sechzig Jahre alt und nach zwanzigjähriger Herrschaft, war die Macht seiner Familie so gefestigt, dass sein Sohn Welid widerspruchslos als Kalif anerkannt wurde. Seine Herrschaft versprach eine milde zu werden, denn die Interessen des Kalifen waren der Reihe nach: Pferde, Knaben, Frauen und Paläste. Damit war Welid hinlänglich aus-gelastet und erhielt von prüden Geschichtsschreibern den Beinamen ,"der Lasterhafte".
Allerdings dürfte er dabei nicht einmal für seine Lieblingsgattin so viel Zeit aufgebracht haben, wie der Dame lieb war. Sie brachte nämlich von einer Pilgerreise nach Mekka ein ganz besonderes Souvenir mit, den berühmten Dichter und Frauenhelden Waddah. Er tröstete die Dame, wenn der Kalif anderweitig beschäftigt war. Kam der Gatte, bezog Waddah in einer prächtigen Kleidertruhe mit Perlmutt-Einlagen Quartier.
Eines Tages jedoch bat der Kalif seine Lieblingsgattin um ein Geschenk. Ausgerechnet die Kleidertruhe wollte er haben, und die nervöse Fürstin konnte diese Bitte natürlich nicht abschlagen. Auf der Stelle ließ Welid das Möbel in seinen Thronsaal schleifen und vor dem Thron eine Grube ausheben. Dann rief der Kalif:
"Ich habe einen bestimmten Verdacht. Ist er wahr, will ich ihn hiermit begraben. Ist er unwahr verscharren wir nur eine hölzerne Truhe".
Dann wurde das Möbel ungeöffnet in die Grube gewuchtet mit Erde bedeckt, und als darauf die Teppiche wieder ausgebreitet waren, hörte niemand mehr etwas über den Dichter Waddah oder über eine eventuelle Untreue der Gattinnen des Kalifen.
Andere nannten Welid ,"den Siegreichen", da unter ihm das Reich seine größte Ausdehnung erfuhr, und beide Ehrentitel sind aufs innigste miteinander verbunden - um die Kosten für die Vergnügen des Kalifen zu bestreiten, blieb gar nichts anderes übrig, als wieder einmal neue Gebiete zu erschließen und zu plündern.
Die Voraussetzungen dazu waren günstig. Abd-el Melik hatte sich im Lauf seiner Regierungsjahre einen Stab verlässlicher und beim Volk gefürchteter Mitarbeiter aufgebaut. Auf dem Totenbett hatte er seinem Sohn geraten: "Lass die Hände von diesen Bluthunden, denn sie werden deinen Thron bewachen.
Und wenn du vernünftig bist, lass deine Finger von Reformen".
Welid war bequem und vernünftig, und so ließ er auch Hedschadsch auf dem Statthalterposten von Persien, obwohl alle seine Freunde geraten hatten, er solle doch als geschickte Werbemaßnahme für sein Regime wenigstens diesen Blutsauger abberufen.
Hedschadsch, der tatsächlich um seinen Job gezittert hatte, revanchierte sich: Die ihn beim Kalifen angeschwärzt hatten, ließ er nach und nach durch Agenten vergiften; seinem Herrn aber versprach er, "auch noch den Rest der Welt zu erobern".
Zunächst schickte er eine Armee nach Afghanistan. Ihre Ausrüstung war für damalige Verhältnisse einfach phantastisch und hatte fast hundert Millionen Mark gekostet. In die Geschichte ging sie als "Armee der Pfauen" ein. Ihr Führer aber war al-Eskat, und dem gefiel seine Armee bald so gut, dass er es schade fand, mit ihr gegen irgendwelche Barbaren marschieren zu müssen. Zwar zog er anfangs folgsam nach Afghanistan und eroberte dort selbst einige tausend Schafe und zweihundert Rinder. Dann aber änderte er die Befehlsrichtung, marschierte nach Basra und konnte tatsächlich im Februar 702 Hedschadsch aus der Stadt jagen.
Stolz rief sich al-Eskat zum Kalifen aus, aber da hatte er Hedschadsch unterschätzt. Heimlich sammelte der alle seine persischen Truppen, und nun wurden die Pfauen grässlich gerupft. Al-Eskat musste zum afghanischen König nach Kabul fliehen, dem er zuvor noch in die Schafherden gefahren war. Der König hatte das nicht vergessen, ließ ihn köpfen und schickte die Trophäe mit einem gutnachbarlichen Begleitbrief an Hedschadsch.
Ein Jahr später schon schickte Hedschadsch den Kopf des afghanischen Königs an Welid.
Zum Statthalter des Landes ernannte er diesmal sicherheitshalber einen Verwandten, seinen Cousin Kutaiba mit dem Auftrag, nun China zu erobern.
China begann damals gleich hinter Afghanistan. Mitten in den ausgedehnten Weidegebieten der türkischen Stämme hatten die Chinesen im Laufe der Jahrhunderte solide Handelsniederlassungen errichtet, von denen aus sie Europahandel betrieben. Mit den Türken lebten die Herren aus dem Fernen Osten in einer für beide Seiten einträglichen Symbiose: Türkische Viehzüchter betätigten sich als Spediteure der Chinesen, und der türkische Bevölkerungsüberschuss fand in chinesischer Industrie Beschäftigung. Das moderne Wirtschaftsspiel ausländischer Tochtergesellschaften wurde nämlich im alten China erfunden: Um Transportkosten gering und somit ihre Profite hoch zu halten, ließen schlitzäugige Unternehmer gleich an der Grenze ihrer Abnehmerländer produzieren. Samarkand am westlichen Ende der berühmten Seidenstrasse war so im Lauf der Jahre zu einer ansehnlichen chinesischen Industriestadt geworden. Seidenwebereien verarbeiteten aus China beschafftes Rohmaterial zu Brokaten, deren Muster sich nach der neuesten Mode Konstantinopels richtete. Porzellanbrennereien verringerten das Transportrisiko auf dem Weg in das Abendland, und der Stolz der Stadt war eine florierende chinesische Papierfabrik.
Für deren Konjunktur hatten die Araber gesorgt. Als die Muslims Ägypten eroberten, wurde im Abendland der Papyrus knapp. Bereits unter den alten Römern waren die zerklopften Schilffasern aus dem Nildelta das landläufige Schreibmaterial geworden. Als der Nachschub infolge Besitzwechsels im Herstellerland versiegte, drohte in Konstantinopel die Verwaltung zusammenzubrechen. Die Chinesen boten Ersatzware an: handgeschöpfte Bütten, wie sie auch heute noch unverändert hergestellt werden. Und sehr bald sprach sich im Westen herum, dass dieser Ersatzstoff unvergleichlich besser war als der alte, spröde Papyrus. Vergeblich versuchten vier als Priester getarnte Agenten des Kaisers von Konstantinopel dem eisern gehüteten Produktionsgeheimnis auf die Spur zu kommen: Als sie enttäuscht Samarkand verließen kamen ihnen schon Kutaibas Truppen entgegen.
Vier Monate lang belagerten die Muslims Samarkand und dabei wurden das erste Mal in der Geschichte Minen unter die feindlichen Befestigungsanlagen getrieben. Es war ein gnadenloser Kampf: Die Chinesen hatten schon lange das Schiesspulver erfunden, und ihre Bleigranaten wirkten verheerend unter den Muslims.
Im März 712 stürzte schließlich ein breites Stück total unterminierter Stadtmauer ein. Durch die breite Bresche stürmten die Muslims und metzelten in einem wahren Blutrausch die gesamte chinesische Garnison nieder. Kutaiba selbst bedauerte sehr bald das Blutbad - so konnte er nie mehr die Zusammensetzung der chinesischen Wunderwaffe erfahren. Die Papierfabrik aber fiel mit allen ihren Facharbeitern in seine Hände und sollte die wertvollste Beute des Islam werden. Sie wurde nach Damaskus verlegt, später wurden auch noch Zweigwerke in Bagdad Kairo, Sizilien und Spanien errichtet, und so verfügte die Welt des Islam bald über unbegrenzte Mengen billigen Schreibmaterials, fünfhundert Jahre früher als das Abendland. Während im Westen Tierhäute zu Pergament gegerbt werden mussten und Bücher dadurch zum fast unerschwinglichen Luxus wurden gehörten umfangreiche Folianten bald zu den Gebrauchsgegenständen des islamischen Alltags, ganz abgesehen davon, dass damals wie heute das meiste Papier für Verwaltungsangelegenheiten vergeudet wurde.
Die Chinesen waren an Krieg nicht sehr interessiert, und nach dem Verlust ihrer wichtigsten Handelsniederlassung machten sie Kutaiba ein Verhandlungsangebot.
Kutaiba schickte zwölf ausgesuchte Jünglinge auf die lange Reise nach Peking. Sie dachten der Kaiser von China würde sich gar sehr fürchten, aber da hatten sie sich geirrt. Drei lange Audienzen standen sie vor dem "Thron des Himmelssohns", ohne dass sie ihre Botschaft anbringen konnten. Der Kaiser begnügte sich damit, sie freundlich lächelnd anzusehen. Es fiel kein einziges Wort, und die zwölf Jungdiplomaten waren bald mit ihren Nerven am Ende.
Endlich, beim vierten Termin sprach der Kaiser. "Was wollt ihr denn eigentlich hier?" waren seine Worte, der Nachwelt festgehalten sowohl in islamischen Chroniken als auch im chinesischen Hofprotokoll.
"Unser Herr Kutaiba", antwortete der islamische Botschafter, "hat den feierlichen Schwur getan nicht eher zu ruhen, als dass er seinen Fuß auf chinesische Erde gesetzt, das Zeichen des Islam auf chinesischen Nacken gedrückt und Tribute empfangen hat".
Da lächelte der Kaiser von China. "Wenn es weiter nichts ist, kann ihm geholfen werden. Wir werden ihm eine goldene Schale voll Chinesischer Erde schicken, da kann er drauf herum trampeln. Wir werden ihm zwei Leute schicken. Die darf er mit seinem Herrschaftssiegel stempeln, soll sie aber dann wieder gesund an uns zurückschicken. Nur Tribute zahlen wir nicht. Wir befassen uns ausschließlich mit reellen Geschäften".
Und so geschah es. Die Geschäftsverbindungen zwischen Islam und China entwickelten sich von nun an für beide Teile zufriedenstellend, und nur das Abendland hatte das Nachsehen, zumal im selben Jahr islamische Armeen auch das heutige Pakistan eroberten und somit die wichtigsten Handelswege der Alten Welt vom Halbmondkonzern beherrscht wurden.
Nur einmal gab es zwischen dem Kalifen Welid und seinem Statthalter Hedschadsch eine Meinungsverschiedenheit und sie entbrannte typischerweise wieder einmal an den Städten Mekka und Medina. Wie jeder Mensch, der sein Triebleben unbeschränkt ausleben kann war Welid ein durchaus friedfertiger Charakter und so hatte er gleich nach seiner Thronbesteigung den schwer geprüften Städten einen neuen Gouverneur gegeben seinen Cousin Omar.
Dieser junge Mann war durch seine Mutter ein Urenkel des ersten Omar dem Bismarck des Propheten, dessen Regime schon längst ein goldenes Zeitalter seliger Erinnerungen war. Der erste Omar war das große Vorbild des zweiten. Kaum trat der Vierundzwanzigjährige seinen Posten an, bemühte er sich, seinem Urgroßvater so sehr nachzueifern, dass er gleichermaßen ein Gegenstand des Spottes wie der Bewunderung wurde. Wie einst Omar lief auch Omar prinzipiell nur in einem zerfetzten Kaftan durch die Gegend. Obwohl die schwärmerische Religiosität Omars durchaus echt war wirkte sie lächerlich beim Spross einer Familie, die schon längst in aller Öffentlichkeit Wein trank und kaum mehr den Koran auswendig konnte. Omar versuchte tatsächlich, die schweren Sünden seiner Sippe durch ein versöhnliches Regiment gutzumachen: Sein Staatsgehalt verwendete er für ein Arbeitsbeschaffungsprogramm. Aus eigenen Mitteln ließ er die Kaaba und die Moschee von Medina ausbauen und bremste da mit vorübergehend die durch Austrocknung des Handels erzwungene Abwanderung.
Er versuchte, das daniederliegende Handwerk wieder anzukurbeln, zeigte sich mehr als nachsichtig in der Steuereintreibung und erwarb sich damit einen so guten Ruf im Reich des Islam, dass aus den persischen Ländern, wo Hedschadsch hauste, massenhaft Auswanderer zu Omar flüchteten.
Hedschadsch empfand dies als persönlichen Angriff. Wütend reiste er nach Damaskus und forderte die Abberufung Omars. Welid sträubte sich lange, aber im Jahr 710 gab er dann doch nach und schickte Omar im wahrsten Sinne des Wortes in die Wüste.
In einer stillgelegten Karawanserei wurde der allzu milde Statthalter unter Hausarrest gestellt.
Vier Jahre später starb Hedschadsch, nach zwanzigjähriger Statthalterschaft und erst fünfundvierzig Jahre alt. Er war zweifellos die verhassteste Gestalt des ganzen Islam und sein Ende war seiner würdig. Hedschadsch wurde buchstäblich bei lebendigem Leib von Würmern zerfressen. Während seiner letzten Tage ließ ihn sein Arzt ein Stück Fleisch an einem Faden verschlingen. Als er es wieder herauszog, soll es voll Maden gewesen sein.
Möglicherweise starb Hedschadsch auch an Syphilis in seinen beiden letzten Jahren zeigte er unübersehbare Zeichen von Wahnsinn. Auf jeden Fall aber ist er der Erfinder der Konzentrationslager. Er ließ große, torlose Mauergevierte mit massiven Wachttürmen errichten, ohne Dach und ohne Wasser. Bei seinem Tod wurden daraus über 30.000 Männer und fast 20.000 Frauen befreit. Nur dass er sich bei seiner Machtfülle persönlich bereichert hätte, konnten ihm nicht einmal seine schlimmsten Feinde nachsagen. Hedschadschs gesamte Hinterlassenschaft bestand aus einem zerlesenen Koran, einem Schwert, dreihundert Mark Bargeld und neunhundert Panzern.
Ein Jahr später bemerkte auch Kalif Welid ernste Verschleißerscheinungen - obwohl er erst Mitte der Vierzig war. Von seinen Ärzten ließ er sich daher immer stärkere Aphrodisiaka brauen. Eines davon wirkte sogar überaus befriedigend, doch nach sechs Knaben und drei Frauen machte Welids Kreislauf nicht mehr mit: am 27 Februar 715 verschied der Kalif in seinem Badezimmer, angeblich noch Im Tode von aufrechter Männlichkeit.
Im Kalifat folgte ihm sein Bruder Salaiman. Er war nicht weniger lebenslustig als Welid - die Söhne des düsteren Abd-el Melik schienen in Sachen irdischer Genüsse einen erstaunlichen Nachholbedarf zu haben.
Bei seinem Regierungsantritt warf sich der knapp dreißigjährige Kalif in ein grünes Seidengewand wie es bislang nicht bei Hofe gesehen wurde und jubelte vor versammeltem Gefolge: "Bin ich nicht ein strahlender König?" Niemand wagte ihm zu sagen, dass Kalif eigentlich "Nachfolger des Propheten" bedeute und absolut nicht König. Genau gegen Könige waren einst die Muslims ausgezogen - doch die Zeiten hatten sich geändert. Ansonsten war Salaiman ein milder Herrscher. Regieren interessierte ihn überhaupt nicht. Salaiman verbrachte seine Regierungszeit an der Tafel. Bei seiner Machtübernahme fraß er allein ein ganzes Lamm sechs Hühnchen, siebzig Granatäpfel und einen Korb Rosinen.
Sein restliches Interesse galt der Eroberung von Konstantinopel. Eine alte Prophezeiung hatte ihn auf diese Idee gebracht: Ein Mann mit dem Namen eines Propheten werde einst die Stadt besiegen. Nun war Salaimans Name die Übersetzung des biblischen Salomon. Daher rüstete der junge König eine stattliche Flotte und eine große Armee aus. Die Worte der Propheten sind mit uns euer Marsch wird ein Vergnügen, sagte er seinen Truppen zum Abschied.
Er wurde keines. In Konstantinopel saß nach langer Zeit wieder einmal ein Kaiser fest auf seinem Thron, und auch das griechische Feuer war mittlerweile weiterentwickelt und auf einen Stand gebracht worden den die Muslims nicht voraussehen konnten. In einem einzigen Flammenmeer ging die Flotte unter, und die Landarmee erfror im unerbittlichen anatolischen Winter. Die Prophezeiung allerdings war richtig: 1453, also fast siebenhundert Jahre später wurde Konstantinopel tatsächlicherobert, von einem Sultan namens Mohammed.
Salaiman nahm sich das Desaster sehr zu Herzen. Von nun an ließ er seine Finger von der Politik und griff nur noch zu Süßigkeiten. Nach nicht einmal zweijähriger Regierungszeit ist er dann an Verstopfung gestorben.
Seine Regierungsgeschäfte hatte hauptsächlich jener Omar geführt der von Welid wegen Milde verbannt und von Salaiman aus dem Wüstenschloss geholt wurde, um seinem Bruder noch postum einen Tort zu tun. Überhaupt war Salaiman mit seiner ganzen Bruderschaft zerstritten, und so ernannte er den milden Omar auch zu seinem Nachfolger.
Salaimans Testamentseröffnung glich einem Staatsstreich. Während im Thronsaal noch die hoffnungsvoll versammelten Erben enttäuscht aufheulten, wurde Omar über eine Hintertreppe des Palastes vor das Pferd des Kalifen gezerrt.
"Wollt ihr mich umbringen?" fragte er, und als er vor dem Prunkross stand: "Was habt ihr mit mir vor?"
"Du bist Kalif, und jetzt sollst du in die Moschee reiten und dir huldigen lassen! "
"Kalif wie einst Omar?" fragte Omar verdattert. Dann richtete er sich groß auf: "Wenn dem so ist, bringt mir einen einfachen Maulesel."
Und so regierte Omar auch, mit penetrant hochstilisierter Einfachheit und völlig ungewohnter Milde. Eine seiner ersten Amtshandlungen war, das Verfluchen der Schia in den Moscheen abzuschaffen. Als nächstes erleichterte er den Übertritt zum Islam und damit in eine niedrigere Steuerklasse.
Im gesamten Reich erscholl darauf das Lob des gütigen Kalifen. Die Sippe aber tobte: "Wenn die Steuern weiter so zurückgehen, können wir bald nicht mehr unseren Lebensstandard halten." Omar lächelte: "Dann schränkt euch eben ein."
Genau das aber wollten die verwöhnten Söhne Abd-el Meliks nicht. Und da Omar wie sein Vorbild und Urgroßvater leidenschaftlich gerne Datteln aß, mischten sie einige mit Arsenik präparierte in seinen Obstkorb. An seinem 39. Geburtstag, dem 10. Februar 720, naschte der Kalif davon. Die weiche Welle hatte nur zwei Jahre und fünf Monate gedauert.
Über den nächsten Kalifen und dritten Sohn Abd-el Meliks Jezid II., wird nur berichtet, dass er seine vierjährige Regierungszeit vorwiegend in den Armen einer knusprigen Negersklavin verbrachte. Als ihm dann Hischam, der jüngste Spross des Hauses, in der Regierung folgte, zeigte Abd-el Meliks Staatsgebilde bereits Auflösungserscheinungen. Dank Omars Großzügigkeit in Bekehrungsangelegenheiten waren die Einkünfte allein aus Ägypten auf die Hälfte geschrumpft, und auch in den Provinzen des Ostens herrschten eher Schiiten und Charidschiten als der Kalif.
Hischam selbst war ein kühler Pragmatiker, ein Techniker der Macht, aber nicht ohne Humor. Er schielte beachtlich, und als er einmal an einem Kavalleriebataillon vorbeiging, scheute das Pferd eines Offiziers.
Das kommt davon, weil Siegenau so schief dreinsehen wie unser Tierarzt, entschuldigte sich der Reitersmann beim Kalifen. Ich bin ein Kurpfuscher anderer Art, knurrte der und ging weiter. Derlei fröhliche Majestätsbeleidigungen sollten bald nicht mehr möglich sein.
Als Hischam nach neunzehnjähriger Regierungszeit starb, hinterließ er ein Reich, das für die damalige Welt eigentlich schon zu groß geworden war. Siebentausendzweihundert Kilometer maß es, von Ost nach West gerechnet, und bei den herrschenden Verkehrsmöglichkeiten war eine einheitliche, geordnete Zentralverwaltung ein Ding der Unmöglichkeit. "Ich fürchte, wir haben uns zu Tode gesiegt", soll der Kalif einmal gesagt haben. "Keine Hand weiß, was die andere tut. Wahrscheinlich arbeitet jede in ihre eigene Tasche". Hischams letzte Lebensjahre waren von Misstrauen verbittert. In sein Tagebuch schrieb er: "Ich habe alle Freuden der Welt genossen bis auf eine - nie war mir die Gesellschaft eines echten Freundes vergönnt, in der ich meine Wachsamkeit entspannen konnte in allem, was zwischen uns geschah".
In diesen Jahren gewann die Schia neuen Auftrieb, die alte Partei der Nachkommen Alis. Omar hatte versucht, diese Geschworenen Gegner der Omajaden in das Reich zu integrieren mit soviel Erfolg, dass ihre Anhängerschaft vorübergehend tatsächlich bedeutungslos wurde. Unter Hischam schien sie plötzlich einen neuen Geldgeber gewonnen zu haben, mit schier unerschöpflichen Mitteln. Vergeblich versuchte der Geheimdienst des Kalifen, den Finanzier der Staatsfeinde ausfindig zu machen.
"Alle Macht der Familie des Propheten", wurde in nächtlichen Aktionen an fast alle Hauswände des Riesenreiches gepinselt, doch die Nachkommen Alis waren so verarmt, dass sie nicht einmal Geld für Farbtöpfe hatten, und standen außerdem unter strenger Bewachung. Sie konnten also nicht hinter der Kampagne stecken. Wer aber dann?
Hätte Hischams Verfassungsschutz einfach die Superreichen des Landes unter die Lupe genommen, hätte er bald die Richtigen gefunden. Sie waren sogar tatsächlich mit dem Propheten verwandt, wenn auch nicht dessen Familie oder Nachkommen. Kurz: Es war die Familie Abbas.
Abbas der Onkel Mohammeds spielte zu Lebzeiten des Propheten eine ziemlich zwielichtige Rolle.
Zunächst hatte er erbittert gegen den Islam gekämpft, war dann nach seiner Gefangennahme in Bedr dem Islam beigetreten, hatte aber sein großes Handelsunternehmen nur zu fünf Prozent in den Islam eingebracht.
Da er wichtige Außenhandelsniederlassungen in Indien, Konstantinopel und im heutigen Tanger hatte, wurde er dem Propheten bald unentbehrlich.
Nach dem Tod Mohammeds versuchte Abbas, im Islam ein gewichtiges Wort mitzureden, und warf dabei seine Außenbüros so lange in die Waagschale, bis sie ihm Omar für die größte Barsumme ablöste, die je in der Geschichte des Islam bezahlt wurde. Damit gründete Abbas eine Bank, und bei dieser Gelegenheit soll er auch den bargeldlosen Zahlungsverkehr erfunden haben, den Scheck.
Sein Enkelsohn Ali war auf jeden Fall der reichste Privatmann des Islam. Während das Handelshaus des Propheten zur Religion und zum Staat wurde besorgte Ali ziemlich ausschließlich die Wirtschaft. Seine Bank kontrollierte die wichtigsten Import- und Exportfirmen und an jedem Krieg des Islam verdiente die Beni Abbas fast soviel wie der Kalif. Denn 90 Prozent der Rüstungsindustrie gehörten der Familie, vor allem die großen Waffenschmieden von Damaskus, die Produzenten der berühmten Damaszenerklingen. Über tausend Manufakturen für Bogen und Pfeile, siebenhundert Schwertschmieden, beinahe dreitausend Panzer-Konfektionäre arbeiteten für den Profit des Hauses Abbas, und da auch die Feinde der Kalifen zur Kundschaft gehörten, verfügte die Sippe bald noch über eine zusätzliche Einnahmequelle : Jede Partei zahlte gerne Bestechungsgelder, auf dass die Gegenseite mit minderwertigem Material versorgt werde.
Im Vollgefühl dieser Macht wagte Ali ben Abdallah ben Abbas auch eine im Islam noch nie da gewesene Provokation. Als Abd-el Melik eine seiner zahlreichen Ehefrauen verstieß, ehelichte sie Ali am nächsten Tag und lud den Exgatten auch noch zum Hochzeitsmahl. Abd-el Melik grollte, wagte aber nicht, sich mit dem allmächtigen Industriellen anzulegen. Erst Welid rächte die Ehre seines Vaters. Er ließ Ali auspeitschen und in Ketten über den Basar von Damaskus führen.
Ali zog sich aus der Stadt zurück, in der ihm solche Schande widerfahren war. Bei Humaima in Jordanien baute er einen stattlichen Palast, nannte ihn "Haus Hügel" und regierte nun von dort aus sein Firmenimperium.
Sein Sohn und Nachfolger Mohammed wollte ebenfalls die Ehre seines Vaters rächen. Warum, fragte er sich, solle seine Firma nicht gleich den Staat übernehmen, dessen wichtigster Zulieferer sie war? Zunächst befahl er, dass nur noch die Waffenschmieden von Damaskus den Kalifen belieferten. Alle anderen Betriebe sollten vorerst für das Lager arbeiten.
Dann schickte er seinen fähigsten Prokuristen in die ohnedies unruhigen persischen Provinzen, er solle sich bei der dortigen Schia umsehen.
Der Mann hieß Abu Muslim, aber das war nur sein Deckname. In Wahrheit hieß er Abd-er Rachman und hatte als Sklave bei Mohammed Abbas angefangen. Nach den Beschreibungen, die von ihm vorhanden sind, war er Mulatte, auf jeden Fall aber ein Organisationsgenie. Als Buchhalter in einer kleinen Waffenschmiede begann seine steile Karriere. Zwei Jahre später war er bereits Privatsekretär des Konzernchefs, wiederum ein Jahr später wurde er offiziell freigelassen, nannte sich nach seinem ehemaligen Herrn nun Ben Mohammed und übernahm die Prokura. Nun reiste er als Abu Muslim zunächst nach Kufa und spann dort seine Kontakte zur Schia. Er muss ein Meister der Beredsamkeit gewesen sein und ein geschickter Taktiker. Kämpft für die Familie des Propheten, war seine Losung. Geschickt verschwieg er, dass es sich hierbei keineswegs um die Nachkommen Alis handelte wie sämtliche Schiiten annahmen, sondern um die Familie Abbas.
Bald lichteten sich die Waffenhalden, die mittlerweile entstanden waren und kein Agent des Kalifen fand heraus, wohin die Kriegsgeräte gelangten. Dabei waren die Geschäftsbücher der Abbasiden Dokumente feinster Komik. Eine Faktura aus jener Zeit ist erhalten geblieben: "Für einen leidenschaftlichen Gazellenjäger (ausschließlich persönlicher Gebrauch): 700 Bogen aller feinster Qualität, Sonderpreis 140.000 Mark; 1.200 Schwerter extra lang, Militärausführung, Sonderpreis 100 Mark..." Der Kalif musste normalerweise für ein Schwert schon 900 Mark bezahlen!
Dann brachen in Chorasan die ersten Aufstände der Schiiten aus. Bei den Zusammenstössen mit den Regierungstruppen stellte sich heraus, dass die Rebellen wesentlich besser ausgerüstet waren und die aus Damaskus bezogenen Schwerter offensichtlich Sollbruchstellen aufwiesen.
Der Kalif setzte einen Untersuchungsausschuss ein, der ausgerechnet unter dem Vorsitz von Mohammed Abbas zusammentrat und erfolglos wieder auseinander ging. Und der Geheimdienst gewann nur eine einzige Erkenntnis: dass die Aufrührer über unerschöpfliche Geld- und Rüstungsmittel verfügten, unter schwarzen Fahnen auftraten, und dass ihre Werbeagenten schwarze Armbinden trugen.
Daraufhin wurde die Farbe Schwarz per Edikt verboten und allen Personen des öffentlichen Lebens die weiße Farbe der Omajaden verordnet. Sogar der schwarze Stein der Kaaba wurde weiß getüncht.
Kurz darauf starb Hischam, der Kalif. Aufgrund eines langjährigen Vertrages wurde nun sein Neffe Welid II. Beherrscher der Gläubigen.
Auch Mohammed starb einen Monat später. Sein Sohn Ibrahim übernahm die Firma und beschloss, den Kampf gegen das Herrscherhaus zum siegreichen Ende zu führen.
Die Zeit schien günstig. Welid hatte sich bereits als Kronprinz einen hinlänglich schlechten Ruf erworben. Da sein Onkel nicht und nicht sterben wollte, war er aus Langeweile zum Säufer geworden. Nebenbei schrieb er auch Gedichte, und wir danken ihm einige der schönsten Frivolitäten des Islam: "Der Kalif Welid bin ich und in Seidenkleidern Geh' stolz ich in die Zimmer eurer Frauen.
Ich kümmere mich um niemanden, der Anstoß nimmt.
Ich liebe die Musik und auch den Wein.
Sie geben Seligkeit und dumpfen Rausch.
Des Paradieses Freuden brauch´ ich nicht Kein Mensch, der bei Verstand ist, glaubt an so was."
Damit machte er sich aber nicht nur sämtliche religiösen Führer des Landes zu Feinden, sondern auch seinen eigenen Hofstaat. Als der Kalif für seine Schiessübungen eines Tages gar den Koran als Zielscheibe benützte und am Abend in aller Öffentlichkeit der Frau des Premierministers einen Besuch abstattete, beschloss der Diwan, sich einen neuen Kalifen zu suchen.
Freiwillig bot sich Jezid, sein Cousin an. An der Spitze von rund zweihundert bis an die Zähne bewaffneten Soldaten drang er in den Palast des Kalifen ein.
Welid saß gerade in seiner Hausbar, auf dem Dach des Torturms. Als er die Rotte sah, sprang er in den Graben, und mit dem Glück, das nur Betrunkene haben, entkam er ohne die geringste Verletzung. Mit einem kleinen Bataillon seiner Leibgarde verschanzte er sich in einem Fort außerhalb der Stadt.
Jezid ließ die kleine Festung sofort von der restlichen Leibgarde umzingeln. Welid gelobte Reue und versprach keinen Tropfen Alkohol mehr anzurühren. Jezid erleichterte ihm den Vorsatz: Noch am selben Abend ließ er das Fort stürmen.
Am 17. April 744 wurde der Kopf des Kalifen, auf eine Lanze gespießt, durch Damaskus getragen.
Viele Getreue des Hauses Omaja fanden derlei offen ausgetragene Familienstreitigkeiten schadeten dem Ansehen der Sippe. Besonders erbost aber war ein gemeinsamer Onkel der beiden namens Merwan. Er war schon ein älterer Haudegen, sein Leben lang von einer Schlacht zur anderen gezogen und sein Starrsinn hatte ihm den Beinamen "der Esel" eingetragen. Als er von den Ereignissen in Damaskus hörte, stand er gerade mit einer Armee in Persien und versuchte, dort mit aufständischen Schiiten fertig zu werden. Sofort gab er seinen Truppen einen neuen Marschbefehl, nach Damaskus, um dort die Ordnung wiederherzustellen. Damit aber war das Chaos erst perfekt. Jezid, der frisch ausgerufene Kalif, reiste mit einer Armee Merwan entgegen und versuchte zu verhandeln. Merwan bestand darauf, einen der Söhne Welids zum neuen Kalifen zu ernennen. Jezid geriet darüber so in Erregung, dass ihn der Herzschlag traf. Daraufhin lief seine Armee ebenfalls zu Merwan über und die Vereinigten Streitkräfte marschierten gegen Damaskus.
Dort wurde mittlerweile Ibrahim, ein Bruder Jezids, zum Kalifen ausgerufen. Er sah ein dass er sich in Damaskus nicht halten konnte und floh. Vorher aber ließ er noch die beiden Prinzen umbringen für die Merwan sich stark gemacht hatte.
Als Merwan am 23. November 744 in Damaskus einmarschierte, wurden ihm die Leichen der beiden Kinder entgegen getragen.
Nun blieb Merwan nichts übrig als zur Moschee zu ziehen und sich selbst zum Kalifen zu ernennen. Fröhlich war ihm dabei nicht zu Mute seine Thronrede stammte aus dem alten Buch Hiob: »Es lassen von mir ab meine Verwandten, meine Bekannten vergessen mich. Meinen Knecht rufe ich und er antwortet mir nicht.
Mich verabscheuen meine Freunde, und die ich liebte, kehren sich gegen mich."
Die Nachwelt hat ihm Übel am Zeug geflickt, und sogar sonst seriöse Chronisten Überbieten sich in unglaublichen Schauergeschichten über Merwan. Beispielsweise soll er krankhaft gierig nach frischen Hammelnieren gewesen sein: Sobald er irgendwo ein Schaf weiden sah, stürzte er sich darauf und riss ihm die Nieren aus dem lebendigen Leib! Über zehntausend Hammel soll der Kalif auf diese Weise eigenhändig erlegt haben.
Das gelindeste Argument gegen die Horrorberichte ist, dass Merwan für solche Hobbys kaum Zeit hatte: Schon als er den Thron bestieg, flammte an allen Ecken und Enden des Reichs die Revolution auf. Und die Aufrührer trugen schwarze Fahnen, ab und zu aber auch die roten der Charidschiten.
"Der Esel" hoffte, mit den Charidschiten als erstes fertig zu werden. Während er seine gesamte Streitmacht gegen die Guerillas anrennen ließ, organisierte Abu Muslim in Chorasan in aller Seelenruhe eine Armee für seine Firma. Am meisten Zulauf fand sie natürlich bei den Konvertiten, den zum Islam Übergetretenen, aber von den arabischen Omajaden stets nur als Bürger zweiter Klasse Behandelten. An einem schönen Junitag des Jahres 747 erhielt Merwans Statthalter in Persien eine Schreckensbotschaft:
In allen Städten der Provinz tauchten plötzlich bislang anständige Bürger in schwarzer Kleidung auf, von Stunde zu Stunde mehr.
Wie es Abu Muslim gelungen ist, die gewiss sehr aufwendigen Vorbereitungen für diesen ,Tag der wahren Kleidung, bis zum letzten Augenblick geheim zuhalten, wird sich nie ergründen lassen. Auf jeden Fall bewirkte diese genial geplante Aktion die totale Demoralisierung der Regierungstruppen. Zu zahlreich waren plötzlich die Aufrührer, um dagegen etwas unternehmen zu können. Während Merwan in Arabien seine Kräfte gegen die Charidschiten zersplitterte, besetzte Abu Muslim nahezu kampflos eine Stadt nach der anderen. Überall ließ er "der Sippe des Propheten" huldigen, und kein einziger Schiit merkte, dass damit die Familie Abbas gemeint war.
Auch Merwan wusste nicht, wer hinter der Revolte stand. Ja, er besuchte sogar noch Ibrahim Abbas in seinem "Haus Hügel", nannte ihn die treueste Stütze meiner Macht und bestellte umfangreiche Waffenlieferungen.
Ibrahim versprach, sein Bestes zu tun, und Merwan war so gerührt, dass er den Industriellen umarmte. Da fiel aus dessen Ärmel ein Brief. Merwan selbst hob ihn auf, um ihn seinem Besitzer zurückzugeben. Da fiel ihm auf, dass Ibrahim sehr nervös wurde. Merwan las den Brief er stammte von Abu Muslim. Noch am selben Abend bezog Ibrahim Abbas eine Zelle in Merwans Palast.
Damit aber war die Revolution nicht zu bremsen. Ibrahim hatte wohlweislich schon seinen Bruder Abdallah zu seinem Nachfolger in der Firmen- und Revolutionsleitung bestellt, und der übernahm reibungslos das Kommando. Vergeblich ließ Merwan auch durch Anschläge verbreiten, dass die Schiiten betrogen würden und nicht ein Nachkomme Alis sondern ein Abbaside ihr wahrer Thronanwärter sei - kein Schiit glaubte dem Omajaden. Vor allem aber konnte sich Abu Muslim nun ungestört dem Kampf widmen denn für die Zivilangelegenheiten der Revolution hatte er einen nicht weniger genialen Mitarbeiter gefunden, Chalid Ben Bermek aus Balch.
Dessen Vater war Geber gewesen ein hoher Feuerpriester der Parsen, der alten persischen Religion des Propheten Zoroaster. Wie er in Wahrheit hieß, wissen wir nicht. Der Name Bermek bedeutet Sauger, und der Feuerpriester erhielt ihn, als er in islamische Gefangenschaft geriet. Unter den Gebern, die auch Magier genannt wurden scheint Bermek eine hervorragende Rolle gespielt zu haben. Sonst hätte ihn nicht der Statthalter persönlich verhört während alle Berufskollegen kommentarlos hingerichtet wurden. Beim Verhör fiel dem Statthalter ein prunkvoller Ring an der Hand des Priesters auf.
"Was willst du als Priester mit diesem Ring?" fragte er.
Darin ist Gift und das werde ich saugen, wenn du mich zum Tod verurteilen willst, denn ich will aus eigenem Willen sterben, antwortete der Priester. Wirst du dich aber gnädig zeigen, werde ich dir ganz Persien untertan machen. Von diesem Augenblick an wurde Bermek Mittelsmann zwischen den arabischen Herren und deren persischen Untertanen, wobei ihm nie nachgewiesen werden konnte, dass er gleichzeitig auch stets die Rebellen gegen den Islam unterstützte. Sein Sohn Chalid schlug sich eindeutig auf die Seite der Schia, unter der Bedingung dass er beim Sieg der Abbasiden Ministerpräsident mit dem Titel ein es Großwesirs würde.
Gegen diese beiden Führer konnte Merwan nichts ausrichten.
Mitte Oktober 749 rebellierten auch die Schiiten von Kufa, und damit war der gesamte Osten des Reichs für die Omajaden verloren.
Am 28. Oktober warteten Schwarzgekleidete aus allen Teilen Persiens in der Moschee von Kufa: Abu Muslim hatte ankündigen lassen, dass an diesem Tag ihr ersehnter Imam kommen werde, um sich als Kalif huldigen zu lassen.
Punkt elf Uhr bewegte sich ein feierlicher Zug durch die dichten Reihen der Wartenden: eine große Gestalt, bis zu den Füssen mit einem schwarzen Schleier verhüllt, umgeben von zahllosen Schwerbewaffneten in schwarzen Rüstungen. Von Hochrufen umbrandet erreichte die Prozession die Kanzel, und die Bewaffneten zogen einen Ring um sie, während der Verschleierte hochstieg, und einen weiteren um die wartenden Gläubigen.
Dann ließ der verschleierte Imam die Hüllen fallen und war Abdallah Abbas.
Es kam zu einem kurzen Tumult der betrogenen Schiiten. Doch da zogen die Bewaffneten ihre Schwerter, und plötzlich über schüttete auch ein Goldregen die Moschee: Auf allen Dächern standen Schwarzgekleidete und warfen aus vollen Säcken Goldstücke in die Menge. Während noch die Gläubigen damit beschäftigt waren, den unverhofften Reichtum einzusacken, begann Abdallah zusprechen. Doch die Aufregung war zuviel für den jungen Mann. Schon nach wenigen Sätzen brach er erschöpft zusammen.
Da sprang ein Onkel von ihm auf die Kanzel: "Was wollt ihr denn? Ist er nicht aus der Familie des Propheten? Von heute an bis ans Ende der Welt werden nun wir, die Sippe des Propheten, herrschen, und unser einziges Gesetz wird der Koran sein".
Da begannen einige Agenten Muslims, dem gerade aus seiner Ohnmacht erwachenden Abdallah zu huldigen. Der Bann war gebrochen. Bis in die Nachtstunden drängten sich nun die Schiiten zur Huldigung: Wer Abdallah Abbas als Kalifen anerkannte, erhielt immerhin zehn Goldstücke, nach heutiger Kaufkraft dreitausend Mark.
Merwan hatte dem nichts entgegenzusetzen. Seine Kassen waren leer und so verlief sich auch seine Armee. Mit ihren letzten Resten versuchte er am 25 Januar 750 bei Mossul noch eine Schlacht. Fast hätte der alte Haudegen dabei auch gesiegt. Doch als seine Truppen gerade einen entscheidenden Einbruch in die Schlachtreihen der Abbasiden schafften, musste der Kalif für einen Augenblick vom Pferd.
Spötter reimten später :
"Durch sein Pissen
hat er sein Reich zerrissen".
Merwans Soldaten nämlich glaubten, der Kalif sei gefallen, und flüchteten
in hellen Scharen. Mit nur mehr fünfzehn Mann Gefolge kam Merwan am Abend vor das Stadttor von Mossul, doch er wurde nicht mehr eingelassen.
Nun huldigte eine Stadt nach der anderen den Abbasiden, und der letzte Omajaden-Kalif wurde wie ein Stück Wild durch sein verlorenes Reich gejagt.
Am Abend des 6. August kam eine kleine Karawane in das winzige Dorf Busir auf Fayum in Ägypten. Vor der kleinen Moschee braute ihr Anführer Kaffee. Einigen Dorfbewohnern fiel seine Kaffeekanne auf, ein wunder-schönes Stück Bronze mit feinen gravierten Dekors. So ein Prachtstück war bei einem einfachen Handelsreisenden mehr als ungewöhnlich. Zufällig hing an der Moscheewand auch ein Steckbrief der Abbasiden. Obwohl Mohammed Abbilder verboten hatte, prangte Merwans Konterfei darauf und dass auf diesen Kopf 25.000 Mark ausgesetzt seien. Sie verglichen den einfach gekleideten, etwa sechzig Jahre alten Mann mit dem Porträt des gestürzten Kalifen und verständigten dann ein in der Nähe lagerndes Reiterbataillon.
Als die angesprengt kamen, flüchteten die paar Männer, die vor der Moschee gelagert hatten, in alle Windrichtungen. Zurück blieb die Kaffeekanne. In der Moschee saß Merwan und las laut im Koran. Er war gerade beim 25. Vers der dritten Sure angelangt: "O Gott, Herr über die Herrschaft, Du gibst die Herrschaft, wem Du willst, Du nimmst die Herrschaft, von wem Du willst. Du erhöhst, wen Du willst, und erniedrigst, wen Du willst". Da schlugen ihm die Häscher den Kopf ab.
Die Trophäe wurde nach altem Brauch an den neuen Kalifen gesandt. Allerdings nicht ganz vollständig: Während noch diese ruhmreiche Tat gefeiert wurde, fraß eine herumstreunende Katze die Zunge des letzten Omajaden-Kalifen, wie das der makabren Sendung beigefügte Gedicht launig vermerkte.
Merwans Kaffeekanne aber hat auch die folgenden Jahrhunderte heil überstanden und ist nun ein Prunkstück des Museums für islamische Geschichte zu Kairo. Benutzt wurde sie nie wieder.
|
|
Und der Henker ist immer dabei
|
||
|
Saffah, der Blutvergießer
Abdallah Abbas wurde durch eine der schlimmsten Schmierenkomödien der Weltgeschichte Kalif, durch ein atemberaubendes Gaunerstück, inszeniert von seinen Angestellten, in dem er selbst lange Zeit weniger mitspielte als eingesetzt wurde. Der Plan des Komplotts stammte von seinem Bruder Ibrahim, die Geldmittel dazu aus den Firmen seiner Vorfahren. Die Ausführenden waren der ehemalige Sklave und spätere Prokurist der Firma Abu Muslim und der frisch angeheuerte persische Intrigant Chalid Ben Bermek. Sie spannen das Netz der Verschwörung, sie warben unter falschen Vorspiegelungen Bundesgenossen in der Schia, und sie trugen auch auf den Kampfplätzen ihr Fell zu Markte.
Kalif aber wurde Abdallah, dem so ziemlich alle Eigenschaften für dieses Amt fehlten. Als ihm zu Kufa gehuldigt wurde, war er gerade Ende der Zwanzig. Freund und Feind beschreiben ihn annähernd gleich: Ein etwas blässlicher, klein geratener Mann, schüchtern um nicht zu sagen verklemmt und ohne jede Ausstrahlung. Schon bei den geringsten Anforderungen drohte er zu versagen. Trat er in der Öffentlichkeit auf, zeigte sein Gesicht hektische rote Flecken, und sollte er eine Rede halten, fiel er fast regelmäßig in Ohnmacht. Eine Gestalt wie geschaffen zur Schachfigur.
Doch scheinen diese Beschreibungen dem Begründer des zählebigsten und brutalsten Herrscherhauses islamischer Geschichte nicht gerecht zu werden. Als Chef des Hauses Abbas war Abdallah eine Verlegenheitslösung, nur ans Ruder gekommen weil sein Bruder enttarnt und eingekerkert wurde. Dass er zur Dauerlösung wurde scheint er selbst besorgt zu haben. Der Tod seines Bruders Ibrahim gehört auf jeden Fall zu den ungeklärten Kriminalfällen des Islam.
Merwan hatte ihn als Hochverräter eingesperrt, aber auch als Faustpfand: Nach alter arabischer Sitte hätte die Sippe ihren Boss gegen gesalzene Bedingungen auslösen können. Ibrahims Haftbedingungen waren keineswegs streng, und er befand sich in ständiger Gesellschaft mit zwei prominenten Mithäftlingen, direkten Nachkommen Mohammeds und Thronanwärtern der Schia. Merwan hoffte, die drei gegeneinander ausspielen zu können, da Ibrahims Zellenkollegen nach dem Programm der Schia auf jeden Fall mehr Anspruch auf das Kalifat hatten als die Abbasiden.
Abdallah Abbas selbst bat seinen Bruder nur noch einmal er wähnt, als Ibrahim samt seinen Mitgefangenen tot gefunden wurde. Natürlich wurde der böse, alte Merwan als ihr Mörder genannt. Doch das war ein halbes Jahr nach Merwans Tod und ein volles Jahr, nachdem Merwans Wächter von dem Gefängnis abgezogen wurden. Die Leichen aber waren noch so frisch, dass sie sogar öffentlich gezeigt werden konnten. Den Vorteil dieser Morde hatte auf jeden Fall Abdallah: Der Bruder der eigentlich Kalif hätte werden sollen, und seine gefährlichsten Konkurrenten, waren somit aus dem Kampf um die Macht ausgeschieden. Wenn Abdallah tatsächlich diesen Mord auf dem Gewissen hatte, wird er sich deswegen keine Gewissensbisse gemacht haben. Wirkte er in der Öffentlichkeit auch schüchtern und hilflos verkörperte er doch den kalten Techniker der Macht. In seinem Tagebuch leistete er sich Sätze von geradezu grandiosem Zynismus: "Wer an die Macht gelangen will, tut gut daran, diese Gelüste durch Ansprüche der Moral oder Religion zu verschleiern. Doch darf ein Machthaber nicht einmal als Kind daran glauben, dass er Gutes bewirken solle außer für sich selbst. Nur wer Macht um ihrer selbst willen genießt wird sie behalten; wer sich nicht um das Leben seiner Untertanen sorgt, wird verehrt; wer das Volk nach den Prinzipien der Religion belügt, wird glaubhaft. Die Liebe des Volkes ist kein Fundament für den Herrscher. Die wahren Grundlagen eines geordneten Staates sind Angst, Geld und ein zu folgsamen Hunden dressiertes Heer, das jederzeit die jeweils befohlene Ordnung herstellt. Nur dann lässt sich Macht genießen wie eine Frau".
Genauso regierte Abdallah auch und im übrigen nach den Methoden der alten persischen Despoten. Er führte auch das persische Zeremoniell wieder ein, das einst Mohammed so angeekelt hatte: Die Untertanen mussten sich vor dem Herrscher zu Boden werfen, und er selbst saß so hoch, dass ihn kein Attentäter erreichen konnte. Und da die persischen Herrscher bei ihrer Thronbesteigung stets einen neben Namen angenommen hatten, nannte er sich von nun an Abdul Abbas. Das Volk aber nannte ihn Saffah, den Blutvergießer.
Diesen Titel verdiente sich der Kalif redlich. Er selbst konnte zwar kein Blut sehen und soll sogar einmal in Ohnmacht gefallen sein, als er sich in den Finger schnitt. Mörderische Befehle aber gab er ohne zu zögern.
Kaum hatte Abu Muslim ihn an die Macht gebracht, degradierte Saffah seinen Königsmacher zum Provinzgouverneur von Chorassan. Abu Muslim scheint von selbstmörderischer Treue gewesen zu sein. Obwohl ihm der Abbasside zuvor die Statthalterschaft von ganz Persien versprochen hatte, übergab er seine Armee folgsam dem jüngeren Bruder des Kalifen und reiste in die entlegene Provinz. Dscheffar Abbas war somit Statthalter der östlichen Reichshälfte und musste versuchen, seinen Omajadischen Amtsvorgänger zu erledigen. Der war ein Jugendfreund Merwans und hatte sich, als alles bereits verloren war, mit zweihundert Offizieren in einem kleinen Wüstenfort verschanzt, und dagegen rannte Dscheffar mit gut zehntausend Mann über ein Jahr vergeblich an. Schließlich schlug der Bruder des Kalifen eine kampf-lose Übergabe vor und garantierte freies Geleit. In derselben Reihenfolge, wie die Leute aus der Festung kamen, wurden sie umgebracht, ein bislang noch nicht da gewesener Verstoß gegen das islamische Kriegsrecht.
Auch Abdallah Ben Ali, ein Onkel des Kalifen und neuernannter Statthalter in Syrien, nahm es mit den Eidesformeln des Koran nicht sehr genau. Er musste zunächst einmal Damaskus belagern. Unter den Omajaden hatte die Stadt einen ungeheuren Aufschwung erlebt. Die Firma Abbas aber hatte sich bei ihren Arbeitern den Ruf eines Leuteschinder Betriebs und bei den Kaufleuten den eines skrupellosen Monopolisten erworben. In einer Volksabstimmung entschieden fünf Sechstel aller Bürger, die Stadttore geschlossen zu halten Doch die Abbasiden hatten schon ihre Leute in der Stadt, und nach den ersten Straßenkämpfen zwischen schwarzer und weißer Partei entschloss sich der Stadtrat zu Übergabeverhandlungen.
Der Stadt wurde Schonung zugesichert, und am 27. Mai 750 marschierte Abdallah Ben Ali ein. Drei Stunden erlaubte er seinen Truppen zu plündern, und wehe den Häusern, in denen auch nur ein Fetzen weißen Stoffs gefunden wurde!
Die Angehörigen des Hauses Omaja hatten sich in ihre Stadtpaläste eingeschlossen, die regelrechte kleine Festungen waren. Noch am selben Abend verhandelte Abdallah mit den einzelnen Sippenbossen, und in der Nacht wurde ein Vertrag ausgehandelt: Die Sippe Omaja werde die rechtmäßige Herrschaft der Abbasiden anerkennen und dürfe dafür sechzig Prozent ihres Vermögens behalten, Gegenstände aus Edelmetall ausgenommen.
241
Bei einem gemeinsamen Bankett zwischen Vertretern des Hauses Abbas und sämtlichen Vertretern des Stammes Omaja am nächsten Abend sollte der Friedensschluss besiegelt werden.
Tatsächlich kamen alle Omajaden bis auf zwei. Es sollen siebzig oder neunziggewesen sein. Der große Audienzsaal im Kalifenpalast war prächtig dekoriert: Reiche Vorhänge an den Wänden, blühende Orangenbäume in Töpfen und üppige Speisen auf den Tischen. Als alle Formalitäten erledigt und die Verträge unterschrieben waren, wurden die Hors döuvres aufgetragen. Zwischen zwei Bissen kaltem Gazellenrücken fragte Abdallah Ben Ali seinen omajadischen Tischnachbarn, welche Kunstgattung denn der Prophet am meisten geschätzt habe. Natürlich die Dichtkunst, sagte der und staunte, dass ein Muslim das nicht wusste.
Da klatschte Abdallah in die Hände, und aus einem Vorhang trat Schobl auf, ein stadtbekannter Stegreifdichter, der sich früher als. Redenschreiber für die Kalifen sein Brot verdient hatte. Zu getragener Musikbegleitung deklamierte der Poet eine lange Hymne auf das Haus Abbas. Dann kam er auf das Haus Omaja zu sprechen. Den versammelten Omajaden blieb der Bissen im Halse stecken in demselben Augenblick wurden die Vorhänge hochgezogen und dahinter standen Hunderte Schwerbewaffnete.
". . . sie heucheln niederträchtig Freundschaft zwar, weil nun der Donner über ihren Häuptern kracht, doch da sie leben, sind sie schon Gefahr - vernichte ihr er Zweige Hoffnung, ihrer Stämme Pracht", sang der Dichter gerade.
"Ist er nicht großartig? lächelte der Gastgeber. "Da kann man ihm doch einfach keinen Wunsch abschlagen. Und das Gemetzel begann. Abdallah hatte seinen Leuten strengen Auftrag gegeben, seine Gäste zu verwunden, aber ja nicht zu töten. So röchelten die meisten noch, als Abdallah die etwas in Unordnung geratenen Tische neu decken und das Hauptgericht auftragen ließ. Während sich die Sterbenden am Boden wälzten, begann ein fröhliches Gelage, und erst als alle Omajaden tot waren hob Abdallah die Tafel auf.
Doch auch die toten Kalifen wurden nicht geschont. In Muawias Grab wurde nur ein Häufchen Staub gefunden, in dem Abd-el Meliks einige Knochen, die den Hunden vorgeworfen wurden.
Lediglich Hischam hatte sich einbalsamieren lassen und war noch so gut erhalten dass Abdallah seinen Leichnam auf dem Marktplatz aufhängen und auspeitschen lassen konnte. Des milden Omar Grab zu schänden aber weigerten sich selbst Abdallahs Leute.
Spätestens zu diesem Zeitpunkt fragten sich viele Schiiten, ob sie nicht doch einen allzuschlimmen Herrschertausch gemacht hätten. Viele von ihnen zogen demonstrativ wieder die weißen Kleider des gestürzten Herrscherhauses an. Doch ihre Reue kam zu spät - rücksichtslos wurden die zahlreichen Aufstände niedergeschlagen und waren die Frauen in den Städten zunächst von den schwarzen Kriegern nur geschändet worden, wurden sie nun gleich umgebracht. Ungefähr siebzigtausend ehemalige Mitkämpfer Saffahs sollen im Lauf der nächsten zwei Jahre ermordet worden sein dann war laut Hofchronik "das Land ruhig und tiefschwarz".
Nicht ganz: In Palästina übten etliche Stämme formale Opposition. Sie bewirkte zwar nichts, hielt sich aber dafür als Brauch um so länger - noch heute sind die Kopftücher der Palästinenser schwarzweiß gewürfelt.
Saffah konnte sich nun ziemlich ungestört der Neuorganisation des ergaunerten Reiches widmen. Zunächst besetzte er dreizehn der insgesamt vierzehn Provinzen mit seinen engsten Verwandten als Gouverneuren. Nur in Chorasan ließ er Abu Muslim, dem er schließlich fast alles verdankte auf seinem Posten.
Dscheffar, der jüngere Bruder des Kalifen, hatte da seine Bedenken. Ständig lag er Saffah in den Ohren: "Abu Muslim hat uns an die Macht gebracht und kennt ihre Maschinerie besser als wir. Bring ihn lieber um, bevor er uns gefährlich wird".
Saffah weigerte sich, weniger aus Dankgefühlen gegen seinen Königsmacher als aus praktischen Überlegungen: "Solange es noch die geringste Opposition gibt werden wir ihn brauchen können. Es ist töricht, einen Schuh auszuziehen solange man nicht sicher weiß, dass die Scheissgasse hinter einem liegt".
So erlaubte er seinem Bruder nur, sämtliche alte Mitarbeiter Abu Muslims umbringen zu lassen. Folgsam lieferte sie Abu Muslim aus, entweder aus echter Loyalität oder aus der zweifelhaften Hoffnung damit auf die Dauer den eigenen Kopf retten zu können.
Nur Chalid Ben Bermek hatte sein Schäfchen rechtzeitig ins trockene gebracht und war auch Saffah unentbehrlich geworden: Zwar hatte er nicht das versprochene Amt des Großwesirs erhalten, aber als Steuereintreiber der persischen Provinzen machte er sich um das Haus Abbas unabdingbar verdient.
Abu Muslim aber beging einen entscheidenden Fehler: Er versuchte, durch eine versöhnliche Politik in Chorasan die Opposition für die Abbasiden zu gewinnen, aber gerade davon hielten die Abbasiden selbst gar nichts. Sie verfuhren nach der Devise, nur ein toter Gegner sei ein guter, und allein in Mossul ließen sie über elftausend Köpfe auf die Stadtmauer stecken, omajadische Sunniten bunt gemischt mit Schiiten, die häufig selbst noch kurz zuvor für die Herrschaft ihrer Mörder gekämpft hatten.
Im Frühjahr 754 ließ Saffah Abu Muslim in sein Militärlager kommen. Der war sehr zerknirscht und meinte seine Politik der Milde sei nur eine vorüber-gehende Schwäche gewesen. Wieder hätte ihn Dscheffar am liebsten gleich umbringen lassen, aber Saffah traf eine pikante Entscheidung: Da Dscheffar ohnedies schon lange eine Wallfahrt nach Mekka machen wollte sollte ihn Abu Muslim als Reiseleiter begleiten. Scherzhaft fügte der Kalif hinzu: "Da könnt ihr euch ja ausgiebig beschnuppern und Freunde werden. Sollte ich aber mittlerweile sterben, kann Dscheffar ja das Kalifat samt seinem Macher erben".
Die beiden begaben sich mit einer prächtigen Karawane auf die Reise. Abu Muslim sorgte für Erfüllung des Gebotes Mohammeds, dass reichere Pilger unterwegs ihre ärmeren Kollegen bewirten sollen. Er entwickelte eine geradezu gewaltige Gastfreundschaft: Wer unterwegs getroffen wurde und lieber seinen eigenen Brei kochen wollte als an der Tafel Dscheffars speisen, war sofort dem Tod verfallen.
Freunde aber wurden die beiden unterwegs nicht. Dafür sorgten erst drei Boten die der Reisegesellschaft auf dem Rückweg entgegen kamen. Der erste berichtete, dass Saffah an Pocken erkrankt sei. Der zweite dass der Kalif am 9. Juni, erst vierunddreißig Jahre alt, an Pocken gestorben sei. Und der dritte, dass nun Onkel Abdallah Ben Ali sich in Damaskus zum Herrscher ausgerufen habe.
Plötzlich entdeckte Dscheffar sein Herz für Abu Muslim. Lange sprach er von den Verdiensten die sich der ehemalige Sklave um das Haus Abbas erworben habe und dann versprach er Abu Muslim den Gouverneursposten von ganz Persien, wenn er ihn nur von seinem Onkel erlöse.
So betätigte sich Abu Muslim ein zweites Mal als Königsmacher. Schnell reiste er nach Chorasan, hob dort eine beachtliche Armee aus und fügte schon im Dezember Abdallah Ben Ali eine entscheidende Niederlage zu.
Dscheffar schrieb Abu Muslim einen von Lob nur so triefenden Brief und lud ihn ganz herzlich zu einem Besuch ein, er wolle seinem Retter persönlich danken.
Einige Tage später betrat Abu Muslim das Zelt des Kalifen. Als neues Einrichtungsstück glänzte dort ein großer Lederteppich, schwarz, mit gold-verziertem Rand. Als Abu Muslim darauf vor seinem Herrn zu Boden fiel, sprangen vier Mann aus den Zeltvorhängen und schlugen ihm den Kopf ab.
Dscheffar war einige Tage lang besorgt, die Armee könne nun vielleicht doch rebellieren. Als er aber an alle Offiziere einen Extrasold auszahlen ließ blieb alles ruhig. Ob Abu Muslim wirklich einen Putsch plante, wie Dscheffar später behaupten ließ, wird sich nie feststellen lassen. Gelegenheiten dazu hätte er genug gehabt, und es ist nicht einzusehen dass er Dscheffar nur zum Kalif machte um ihn dann zu stürzen. In Chorasan wird er heute noch wie ein Heiliger verehrt von allen Schlächtern der Abassiden war er der einzige der keine sinnlosen Massenmorde begehen ließ, und das war für jene Zeit schon ein Zeichen ungewöhnlicher Milde. Die kleine Sekte der Churramiten glaubt sogar, Abu Muslim werde eines Tages als der verheißene Mahdi, der Erlöser, zur Erde kommen und die Herrschaft des ewigen Friedens und der Gerechtigkeit begründen.
Auf jeden Fall war Dscheffar spätestens nun unangefochten Kalif, und als solcher nannte er sich Mansur der Siegreiche, obwohl er selbst keinen einzigen Sieg errungen hatte. Seine Herrschaft pflegte alle äußerlichen Zeichen einer Monarchie, war jedoch eher eine Militärdiktatur. Die wichtigsten Zeichen der neuen Staatsmacht blieben der Lederteppich vor dem Thron der anlässlich der Ermordung Abu Muslims Premiere hatte, und der daneben wartende Henker. Wer den Kalifen besuchte, musste stets damit rechnen, ohne Verfahren und Kommentar umgebracht zu werden. Nur auf eine Bevölkerungsgruppe konnten sich die Abbasiden einigermaßen stützen: Auf die Frischbekehrten der persischen Länder.
Unter den Omajaden waren sie als Bürger zweiter Klasse behandelt worden. Die Abbasiden stellten sie den Arabern gleich und spielten sie später auch stets erfolgreich gegen die einstigen Herrenmenschen aus.
Dafür wurden die Schiiten unversöhnliche Gegner des neuen Herrscherhauses, und auch das besorgte Mansur. 761 unternahm er wieder eine Wallfahrt nach Mekka, diesmal mit fünf Divisionen seiner Armee. Kaum war er in Mekka eingetroffen, lud er sämtliche Angehörige des Stammes Haschem, also die direkten Nachkommen des Propheten, zu einem Gastmahl ein. Die hüteten sich natürlich zu kommen, und in ihrem höflichen Absagebrief meinten sie, dass ihnen ein Gastmahl im Stil des Hauses Abbas doch zuviel der Ehre sei. Mansur ließ ihnen feierlich freies Geleit zusichern, doch auch darauf fielen die Haschemiten nicht herein. Wir sind doch nicht lebensüberdrüssig, schrieben sie dem Kalifen.
Da ließ er ihre Häuser stürmen, etliche umbringen, einige einkerkern und ihr gesamtes Vermögen konfiszieren. Ein Jahr später wurden die Haschemiten in Medina ausgerottet. Nur wenige überlebten das Blutbad, und selbst sie waren Mansur zuviel.
Wie groß der Hass der Schia den Abbasiden gegenüber wurde, lässt sich daraus ermessen, dass fast alle Schiiten von nun an die weiße Kleidung der Omajaden anlegten, obwohl auch die mit ihnen, weiß Allah nicht gerade freundlich umgegangen waren.
"Der Untergang des Abendlandes
Wie schlimm auch der Islam in den von ihm beherrschten Ländern hauste - die größte Zeche zahlten jene, in die kein Muslim seinen Fuß setzte. Mit dem Aufbruch der Araber zur Weltmacht brach Europa zusammen.
In unseren Geschichtsbüchern wird gemeinhin die Völkerwanderung für das Ende römischer Kultur und römischer Zivilisation verantwortlich gemacht. So schlimm aber waren die barbarischen Germanenrudel gar nicht, die da jahrhundertelang aus dem weiten Russland mit Kindern, Vieh und Kegel in die Nordprovinzen des ehemaligen Imperium Romanum einfielen. Waren auch die römischen Armeen den Germanenhorden regelmäßig unterlegen, war doch der römische Lebensstandard dem der Zuwanderer so turmhoch überlegen, dass selbst die "zotteligsten" Germanen bald "romanisiert" wurden.
Kaum waren sie in römisches Territorium eingedrungen, legten sie sich schon römische oder griechisch-römische Namen zu, römische Sitten und das Christentum, und bald fragten angeblich freie Germanenhäuptlinge in Konstantinopel bescheiden um römische Titel und Ehren.
Schließlich beruhte die Macht des Römischen Reiches weniger auf dem engmaschigen Netz zahlloser Kasernen und Garnisonsorte als auf dem feingesponnenen Netz einer auch die Grenzgebiete des Reiches umfassenden wirtschaftlichen Verflechtung. Ein ungeheuer verästelter Güterkreislauf sorgte dafür, dass jede Provinz auf die andere angewiesen war, und der daraus resultierende hohe Lebensstandard hielt das riesige Staatsgebilde besser zusammen, als es jede Armee hätte tun können. Papyrus aus Ägypten war das landläufige Schreibmaterial auch im extremen Norden des Imperiums, Bernstein aus der Ostsee ein heiß geliebter Schmuckstein auch der Araberfrauen. Das Herz dieses hochentwickelten Organismus aber war nicht Rom, sondern das Mittelmeer. Die Hafenstädte um das "mare nostrum" der Römer bildeten die Koronargefäße. Hier wurden die zahllosen Güter umgeschlagen, und bei diesem Geschäft galt im Grunde jede Stadt gleich wichtig. Nur durch das Mittelmeer konnte ein so extrem östlich gelegener Ort wie Konstantinopel unangefochten neue Hauptstadt des Römischen Reiches werden - hier lag der größte Hafen und auf den kam es an.
Solange um das Mittelmeer eine Kette römischer Häfen lag, war die Macht Konstantinopels gesichert und dadurch erklärt sich auch, weshalb die Römer während der ersten, stürmischen Siegesjahrzehnte Palästina und Syrien nach relativ geringem Widerstand aufgaben, bedeutende Hafenstädte wie Antiochia oder Cäsarea jedoch so hartnäckig verteidigten, dass sie noch zwei Jahrhunderte lang im Besitz Konstantinopels blieben.
Eigentlich war den Kaisern in Konstantinopel ziemlich gleich, ob im Nahen Osten in Kirchen oder Moscheen gebetet wurde, Hauptsache die Güterversorgung aus Indien und China klappte. Und es kümmerte sie auch nicht, ob im Norden, in Europa also oder im westlichen Spanien Goten, Langobarden oder wer weiß welche Germanen gerade ihre Herrschaftsansprüche verkündeten. Wichtig war nur, dass gekauft wurde und die Handelszentren intakt blieben. So kam es auch, dass die römischen Städte die Völkerwanderung zwar nie ungeplündert, aber immer relativ heil überstanden.
Nicht einmal die Hunneneinfälle konnten etwas daran ändern dass wie in alten römischen Zeiten deutsches Holz gegen Weizen aus dem Mittelmeergebiet aufgewogen wurde, Felle und Wollstoffe im Güteraustausch gegen Seide und Baumwolle gehandelt wurden und afrikanisches Gold gegen europäisches Silber.
Die alten Römerstädte verödeten erst, als die Araber ihre neue Weltmacht im Nahen Osten gefestigt hatten. Da nämlich besannen sich die Araber, dass sie im Rahmen des herrschenden Wirtschaftssystems den längeren Atem hatten, und drehten dem Abendland den Hahn ab.
Dieses erste Embargo, das die Araber gegen Europa eröffneten sollte verheerende Folgen haben. Was kam auch nicht alles aus dem Orient: Chinesische und indische Seide, arabische Perlen, Elfenbein, Tee und Kaffee das Gold aller Münzen, Getreide, Baumwolle Leinen, das Öl für die Lampen, die Gewürze für das Essen, Glas, Porzellan und Edelholz.
All diese Köstlichkeiten blieben plötzlich aus. Viele davon waren zwar Luxusgüter doch seit je misst man den Lebensstandard eher am Luxus als an den notwendigen Bedarfsgütern, und so begann allerorten ein lauter Jammer über den Verfall der Lebensqualität. Manche Dinge konnten durch neue Erfindungen ersetzt werden: Wachskerzen und rußende Kienspäne lösten die klassischen Öllampen ab, Schweineschmalz das Olivenöl, heimische Kräuter die exotischen Scharfmacher, deutsches Leinen das feinere ägyptische, Zinngeschirr das gewohnte Glas und Porzellan. Andere Dinge waren nur sehr schwer zu ersetzen. Pergament beispielsweise war siebenhundertmal teurer als Papyrus, und so sank bald das Bildungsniveau rapide: Hatte die Analphabetenzahl unter den Römern nur annähernd zwanzig Prozent in den nördlichen Ländern betragen, stieg sie nun auf fünfundneunzig Prozent, und erst in unseren letzten zwei Jahrhunderten lernten wieder alle Mitteleuropäer lesen und schreiben. Auch das Gold der Münzen wurde immer mehr versilbert, und bereits die Frankenherrscher konnten nur noch Silbermünzen herstellen.
Am schlimmsten aber war, dass die Araber gleichzeitig einen Boykott über europäische Waren verhängten. Nun blieben die Europäer auf ihrem Eisen, Holz, Zinn, Honig und ihren Fellen sitzen. Die Muslims deckten ihren Bedarf anderswo: Pelze bezogen sie aus Russland, Eisen und andere Metalle aus Indien,
und für den Holzbedarf wurden die Wälder Anatoliens und Afghanistans kahl-geschlagen. Damit aber schnitt sich der Islam letztlich ins eigene Fleisch: Noch heute sind diese einst reichen Gebiete Steppe und Wirtschaftliches Entwicklungsland.
Das Ziel ihres Embargos erreichten die Muslims nicht. Konstantinopel wurde nicht in die Knie gezwungen, und auch das übrige Europa zeigte nicht so grässliche Konsumentzugserscheinungen, dass es dem Islam kampflos in die Hände fiel. Allerdings entwickelte das Abendland ein neues Gesellschaftssystem. Aus Geldknappheit mussten beispielsweise die fränkischen Herrscher ihre Soldaten mit Land bezahlen. Grundbesitz wurde die neue Werteinheit und die ganze Richtung der Feudalismus. Gemessen an der staats-kapitalistischen Marktwirtschaft der Römer war dies natürlich ein arger Rückschritt.
Die Entwicklung Europas und der gesamteuropäische Lebens Standard wurden um Jahrhunderte zurückgeworfen. Erst gut siebenhundert Jahre später erreichte Zentraleuropa wieder das Niveau das es auch noch lange nach der Römerherrschaft als selbstverständlich empfunden hatte. Unser Mittelalter verdanken wir letztlich den Omajaden.
Die Abbasiden beendeten die Handelssperre. Sie dachten in an deren Kategorien als ihre Vorgänger im Kalifat. Nicht umsonst hatte ihre Familie schon zuvor den größten Wirtschaftskonzern des Islam beherrscht sie ersetzten den Territorial-Imperialismus der Omajaden durch einen Wirtschaftsimperialismus moderner Prägung. Sie suchten ihre Siege weniger auf dem Schlachtfeld als auf dem Markt. Ihre Armeen dienten überwiegend dem Bürgerkrieg, also der Ruhe und Ordnung im eigenen Reich. Mit dem christlichen Erbfeind trieben sie lieber Handel.
Mansur erklärte als erster dass nun der Islam wieder Handelsbeziehungen zu Europa aufnehmen werde und daher Gesandte einlade. Die ersten, die kamen stammten aus einer kleinen bislang unbedeutenden Hafenstadt Italiens mit dem Namen Venedig.
Zwischen zwei wurmzerfressenen Buchdeckeln ruht in der ehrwürdigen Bibliotheca Marciana zu Venedig ein uraltes Dokument, das jahrhundertelang nicht ernst genommen wurde. Es ist die Abschrift eines Reiseberichtes.
Darin erzählen vier junge Venezianer, die auf Staatskosten und mit zwei jüdischen Dolmetschern in die weite Welt gezogen waren, von der unglaublichsten Stadt des Universums. Haus des Friedens soll sie geheißen haben oder auch Geschenk der Gärten und vollständig aus Gold erbaut gewesen sein. Ihre Kuppeln waren mit Smaragden gespickt, die Wände mit Diamanten übersät, und ihr allmächtiger Herrscher war ein Hund. Natürlich kein gewöhnlicher Köter: Er war ein Zauberhund, konnte sich manchmal in einen Menschen verwandeln nannte sich dann Mansorius und führte als solcher die staunenden Venezianer durch seine angesammelten Schätze. Dass er in Wahrheit aber ein Hund war, stand außer Zweifel schließlich nannte er sich selbst so.
Diese Geschichte musste natürlich für ein Märchen gehalten werden, ausgedacht von findigen Köpfen, die auf diese plumpe Weise ihre ungeheuren Spesen verantworten wollten. Daher wurde das Manuskript auch respektlos behandelt wie ein Märchenbuch. Am wertvollsten schien das Pergament, auf das es geschrieben war. Viele Seiten wurden aus dem Band gelöst, die Tinte sorgfältig abgekratzt und das so gewonnene Schreibmaterial neu benützt. Nur einige Bruchstücke des einst voluminösen Buches blieben erhalten. Genug aber, um die vier angeblichen Aufschneider aus Venedig voll zu rehabilitieren: Was sie im Jahr 765 zu Papier bringen ließen, war im großen und ganzen richtig, und nur einige nebensächliche Missverständnisse waren schuld daran, dass den Gesandten nicht geglaubt wurde.
Der Märchenhund zum Beispiel war ein glatter Übersetzungsfehler. Begangen haben ihn die jüdischen Dolmetscher, denn Keleph heißt auf hebräisch Hund. Mansorius, der sich auf arabisch al-Mansur nannte, hätte diese- Interpretation seines Titels mit Sicherheit als Majestätsbeleidigung gewertet. Geschmeichelt hätte ihm allerdings, dass die vergoldeten Säulen seines Palastes für massives Edelmetall, die Spiegelmosaike an den Wänden für Diamanten. und die grünen Kacheln auf der Kuppel seines Thronsaales für Smaragde gehalten wurden. Er hatte ja die ganze Pracht daraufhin anlegen lassen, dass unkultivierten Barbaren aus dem Norden die Augen übergingen. Dabei haben die Venezianer erstaunlich genau beobachtet und auch den Namen der Stadt richtig übersetzt. Haus des Friedens war tatsächlich ihr offizieller Name, nämlich Daressalam, die arabische Übersetzung des Hebräischen Jerusalem.
Da es aber somit schon eine Stadt dieses Namens gab, hieß sie beim Volk anders, und dieser Name blieb der Stadt bis heute: Bagdad, Geschenk der Gärten.
So hieß die Gegend von Bagdad schon, ehe es Bagdad gab. Das grüne Stück Land am Tigrisufer war ursprünglich Gemüsegarten der prachtvollsten Residenz der Alten Welt: Einige Meilen flussabwärts lag Medain, von den Griechen Ktesiphon genannt, der Herrscherpalast der persischen Sassaniden- Könige, aus dem einst die plündernden Araber den kostbarsten Teppich der Geschichte geschleppt hatten.
Al Mansur war in die Gegend gekommen, als er sich von den Anstrengungen erholen wollte, die ihm die Suche nach einem Platz für eine Hauptstadt bereitet hatte. Jahrelang wusste der Kalif nicht, wo er residieren sollte. Damaskus war ihm zu unsicher, Mekka zu sehr vom Zentrum des Reiches abgelegen. 761 beschloss Mansur, die Sache bei einem Jagdausflug neu zu überdenken. Zufällig geriet er dabei in den schon ziemlich verlotterten Gemüsegarten der alten Residenz. Dort fiel es ihm wie Schuppen von den Augen: Genau das war der Platz von dem er geträumt hatte - mühelos mit Schiffen aus dem Persischen Golf erreichbar, an der klassischen Ost-West-Route der Seidenstrasse gelegen und außerdem an der Stelle, wo sich Euphrat und Tigris am nächsten kamen.
Noch am selben Tag setzte Mansur ein Planungskomitee ein: einen Astrologen und den mittlerweile schon unentbehrlich gewordenen Chalid Ben Bermek für praktische Angelegenheiten und Finanzfragen. Die beiden tüftelten eine Stadt aus, wie sie die Welt noch nicht gesehen hatte: ein kreisrundes Gebilde konzentrischer Mauerringe. Je ein Paar Mauern sollte den Herrscherpalast umschließen, das nächste den Marktplatz, das dritte schließlich die Stadt. Mansur war begeistert. Genau das hatte ihm vorgeschwebt, eine Stadt, die gleichzeitig uneinnehmbare Festung war. Und so änderte er den Plan nur in einigen Details. In der Mitte der Stadt blieb selbstverständlich der Palast, mit siebzehn Innenhöfen und einer gigantischen Kuppelhalle als zentralem Thronraum. Umgeben war das Ganze von einer fünfzehn Meter hohen und sechs Meter breiten Mauer. Davor ein tiefer Wassergraben und 128 Bastionen. Dann aber kam nicht der Marktplatz, sondern zunächst einmal die Quartiere der Beamten und Offiziere, wieder von einer kreisrunden Mauer mit 112 Türmen umgeben.
Nun erst folgte der Platz für den Basar des Kalifen, ein riesiger Ring mit einer großen Moschee sinnigerweise so angelegt, dass die Gläubigen, sobald sie sich nach Mekka neigten, sich auch vor dem Thronsaal verbeugten. Eine hohe Brücke führte aus dem Palast quer über die Offizierskasernen zu einer Loge oberhalb der Gebetsnische, damit kein Zweifel darüber aufkommen konnte, dass sich der Kalif als "Schatten Gottes auf Erden" fühlte. Überflüssig zu sagen dass auch dieser Platz von einer turmbestückten Ringmauer umgeben war. Nun erst folgten die Viertel der Handwerker und Bürger, eingeschlossen von zwei Ringmauern und vier Gräben in einem Gesamtumfang von einundzwanzig Kilometern.
Einen märchenhafteren Plan hatte es noch nie gegeben, einen teureren allerdings auch noch nicht. Dabei war Kalif Mansur sonst von geradezu krankhafter Sparsamkeit. Im Volk hieß er schon lange "Pfennigfuchser". Auch beim Bau seines Palastes wollte er sparen. Allen Ernstes schlug er seinem Wesir Chalid Ben Bermek vor, den alten Königspalast von Medain abreißen zu lassen um Ziegel zu gewinnen.
Chalid rechnete ihm vor, dass neue Ziegel wesentlich billiger kämen, doch da misstraute der Kalif dem Perser. Du willst ja nur, dass die Ruinen der Vergangenheit deines Volkes erhalten bleiben, fauchte er und gab persönlich Befehl, die alte Pracht abzureißen. Da aber hatte er die persische Massivbauweise unterschätzt. Der Abbruch des alten Palastes wurde fast doppelt so teuer wie der Aufbau des neuen und als die Thronhalle der Sassaniden dem Erdboden gleichgemacht werden sollte versagten die arabischen Spitzhacken vollends. Sie steht noch heute, ein unglaubliches Gewölbe, vierzig Meter hoch und eintausendachthundert Jahre alt. Ob wir seine Erhaltung tatsächlich einem Verzögerungsmanöver Chalids verdanken ließ sich nie nachweisen.
Auf jeden Fall lernten an diesem architektonischen Monstrum Generationen von Architekten alle Raffinessen des Gewölbebaus.
Mit der Grundsteinlegung für die neue Stadt wartete Mansur, bis sein Astrologe einen Tag errechnet hatte, der garantieren sollte, dass kein Kalif je in dieser Stadt sterbe. Im Sommer 762 war es soweit. Die Sterne scheinen wirklich in günstiger Konstellation gestanden zu sein: Kein einziger der 37 Kalifen von Bagdad starb innerhalb der gewaltigen Ringmauern.
Die Bauarbeiten konnten dann dem Kalifen nicht schnell genug gehen.
Persönlich überwachte er die Arbeiten und vor allem, dass keinem Handwerker zuviel ausbezahlt würde. Drei Jahre später, als die Venezianer kamen, stand bereits ein Grossteil der Stadt. Zehntausend Moscheen mit öffentlichen Badeanstalten waren bereits vollendet, viertausend Trinkwasserbrunnen wurden von vierhundert Wassermühlen gespeist, und elf Brücken überspannten den Tigris. Über allem aber leuchtete die grüne Kuppel von Mansurs Thronhalle, genau einen Meter höher als der Thronsaal der alten Perser, von einem Reiterstandbild des Kalifen gekrönt und der ersten Räderuhr der Geschichte.
Die Gründung Bagdads erfolgte natürlich nicht, um die Größe des Kalifen der Nachwelt zu künden sondern aus rein wirtschaftlichen Überlegungen, vergleichbar etwa dem Aufbau einer großen Industrieanlage in der Gegenwart. Mansur wollte die fähigsten Handwerker seiner Zeit um seinen Hof konzentrieren und so, eine Produktionskapazität noch nie da gewesener Größenordnung schaffen. Der Großauftrag war ein Köder für alle Industriesparten der Zeit, und eine Bedingung dabei, dass alle Arbeiten im Ort erledigt werden mussten. So kamen aus allen Teilen des Riesenreiches die Handwerker angereist und wurden natürlich auch sesshaft: Brokatweber aus Damaskus und Indien, Keramiker aus Anatolien, Marokko und Persien, Glasbläser aus Ägypten, Kunstschmiede- aus Afghanistan, die Elite der Manufakturen aus allen islamischen Ländern. Früher waren viele von ihnen in der Nähe ihrer Rohstoffquellen angesiedelt und hatten, da Fertigungsindustrie immer goldenen Boden hat den Reichtum ihrer Städte ausgemacht. Nun war ein riesiges Wirtschaftspotential in Bagdad konzentriert. Weite Landstriche aber verkamen zu bloßen Rohstofflieferanten.
So etwas hatte die Welt noch nicht erlebt: In wenigen Jahren wurde eine gigantische Industrieanlage aus dem Boden gestampft, die bald fünfzig Prozent der islamischen Gesamtproduktion herstellte und auf Erden konkurrenzlos war. Und Bagdad wuchs und wuchs. Bereits 775 überschritt die Stadt die Einmillionengrenze. Der Kalif aber besaß eine unanzapfbare Einnahmequelle, denn er hatte die Markthoheit. Was immer in Bagdad hergestellt oder verkauft wurde - ein Fünftel vom Gesamtwert floss in seine Taschen.
Mansurs geniale Rechnung ging jedoch nur zum Teil auf. Als "Haupt des Islam" war Bagdad ein arger Wasserkopf. Der wirtschaftliche Aderlass hatte die islamischen Länder so geschwächt, dass ihre Kaufkraft bei weitem nicht mehr zur Abnahme der Produkte Bagdads reichte. Um die Vollbeschäftigung zu sichern, musste sich Mansur zwangsläufig nach neuen Kunden umsehen.
Wie jeder hochindustrialisierte Staat fand er sie in den Entwicklungsländern und die lagen damals in Europa.
Die Omajaden hatten diesen Kontinent nur mit dem Schwert geplündert und sich im übrigen kaum darum gekümmert, wer dort wem das Sagen hatte. Mansurs Pläne waren von feinerer Art. Er bot arabische Lebensqualität zu hohen Preisen. Es ist schon ein Treppenwitz der Weltgeschichte, dass der Kalif dieses Projekt tatsächlich Entwicklungshilfe nannte.
Zunächst brauchte er dafür Agenten. Direkte Geschäfte mit den Ungläubigen waren unmöglich, nicht etwa aus ideologischen Gründen, sondern aus sprachlichen. Außerdem fehlte es den unterentwickelten Abendländern an Kaufleuten. Denn dort bestand die Aristokratie aus Grundbesitzern, und der Handel war zu einem Krämergewerbe abgesunken, dessen Umgang man den königlichen Kaufleuten des Islam wahrlich nicht zumuten konnte.
Es gab aber noch eine Internationale, von den alten Römern über alle Welt zerstreut und mit immer noch bestehenden Kontakten über alle Grenzen - die Juden. In christlichen wie islamischen Ländern galten sie als Menschen zweiter Klasse ewig fremd gebliebene Fremde untereinander verbunden durch starres Festhalten an ihrer Religion. Genau das aber machte sie zu den geborenen Vermittlern zwischen den so unterschiedlich gewordenen Kulturen.
Mansur ließ die Sippenältesten aller Judenstämme in seinem Thronsaal aufmarschieren. Wer Kontakte im christlichen Abendland habe und sie in Zukunft geschäftlich nützen wolle, könne außer mit entsprechendem Profit auch mit einem zehnprozentigen Steuernachlass rechnen. Dieses Angebot brauchte er natürlich nicht zweimal zu machen, und so begann eine neue Phase europäischer Geschichte: Als Ware wurden die Grundlagen unserer heutigen Kultur aus dem Nahen Osten importiert.
Natürlich ließen sich die Muslims ihren Fortschritt teuer bezahlen.
Ein gut geschmiedetes Damaszener-Schwert beispielsweise kostete gut eine halbe Tonne Roheisen, und bei anderen Waffen wurde arabische Wertarbeit noch höher in Rechnung gestellt. So wurden Gebrauchsgegenstände des arabischen Alltags in Europa zu Luxusgütern der Superreichen. Die fränkischen Könige hielten in Seidenkleidern Hof, wie sie in Bagdad nur ein mittlerer Beamter trug, für die aber im barbarischen Norden die Jahreseinkünfte eines ganzen Landkreises bezahlt werden mussten.
Auch Pfeffer kam wieder in die nördlichen Länder. Die schwarzen Körner wurden mit Silber oder Bernstein aufgewogen und galten dementsprechend als Nonplusultra einer feinen Tafel.
Wer sich's leisten konnte, aß überwürzt, nur um zu zeigen, dass er sich's leisten konnte. Aus der Zeit Karls des Grossen sind einige Kochrezepte erhalten, die uns den Magen umdrehen würden: Auf fünf Kilo Hirschbraten beispielsweise nehme man eineinhalb Pfund Pfeffer und ein halbes Pfund Gewürznelken!
So wurden arabische Ärzte bald der allergefragteste Importartikel. Sie waren den europäischen Quacksalbern um Jahrzehnte voraus und arabische Medici erhielten an europäischen Höfen mindestens den achtfachen Jahresgehalt eines Generals. Die Frankenkönige ließen sich ebenso von Muslims kurieren wie der Papst, obwohl manche Heilmethoden bedenkliche Kurpfuscherei waren. So wurde Pippin dem Vater Karls des Grossen, gegen Impotenz ein Hackbraten aus Eselspenissen verordnet und Papst Hadrian I. als Verjüngungsmittel das Menstruationsblut ehrbarer Römerinnen. Andere Erkenntnisse arabischer Medizinmänner jedoch gelten noch heute. Ibn Sina, der in Europa später Avicenna genannt wurde, beschrieb als erster die Symptome der Pocken erkannte die Ansteckungsgefahr von Tuberkulose, und über Krebs schrieb er was heute noch gilt: Die Krankheit im frühesten Stadium anzugehen und sämtliche befallenen Gewebeteile restlos zu operieren.
Tatsächlich besaß Bagdad bereits um das Jahr 800 regelrechte Krankenhäuser mit Operationssälen. Sie lagen an den Plätzen mit den besten hygienischen Bedingungen. Diesbezügliche Standortforschungen betrieb der Arzt Radzi, im Abendland Rhazes genannt mit einer seltsamen Methode: An Schnüren hing er Fleischstücke auf. Wo sie am langsamsten verwesten wurden Spitäler errichtet. Selbstverständlich gab es auch Narkoseärzte.
Meist kam zwar bei Operationen nur Lokalanästhesie zur Anwendung, doch war auch schon die Vollnarkose bekannt, und ein diesbezügliches Rezept soll sogar einen siebentägigen Dauerschlaf bewirkt haben.
So eigenartig sich die Bücher islamischer Ärzte heute auch lesen - unsere moderne Medizin fußt auf ihren Entdeckungen. Diagnose, Hygiene und Homöopathie sind ihre Erfindungen, und Syphilis wurde bis in unser Jahr-hundert mit Quecksilber zu heilen versucht wie es schon die Araber empfohlen hatten. Überhaupt scheinen sie Quecksilberkuren so üppig angewandt zu haben dass davon der ganze Quacksalberstand seinen Namen abbekam. Damit zeigt sich auch die Verbindung der islamischen Ärzte zu einem anderen Zweig der Wissenschaft den wir ebenfalls dem goldenen Zeitalter Bagdads verdanken der Chemie. Zwar hatten schon die alten Ägypter experimentiert und später die Römer, doch arabischen Chemikern blieb es vorbehalten, diese Wissenschaft zusammenzufassen und weiter zu entwickeln. Als Desinfektionsmittel wurden Ätzkalk und Chlorkalk erkannt - wer heute Leitungswasser trinkt wird mühelos feststellen können, dass in dieser Hinsicht anscheinend noch nichts Neues erfunden wurde, zahllose Oxyde für Glas- und Keramikproduktion entdeckt, das Schwefeln von Lebensmitteln als Konservierungsmittel erfunden - noch heute bei Dörrobst üblich – und vor allem fast alle chemischen Prozesse genau beschrieben, die noch heute zum Unterrichtsprogramm unserer Mittelschulen gehören. So ist auch Chemie, al Khymia, eine islamische Wissenschaft.
Das Abendland hat sie jahrhundertelang gründlich missverstanden. Daran war das viele Gold schuld das die Muslims aus ihrem wissenschaftlichen Kapital schlugen. Europäischen Feudalköpfen wollte nicht einleuchten dass der sagenhafte Reichtum der Kalifen durch Handel zustande kam und nicht aus der Retorte. So glaubten sie allen Ernstes, die Muslims hätten ein Herstellungsverfahren für Gold entdeckt den "Stein der Weisen", der mit seiner Berührung alles in Gold verwandle.
Wie er beschaffen sei wurde nie herausgefunden. Vielleicht war es auch kein Stein sondern eine Flüssigkeit; nach den vier lebenswichtigen Stoffen Sperma Blut, Wasser und Urin die fünfte, die Quinta Essentia oder Quintes-senz. Ein Jahrtausend lang wurde sie gesucht Herrscher gingen dabei pleite und zahllose Alchemisten zugrunde, entweder gleich bei den Experimenten oder im Kerker.
Immerhin wurden bei diesem "Grossen Werk" auch einige nützliche Dinge entdeckt, die allerdings der übrigen Welt meist schon längst bekannt waren. Der Mönch Berthold Schwarz erfand das Pulver, das schon einem halb Jahrtausende lang in China verschossen wurde, und Böttcher, der "Hofgoldmacher" August des Starken kam durch Zufall auf das ebenfalls von. China fast zwei Jahrtausende erfolgreich gehütete Produktionsgeheimnis von Porzellan. Der Quecksilberspiegel, 772 in Bagdad erfunden und patentierter Exportrenner Bleikristall und Feuervergoldung konnten nach etlichen Jahrhunderten vergeblicher Liebesmüh auch von venezianischen Alchemisten hergestellt werden - ob sie die Verfahren selbst oder durch Betriebsspionage in Bagdad herausfanden, wird sich nie klären lassen. Immerhin beweisen diese zahllosen Nacherfindungen, auf die europäische Kulturhistoriker so stolz sind, dass die Alten im Islam nicht anders verfuhren als heute Industriestaaten gegenüber Entwicklungsländern: Produkte wurden gerne und teuer angeboten, Produktionsmethoden aber blieben ängstlich gehütete Geheimnisse, auf dass die Entwicklung ihren Hauptnutznießern nicht aus den Händen glitte.
Andere arabische Errungenschaften kamen unzensiert in das Abendland. Dafür wurden sie dort jahrhundertelang nicht ernst genommen. Schon um 800 stellten Wissenschaftler in Bagdad fest, dass die Erde eine Kugel sei und sich um die Sonne drehe. Sie teilten diese Kugel in Längen- und Breiten-grade und errechneten auch schon den Erdumfang - nur fünf Kilometer kürzer, als er tatsächlich ist. Gut siebenhundert Jahre später wurde in Italien ein gewisser Galilei, der genau dasselbe behauptete, beinahe als Ketzer verbannt. Wobei es seinen Ruhm hoffentlich nicht schmälert, wenn ihm eine gewisse Kenntnis wissenschaftlicher Werke aus der Zeit der Kalifen unterstellt wird: Das von Galilei angeblich erfundene Fernrohr war schon 790 zu Bagdad in Gebrauch, ebenso Mikroskope, die bereits siebzigfach vergrößern konnten, Astrolabien, mit deren Hilfe man den Stand der Gestirne und den Lauf der Planeten genau nachrechnen konnte, und vor allem Logarithmen Integral- und Sinuswerte, alle Grundlagen der modernen Mathematik.
Denn am weitesten von allen Wissenschaften war zu Bagdad die Mathematik entwickelt. Man brauchte sie schließlich für die Geschäftsführung. Die Rechner der alten Muslims, die aus oft zahllosen Detailposten die überraschendsten Endsummen zustande brachten, wurden scherzhaft "Knochenflicker" genannt wie ihre Kollegen aus der Chirurgie.
Das Abendland aber nahm das spöttische Al-dchahr ernst und machte Algebra daraus. Schließlich hatten die Araber ein geradezu revolutionäres Zahlensystem erfunden, das dem Buchstabenhaufen der alten Römer so turmhoch überlegen war, dass es sofort und ausschließlich für den täglichen Gebrauch übernommen wurde. Die wichtigste Neuerung dabei war ein kleiner Kreis, der vor einer Zahl nichts und hinter einer gleich das zehnfache bedeutete. Die Muslims nannten ihn Sifr und daraus wurde das europäische Zero und auch das deutsche Wort Ziffer.
Ali Baba war Bankier
Das heute so beliebte Diskussionsthema "Kultur als Ware" hätte das Bagdad von Tausendundeiner Nacht märchenhaft amüsiert. Selbstverständlich war Kultur Ware und Geschäft die Seele der Kultur. Ein westlicher Besucher geriet vor Mansur einmal ins Stammeln, als er dem Kalifen mit der Aufzählung aller Errungenschaften Bagdads schmeicheln wollte. "O Herr aller Köstlichkeiten der Erde, nun weiß ich nicht mehr, welche Tugend eurer Stadt die größte welche Blüte die leuchtendste ist, stotterte er, und fünfzehn Hofstenographen notierten jedes Wort. Der Beherrscher der Gläubigen aber sprach: "Die größte Tugend des Islam ist sein Banksystem".
Ehrlicher hätte er's kaum ausdrücken können. Und bis heute konnte das Banksystem des Islam nicht übertroffen werden - nahezu unverändert praktizieren es unsere Geldinstitute: Als Sparinstitute verwalteten sie das Geld ihrer Einleger mit sechs Prozent Zinsen und verliehen es für zwölf. Sie beteiligten sich mit Aktien an Unternehmen, gaben Hypotheken und besaßen für den Fall eines Konkurses stets das Recht des Erstgläubigers. Der Zahlungsverkehr war überwiegend bargeldlos. An der Spitze jeder Filiale saß ein Scheich, und der garantierte durch sein Siegel, dass der Überbringer Vermögenswerte von soundso viel Goldstücken wert sei, die auch in bar ausbezahlt würden. Damit war der Scheck geschaffen, und schon 756 besaß er die Gestalt, in der er noch jetzt angewendet wird. Von da war es nur noch ein kleiner Schritt zur Erfindung der Banknoten. Das älteste Papiergeld der Menschheit stammt aus dem Jahr 774 und aus Bagdad.
Europa lernte eine Schattenseite dieser strahlenden Entwicklung kennen: Die Ungerechtigkeit im Gefälle internationaler Währungskurse. Unsere Gegenwart bietet noch immer Beispiele für die alte Misere: 1974 kostete auf einer deutschen Bank eine indische Rupie 36 Pfennig. Auf dem Markt in Indien aber ist sie mindestens eine Mark wert. Des Rätsels Lösung: Deutsche Wertarbeit muss in deutscher Mark bezahlt werden, und die wird zu diesem Zweck den Indem teuer verkauft, für etwa das Dreifache ihres tatsächlichen Werts. Nicht zu Unrecht verdammen Entwicklungsländer dieses hochkapitalistische System von nacktem Raub unterscheidet es sich nur durch die Umgangsformen. Erfunden hat dieses Spiel ein Mann, der zwar mit Räubern zu tun hatte, selbst aber absolut keiner gewesen sein will: Ali Baba, der pfiffige Märchenheld aus "Tausendundeiner Nacht". Ali Baba hat wirklich gelebt und er hieß auch so. Sein wirkliches Leben ist nicht minder abenteuerlich als das Märchen, seine Schatzhöhle aber lag nicht in den Bergen, sondern im Herzen von Bagdad - Ali Baba war Direktor der Staatsbank. Dort hatte er als Laufbursche angefangen. Mit dreißig Jahren wurde er Direktor und organisierte den Handel mit Europa. Er rechnete Gold als Währungsgrundlage. Europa aber hatte nur Silber zu bieten. Gnädig erklärte sich Ali Baba bereit, auch dieses in Zahlung zu nehmen ein Kilogramm Silber für den Wert von zehn Gramm Gold. Europas Herrscher knirschten mit den Zähnen und zahlten. Eins zu hundert war ein harter Umrechnungskurs. Zumal natürlich auch in den islamischen Ländern Silber kursierte, gegen Gold tauschbar im Kurs von eins zu dreißig.
Natürlich wollten findige Köpfe in Europa die kapitalistischen Weisen aus dem Morgenlande austricksen. Überall entstanden Münzfälschereien, und die größte wurde vom Papst betrieben. Bei ihrem ersten Fälschungsversuch arabischer Münzen hatten die Kirchenleute allerdings Pech : Die arabische Inschrift gelang zwar perfekt, aber statt des Halbmonds prägten sie versehentlich ein Kreuz und damit wurden sie von den Muslims ausgelacht.
Allen anderen Fälscherzentralen des Abendlandes legte Ali Baba damit das Handwerk dass er die Silbermünzen des Islam alljährlich austauschen ließ. Der Kalif belohnte ihn dafür mit einer seiner Töchter in diesem Punkt stimmt das Märchen wieder.
Das Märchen verschweigt allerdings, dass Ali Baba auch ein Glücksspiel erfand, gegen das Roulette wie seriöser Broterwerb erscheint und das sich auch heute noch aberwitziger Beliebtheit erfreut: Das Devisentermingeschäft.
Seine Regeln sind unverändert: Man setzt darauf, dass eine bestimmte Währung am soundsovielten soundso viel wert ist und bestellt einen entsprechenden Posten. Als Anzahlung leistet man einige Prozent der bestellten Summe, und dann braucht man nur noch abzuwarten. Ein Spiel für Hellseher, ansonsten eine wüste Spekulation. Für Ali Baba war es natürlich ohne Risiko: Er konnte ja bestimmen, was dann wirklich geschah. Daher spekulierte der Erfinder des Devisen- und Warentermingeschäftes so erfolgreich, dass sich seine Nachwelt nicht mehr erklären konnte, wie Ali Baba zu seinem sagenhaften Reichtum kam. Der Vater aller Börsengauner musste zur Märchenfigur werden. An seinem zwanzigsten Dienstjubiläum setzte sich Ali Baba zur Ruhe. Er besaß nur fünf Gramm Gold weniger als der Kalif, und er wollte seinen Herrn nicht dadurch reizen, dass er reicher war: "Der gute Unternehmer hält Maß".
In Bagdad wurde Ali Baba sehr beliebt. Er gründete eine Schule für Banknachwuchs, baute ein Krankenhaus und ein prächtiges Börsengebäude. Für das Abendland wurde Ali Baba eine beliebte Märchenfigur. Verhasst wurden hier nur jene, die seine Geschäfte erledigen mussten, die von ihm als "Hand-langer" verachteten Juden. Schließlich mussten Europas Bauern für ihre Grundherren den arabischen Luxus erschuften. Die brauchten immer mehr Silber, und mit der Wertsteigerung des Edelmetalls sank der des Getreides, das als Grundpacht bezahlt werden musste.
Die Bauern und Bürger sahen nur die Juden, zu denen dies alles floss, und die Juden wurden die bestgehasste Minderheit. Natürlich verdienten sie an den Transaktionen des Morgenlandes, doch den wahren Profit machten die Muslims in Bagdad. Die "Geldjuden", die jüdischen Bankiers des europäischen Mittelalters, waren meist nur Strohmänner arabischer Banken, die das nötige Kapital vorstreckten. Sie spielten dieselbe Rolle und entwickelten dieselben Praktiken wie "private Kreditinstitute", die heute in Vorstadtstrassen residieren und per Kleininserat Kunden suchen. Meist waren sie sogar seriöser. Die wahren Beutelschneider saßen in Bagdad und die wahren Blutsauger an den Fürstenhöfen. Sündenböcke aber wurden die Juden. Sie schienen ja tatsächlich die Nutznießer zu sein: Feudalherren bestellten bei ihnen alle Luxusgüter, und die Juden waren die einzigen, die sichtbar daran verdienten.
Dafür wurden ihre Rechte immer wieder beschnitten: Manche Städte verdammten sie in Gettos, nirgendwo durften Sie Grundbesitz erwerben, und durch Sondersteuern wurden sie immer wieder zur Kasse gebeten. Nur wenn die europäische Wirtschaftslage ganz hoffnungslos wurde, sparten auch Papst und Herrscher: Karl der Grosse beschnitt die Seidenroben seiner Höflinge um einige Zentimeter künftig durften sie nur noch knielange Brokatröcke tragen , und der Papst stutzte die Schleppen seiner Kardinäle auf sechs Meter Länge. Und jedermann, Staatsoberhäupter ausgenommen, durfte nur zwei orientalische Prunkgewänder haben.
Derlei Sparmassnahmen bewirkten natürlich nicht viel. Der Schatten, den die arabische Überlegenheit auf Europas Bauern warf, macht unser Mittelalter so finster, dass wir auf der Suche nach einer freundlichen Märchenwelt immer nach Bagdad kommen werden. Und das Unglaublichste an vielen Märchen aus "Tausendundeiner Nacht" ist, dass sie sehr oft auf tatsächlichen Ereignissen und Personen aufbauen. Nicht nur Ali Baba hat es gegeben, sondern auch Sindbad. Der versuchte, eine Revolte gegen al-Mansur anzuzetteln, scheiterte und musste ins Exil. Erst lange Jahre später kam er zurück: 775 starb Mansur, und sein Sohn Mahdi, der ihm auf den Thron folgte, begnadigte den alt gewordenen Rebellen. Sindbad bedankte sich mit seinen Memoiren. Er war weiter in der Welt herumgekommen als die meisten
seiner Zeitgenossen, nach China und wahrscheinlich auch nach Japan. Wie es Pionieren oft geht, wurde ihm nicht geglaubt und sein abenteuerliches Leben zum Märchen.
Zu den sichtbarsten Erbstücken der Märchenzeit von Bagdad aber sollte das Hofzeremoniell werden, das al-Mansur sich einfallen ließ.
Besucher, die in den Palast des Kalifen kamen, glaubten zu träumen. Nach einer strengen Leibesvisitation wurden sie durch die Pforte geführt. Sie kamen in eine Stadt, in der nur der Kalif reiten durfte. In einem riesigen Hof brüllten hundert Löwen in Käfigen mit vergoldeten Gitterstäben. Kam ein Staatsgast, dröhnten überdies noch Posaunen los. Durch ein riesiges Tor wurden sie in den nächsten Hof geführt, in dem hundert Giraffen ihre Hälse reckten.
Durch ein noch größeres Portal traten sie nun in einen weiten Hof mit hundert Elefanten. Im vierten Hof waren hundert prachtvolle Hengste ausgestellt, und durch ein Tor aus massivem Silber ging es nun in einen Hof mit Jagdfalken" Hunden und dressierten Geparden. Das nächste Tor war mit schwerem Goldblech beschlagen. Dahinter standen in einer großen Halle die Würden-träger des Hofes, außerdem tausend Mann Leibgarde und siebenhundert Eunuchen. Das nächste Tor war aus einfacher Bronze, hatte aber eine abenteuerliche Geschichte: Dämonen sollen es gegossen haben, und darauf ward es zu den Türflügeln der Kaaba. Mohammed brachte sie nach der Eroberung Mekkas nach Medina und ließ sie in seiner Moschee einbauen. Dort hängte sie Hedschadsch aus, um die Medineser zu ärgern, und hing sie in sein Schlafzimmer. Von dort schließlich ließ sie al-Mansur nach Bagdad bringen.
Wer durch dieses Tor schritt, stand allein in einer riesigen Kuppelhalle, die buchstäblich mit Gold gepflastert war. Weit über ihm leuchteten Öllampen wie Sterne, und zahllose Edelsteine funkelten im Halbdunkel. Vor ihm aber lag ein schwarzer Lederteppich, und daneben stand ein schwarz vermummter Hüne mit einem blanken Beil. Ein schwarzer, golddurchwirkter Vorhang schloss das unheimliche Bild ab. Plötzlich begannen Chöre zu singen. Sie sangen das Lob des Kalifen, lange und ausführlich. Dann flog mit einem Ruck der Vorhang hoch - dahinter strahlten Tausende Lampen und noch mehr Edelsteine. Aus lichten Höhen schwebte der Kalif herab, im wahrsten Sinn des Wortes, denn ein raffinierter Aufzugsmechanismus setzte ihn samt Thronsessel direkt aus seinen Privatgemächern auf ein hohes Podest.
Eine so perfekte Inszenierung konnten sich die Herrscher des Abendlandes natürlich nicht leisten. So begnügten sie sich damit, dem Kalifen abzugucken, was nur möglich war. Der überhöhte Thronsessel wurde die "allerhöchste Sitzfläche", und der klobige Marmorthron Karls des Grossen im Münster zu Aachen ist eine unbeholfene Nachahmung des Kalifenstuhls, ohne eingebauten Lift natürlich. Dabei konnte er natürlich nicht mit dem Kaiser von Konstantinopel konkurrieren, der sich einen Thron mit Aufzug bauen ließ. Das Modell funktionierte jedoch nie richtig, und einer der christlichen Kaiser wurde das Opfer technischer Tücke: Eines Tages wurde der Thron zum Schleudersitz.
Majestät krachten samt Sitzmöbel aus luftiger Höhe in den Thronsaal und brachen dabei vier Ministern und sich selbst das Genick. Dennoch wollte auch der Nachfolger des Gestürzten nicht auf diesen effektvollen Theatertrick verzichten.
Andere Übernahmen aus Bagdad waren weniger lebensgefährlich. Schwarz war die Farbe der Abassiden, und so wurde auch in Europa Schwarz die Modefarbe der Macht. Kaiser, Priester, Beamte, Richter, Akademiker, kurz alles, was sich zu den Köpfen der Gesellschaft zählte, wallte in Schwarz einher, und dabei ist es geblieben. Der Kalif von Bagdad ist daran schuld, dass für feierliche Anlässe Schwarz fast ebenso unentbehrlich ist wie für Trauerfälle. Das "kleine Schwarze" gebt ebenso auf sein Konto wie die unendliche Langeweile offizieller Herrenmode, und erst Seit einigen Jahren versuchen Modeschöpfer, der schwarzen Pracht der Abbasiden einige zaghafte Farbtupfer aufzusetzen.
Schwarz bestimmte natürlich nicht nur die Mode, sondern auch die Fahnen. Das schwarz-goldene Abbasidenbanner wurde von allen absolutistischen Herrschern übernommen. "Schwarz-Gold ist die gnadenlose Macht, philosophierte al-Mansur, und der Kaiser von Konstantinopel übernahm dieses Symbol ebenso wie die Kaiser des Heiligen, Römischen Reiches deutscher Nation. Die Habsburger machten Schwarz-Gold zu ihrem Familienwappen, und die Hohenzollern, die es ihnen gleichtun wollten, mussten sich daher zu Schwarz eine andere Kombination einfallen lassen. Sie wählten Weiß, die Farbe der Omajaden, die in den schwarzen Zeiten schon längst zum Zeichen der Sanftmut geworden war. Auch die Republik Deutschland behielt die Monarchistenfarben und distanzierte sich von der absoluten Macht nur durch einen dezenten roten Streifen. Als sich die deutschen Landesväter für Schwarz-Rot-Gold entschieden, dürften sie nicht gewusst haben, wie al-Mansur über diese Kombination dachte: "Dem Schwarz und Gold bleibe das Rot fern. Es ist die Farbe des Blutvergießens und sinnloser Unterdrückung."
Von diesen Dingen abgesehen aber übernahmen Europas Herrscher auch die Spiele des Kalifen, die ihn über die Langeweile absoluter Staatsmacht trösten sollten. Und da das Volk stets gern seine Herrscher imitiert, wurden die königlichen Spiele sehr schnell Volksgut: Halma, Mühle, Dame, Mensch-ärgere-dich-nicht, Trick-Track, das einmal auch "Langer Puff" hieß und jüngst als "Backgammon" neu entdeckt wurde, Billard und vor allem Schach, das königliche Spiel der alten Perser.
|
|
Andalusische Nächte
|
|
|
Spanien wird germanisiert
Die alten Germanen scheinen ein extrem sonnenhungriger Schlag gewesen zu sein und ihre Völkerwanderung nur die Suche nach dem sprichwörtlichen Platz an der Sonne. Der Historiker Boethius nämlich berichtet, um das Jahr 300 sei ein besonders verwildertes Germanenrudel an der Nordgrenze des Römischen Reiches aufgetaucht. Allen Ernstes meinte ihr Anführer zu einem römischen General, der den Wilden mit einer Division den Weg versperrte, er habe schon im Ural von einem Platz gehört, an dem ständig die Sonne scheine. Dorthin wolle er nun mit seinen Wilden, und koste es ihr Leben. Da der Römer seine Leute nicht einem Kampf mit diesen Barbaren aussetzen wollte, flüchtete er in eine Notlüge: Ganz weit von hier, im äußersten Südwesten des Imperiums, gäbe es tatsächlich ein Land, wo ewig die Sonne scheine. So fielen die Germanen in Spanien ein, und der Irrtum, dem sie dabei aufgesessen sind, hat sich ja bis heute gehalten. Über das schwer-geprüfte Land heißt es im deutschen Schlager noch immer: "Die Sonne scheint bei Tag und Nacht . . ." Natürlich suchten die Germanen nicht nur einen Platz an der Sonne. Vor allem suchten sie einen Platz, an dem sie genügend Distanz zu den Hunnen hatten, und die waren an der ganzen Völkerwanderung schuld. Als dieses türkische Volk im äußersten Osten der Alten Welt begann, seine Weidegründe radikal zu vergrößern, fielen die zahlreichen Germanenstämme wie Dominosteine gen Westen und über das Imperium her. Der Philosoph Albert Paris Gütersloh hat diese sehr verwickelten Vorgänge einmal mit dem Stopfen einer Wurst verglichen, wobei die Schubkraft so groß war, dass die Pelle des Imperium Romanum aus den Nähten platzte. Ob das dem Abendland zum Fluch oder Segen gereichte, ist eine beliebte Streitfrage der Historiker. Da wir mit den damaligen Wilden weitläufig verwandt sind, gilt es fast schon als Nestbeschmutzung, die Germanen als Barbaren zu bezeichnen. Seit Felix Dahns "Kampf um Rom" und spätestens seit Adolf Hitler treten sie auch bei seriösen Geschichtsprofessoren durchwegs blond und edel auf. Den Völkern der Alten Welt aber erschienen sie meist schlimmer als Heuschrecken.
Für Spanien beispielsweise waren schon die ersten germanischen Touristen "ein Vorgeschmack auf das Ende der Welt". Sie hießen Vandalen und wurden als solche unsterblich.
Für die Bewohner der sonnigen Halbinsel brachen finstere Zeiten an. Unter römischer Herrschaft war die Provinz Iberia ein blühendes Land mit hoher Kultur und reichen Städten geworden. Die Vandalen verwandelten die meisten zivilisatorischen Errungenschaften in Schutt und Asche. Dann wurden Sie von einem weiteren Germanenstamm nach Süden abgedrängt und landeten schließlich im heutigen Tunesien. Dort wurden die Vandalen zweihundert Jahre später zum Segen der Menschheit ausgerottet.
Die Neuankömmlinge waren Goten, und auch sie benahmen sich wie Vandalen. Allerdings blieben die Westgoten im Lande. Um es richtig ausbeuten zu können, waren sie natürlich zu wenige, eine verschwindende Minderheit im bunten Völkergemisch aus Iberern, Nachkommen der alten Karthager, Griechen, Römern und Juden, die hier seit Jahrhunderten in friedlicher Koexistenz lebten. Daher sorgten die Goten zunächst einmal für eine Dezimierung der vorgefundenen Bevölkerung. Die spanischen Frauen kamen dabei noch glimpflich davon. Sie wurden nur vergewaltigt. Zwei Drittel der männlichen Bevölkerung aber brachten die Goten um. Der Rest wurde, so er auf dem Lande lebte, zu Leibeigenen erklärt, und die wenigen Stadtbewohner kamen unter eine mörderische Steuerschraube.
Am schlimmsten traf es die Juden. Die germanischen Herrenmenschen jener Zeit planten tatsächlich schon eine Art "Endlösung", und es lag eigentlich nur an mangelnder Organisation, dass die böse Sache nicht perfekt gelang. Als Christen getarnt überlebten viele jüdische Sippen in einem fast zweihundertjährigen Untergrund.
Als Staat existierte das Reich der Westgoten in Spanien eigentlich nie so richtig. Für das Volk waren die Goten fremde Räuber, deren Herrschaft sich vor allem in den gewaltigen Zwingburgen ihrer Sippen zeigte. Die Verwaltungsangelegenheiten wurden von den übriggebliebenen Beamten des Römischen Reiches erledigt, und die schickten manchmal das Steueraufkommen ganzer Provinzen nach Konstantinopel.
Die gotischen Junker hatten keine Zeit für Buchprüfungen. Sie waren voll mit ihren eigenen Rivalitäten ausgelastet - alle möglichen Stammesherzöge stritten hartnäckig um die Königswürde, und die Geschichte des dreihundertjährigen Gotenreiches ist die eines ebenso langen Bürgerkriegs.
Um 700 gelang es einem Stammesherzog namens Vitiza, fast die gesamte Halbinsel unter seine Kontrolle zu bringen.
Er hatte in Konstantinopel studiert, konnte also lesen und schreiben und verstand sogar etwas von Verwaltungsangelegenheiten. Mit beachtlichem Erfolg versuchte er, die Gotenhaufen nach oströmischem Vorbild an die Kandare zu nehmen.
705 versammelte Vitiza die Führer sämtlicher Clans in seiner Hauptstadt Toledo und hielt eine bemerkenswerte Rede. Lange schilderte er die außenpolitischen Gefahrenherde Konstantinopel und Islam. Besonders schlimm war natürlich die arabische Gefahr, und gegen sie wusste Vitiza ein Rezept: "Das Gotenreich braucht einen starken Mann, und der bin ich."
Die Drohung mit den Arabern dürfte gewirkt haben: Ein einziges Mal waren die Goten auf ihrem langen Marsch durch Europa geschlagen worden, 379, als sie Konstantinopel vereinnahmen wollten. Und die Sieger von damals waren Araber gewesen, allerdings in römischen Diensten. Nun kämpften die Araber schon gut fünfzig Jahre gegen die Römer, den Goten aber waren sie beängstigend nahe gerückt: Während die Herzöge und Junker zu Toledo tagten, eroberten arabische Brigaden gerade Marokko. Ihr Anführer war ein gewisser Musa Ben Naseir, der seinen Posten als persischer Statthalter nach einer gewaltigen Unterschlagungsaffäre verloren hatte und nun an der Westfront eine neue Chance bekam.
Unter diesen Umständen entwickelten die Goten für kurze Zeit eine Aktion Gemeinsinn. Sie reichte zwar nicht für eine einheitliche Länderverwaltung, immerhin aber zur Aufstellung ein es gemeinsamen Heeres unter dem Kommando Vitizas. Dem war der Erfolg zu Kopf gestiegen. Stolz nannte er sich nach römischem Vorbild Imperator und Cäsar, doch als er auch noch seine Söhne zu seinen Nachfolgern bestimmen wollte, spielten seine Herzöge nicht mehr mit.
710 war es mit der gotischen Gemeinsamkeit wieder vorbei, Vitiza starb, ob freiwillig oder ob ihm dabei nachgeholfen wurde, ließ sich nie klären. Seine Söhne jedenfalls wurden aus Toledo vertrieben und zogen sich grollend auf ihre Burgen zurück.
Neuer König aber wurde ein gewisser Roderich, der zuvor Unterbefehlshaber der frisch geschaffenen Miliz gewesen sein soll. Unter seinem neuen Regiment feierte das alte Chaos fröhliche Urständ, denn natürlich wollte sich kein Gotenherzog etwas von diesem Emporkömmling sagen lassen.
Musa Ben Naseir beobachtete von Marokko aus die spanischen Zustände natürlich mit größtem Interesse. Er war auch stets bestens informiert: Die Spanier sehnten sich geradezu nach dem sprichwörtlichen Joch des Halbmonds - im Verhältnis zum gotischen Regiment erschienen selbst die drückendsten islamischen Steuern geradezu paradiesisch, und vor allem die Juden beteten inbrünstig zu ihrem Gott, sie doch bald unter die Herrschaft Allahs zu führen. Zahllose Flüchtlinge fanden sich bei Naseir ein und schworen, im Namen des Islam ihre Heimat gotenfrei zu machen doch Musa Ben Naseir empfing sie zwar freundlich, erklärte ihnen aber, sie sollten ihren Kampfeseifer zügeln, bis er ganz Marokko erobert habe.
Denn ein winziger Vorposten Konstantinopels hielt sich noch immer hartnäckig Die kleine Hafenstadt Ceuta, kommandiert von einem gewissen Julian. Ihr wollte Musa zuerst den Garaus machen.
Die Nachwelt hat aus Julian eine Sagengestalt gemacht, und als diese geisterte er jahrhundertelang auch durch die Geschichtsbücher: Er soll Gote gewesen sein, ein reicher Graf im Süden Spaniens. Und er soll eine bezaubernde Tochter besessen haben, die dem wüsten Roderich so gut gefiel, dass er sich als Priester Verkleidete und das fromme Mädchen anlässlich einer Beichtstunde vergewaltigte. Das Mädchen stieß sich einen Dolch ins entehrte Herz, und der Vater schwor grimme Rache . . . Zwar erinnerte die traurige Geschichte fatal an die Abenteuer der Dame Lukretia im alten Rom, doch mangels Beweisen wurde sie geglaubt, zumal die äußerst peniblen Geschichtsschreiber des Islam Julian nie einer Erwähnung wert fanden. Da verirrten sich englische Wissenschaftler 1935 in ein entlegenes Gebirgstal in Kaschmir.
Eigentlich suchten sie Jesus. Eine hartnäckige Legende nämlich behauptet der Menschensohn sei nicht in den Himmel aufgefahren, sondern als friedlicher alter Mann inmitten zahlloser Nachkommen zu Kaschmir verstorben. Die Bewohner dieses Gebirgsnestes sollten nicht nur Sprösslinge des Gottessohnes sein, sondern dies auch schriftlich haben. Tatsächlich fanden die Gelehrten eine uralte Kiste voller vergilbter Papiere, bewacht von einem finsteren Rudel fanatischer Analphabeten.
Die Kiste enthielt eine Sensation, nämlich den Briefwechsel jenes Sagenhaften Julian mit Musa Ben Naseir. Nun stellte sich heraus, dass er zwar keine Tochter hatte, die Wahrheit aber nicht weniger abenteuerlich war als die Legende. Julian war Gouverneur Konstantinopels in Ceuta. Und er hatte wirklich einen Schwur getan, nämlich seinem Kaiser diese Hafenstadt um jeden Preis zu erhalten. Der Kaiser konnte ihm dabei nicht helfen, und Julians Lage war ziemlich aussichtslos, als Musa Ben Naseirs Armee vor seiner Stadt aufkreuzte. Da schrieb Julian dem Feind einen Brief: "Wozu, o großer Sieger, willst Du Deine Kraft an meiner unbedeutenden Stadt messen? Liegen nicht weit reichere Gebiete vor Dir, die unermesslichen Schätze Spaniens mit seinen Frauen und dem für Euch verbotenen Wein? Spaniens Keller sind voll von dem herrlich perlenden Teufelszeug, das nur darauf wartet, von Eurer Tugendhaftigkeit vernichtet zu werden. Unsere Frauen sind hässlich und verschrumpelt, unser Wein längst ausgetrunken. Es lohnt wirklich nicht, unsere Stadt zu belagern. Wollt Ihr aber nur unsere Schiffe, um nach Spanien überzusetzen, muss ich Euch leider mitteilen, dass wir sie zu unserer eigenen Flucht benützen werden, falls Ihr Ceuta erobern wollt. Verzichtet Ihr aber darauf, uns zu besiegen, werden wir Euch gern unsere Schiffe borgen . . ."
Musa Ben Naseir verordnete seinen Truppen zunächst eine Pause und schickte Julians Brief an seinen Kalifen Welid nach Damaskus. Eigenhändig schrieb Welid auf die Rückseite des Briefes: "Man sollte das Angebot prüfen. Nimm aber Christen - islamisches Blut wäre für diese hündische Sache zu schade."
Am selben Tag, als die Nachricht von Vitizas Tod nach Marokko kam, wurden Julian und Musa handelseins. Julian stellte die Flotte, Musa rüstete aus den spanischen Freiwilligen ein kleines Raubkorps aus, fünf Tage später landeten die Freischärler an der spanischen Küste, plünderten einige kleinere Ortschaften und kehrten einen Monat später mit reicher Beute zurück.
Musa Ben Naseir schien dem ganzen Unternehmen nicht viel Bedeutung beizumessen. Kaum hätte er sonst zum Kommandanten dieses Raubzuges einen ehemaligen Sklaven ernannt, der bislang nicht einmal ein Schwert in der Hand gehalten hatte. Tarik ibn Zijad war eigentlich ein Büchermensch, der es vom Schreibsklaven zum freigelassenen Bibliothekar Musas gebracht hatte. Wie Musa dazu kam, ausgeredet ihn zum Räuberhauptmann zu machen, wissen wir nicht.
Auf jeden Fall aber hat Musa einen guten Griff getan: Tarik hatte viele Schlachtbeschreibungen gelesen, und nach diesen antiken Rezepten führte er auch seinen erfolgreichen Beutezug aus.
Für Julian war der Erfolg noch größer: Musa hielt ihm gegenüber Wort, und solange Julian lebte, blieb Ceuta der letzte, wenn auch nur nominelle Stützpunkt Konstantinopels. Damit erwies sich der legendäre gotische Verräter als cleverer Manager seines Herrn und Kaisers.
Musa Ben Naseir schien durch diesen ersten Erfolg auf den Geschmack gekommen zu sein. Im April 711 schickte er Tarik wieder los, diesmal mit angeblich siebentausend Mann. Diese Zahl scheint etwas hochgegriffen, und Musas Zahlenangaben sind im allgemeinen wenig verlässlich. Schon ehe er nach Marokko kam, hatte er sich als geschickter Friseur seiner Buchführung bewiesen, und Tariks siebentausend Soldaten tauchen nur in einer Soldab-rechnung auf. Daran aber glaubte nicht einmal der Kalif. Wäre Tarik wirklich mit einer so stattlichen Armee in Spanien eingefallen, hätte er sich kaum mit seinen Landungstruppen zunächst einmal verschanzen müssen.
An einem steilen Felsen landete Tarik mit seinem Haufen und hatte ziemliche Angst vom gotischen Grenzschutz wieder ins Meer geworfen zu werden. Gleich nach der Landung ließ er auf dem Felsen ein befestigtes Lager errichten. Dies ist ein strategisch wichtiger Punkt, erklärte er seinen murrenden Truppen, die lieber plündern als Gräben ziehen wollten. Und wenn wir uns hier halten können, werden wir noch die Herren der Welt. Das war natürlich etwas übertrieben, aber der Felsen war tatsächlich ein Feldherrnhügel, und noch heute heißt er nach seinem Entdecker "Dschebel al Tarik" Gibraltar.
Nun schickte er einige seiner Freiwilligen los, sie sollten im Gotenreich kräftig die Werbetrommel rühren für die islamische Befreiungsarmee. Es meldeten sich zahlreiche Spanier, aber auch die Söhne Vitizas. Sie konnten es Roderich nicht verzeihen, dass er sie nicht auf den Thron gelassen hatte. Nun wollten sie mit dem Muslim gemeinsame Sache machen, um auf diesem Umweg an die Macht zu kommen. Tarik lehnte ihr Angebot ab: Sie sollten für ihn lieber auf seiten des Feindes kämpfen.
Roderich bot indessen ein stattliches Heer auf, und als, er hörte, dass Tarik sein Felsennest verlassen hatte, zog er dem Muslim entgegen. Er rechnete mit einem leichten Sieg seine Truppen waren den Invasoren sechsfach überlegen.
Die Flügel seiner Armee aber kommandierten die Söhne Vitizas. Roderich hatte sie diesen immer noch mächtigen Herzögen überlassen müssen, und als seine Armee an einem heißen Julitag bei Xeres de la Frontera auf Tariks Truppen stieß, erklärten die beiden, just heute nicht kämpfen zu wollen. So war Roderich schließlich auf seine eigenen Truppen abgewiesen, und die trugen eine vernichtende Niederlage davon.
Über das Ende des letzten Gotenkönigs gibt es verschiedene Nachrichten. Er soll in der Schlacht gefallen sein, doch wurde seine Leiche nicht gefunden. Eine andere Version wieder meint, er sei davongekommen, aus dem Land geflüchtet und als Emigrant in Rom gestorben. Vielleicht auch in Konstantinopel oder im heutigen Frankreich - jedenfalls tauchten in den nächsten Jahren in allen christlichen Ländern eine Unzahl Roderiche auf. Zwanzig Jahre nach der Entscheidungsschlacht hielt beispielsweise der fränkische Haudegen Karl Martell an seinem Hof eine Kollektion von fünfzehn garantierten Roderichen, und alle kamen sie ihm spanisch vor.
Eine weitere Quelle schließlich meint Roderich sei nach seiner Niederlage in seine Residenzstadt Toledo geflüchtet und dort von Tarik hingerichtet worden. Diese Version ist nicht unwahrscheinlich, denn Tarik marschierte gleich nach der Schlacht schnurstracks nach Toledo. Vitiza hatte aus der Stadt eine ungeheure Festung gemacht, und hätte Tarik sie belagern wollen, wäre er dabei höchstwahrscheinlich alt geworden. Nun wohnten aber auch in Toledo Spanier und Juden, und die öffneten ihm begeistert die Stadttore, während die gotischen Herrenmenschen durch ein Hintertürchen flüchteten.
Eigentlich hatte Tarik die Goten nur ein wenig ausplündern wollen. Durch seinen Gewaltmarsch nach Toledo aber war er plötzlich der Herr ihres Reiches geworden: Eine Gotenburg nach der anderen ergab sich nun kampflos, und nur einige kleinere Städte hielten ihren gotischen Herren die Treue.
Nachdem sich Tarik als Feldherr genial bewiesen hatte, wollte er dies auch als Politiker tun. Großzügig gestattete er den Goten, mit Sack und Pack aus Spanien auszuwandern.
Juden und Christen erhielten volle Religionsfreiheit, und die islamischen Steuern waren tatsächlich weniger drückend als die gotischen. An seinen Herrn und Auftraggeber Musa Ben Naseir aber schickte er einen kurzen Brief: "Toledo ist erobert. Spanien ist schön. Gott ist groß. Tarik." Musa tobte, als er das Schreiben erhielt. Er hatte Tarik ja nur auf einen kleinen Raubzug geschickt. Dass der nun Spanien erobert hatte, empfand er als glatte Befehlsüberschreitung. Vor allem aber fürchtete Musa, sein Untergebener werde auch noch das "Kalifenfünftel" nach Damaskus schicken, ohne ihm davon etwas abzugeben. Wutschnaubend brach er im Juni 712 mit 18.000 Soldaten auf, in Spanien nach dem Rechten zu sehen.
Tarik hatte in der Eile vergessen, einige kleinere Städte zu erobern. Nun verließ er sich darauf, dass sie sich von selbst ergeben würden seine maßvolle Politik sprach sich schließlich überall herum, und Sevilla war mit ihm auch schon in Übergabeverhandlungen getreten. Da erschien Musa vor den Mauern der Stadt, eroberte Sevilla und richtete ein furchtbares Blutbad an. Nun rüsteten sich auch die anderen noch gotischen Städte zu einem verzweifelten Widerstand.
Ein Jahr lang war Musa voll damit beschäftigt, die spanischen Städte zu knacken, und während dieser Zeit wuchs sein Groll auf den schreibfaulen Tarik, der es tatsächlich nicht einmal der Mühe wert fand, sich nach dem Befinden seines Herrn zu erkundigen. Plante Tarik, sich auf Kosten Musas unabhängig zu machen? Sein Verhalten spricht durchaus dafür, denn er hatte sich zahllose Dinge herausgenommen, die sich ein Freigelassener niemals erlauben durfte.
Als Musa dann mit seiner Armee nach Toledo kam, empfing Tarik jedoch seinen Gebieter nach islamischer Sitte schon vor dem Stadttor und zu Fuß. Vor den Augen aller Spanier kam es zum Skandal: Musa schlug Tarik mit der Reitpeitsche ins Gesicht, ließ ihm den Turban vom Kopf reißen und schickte seinen erfolgreichen Freigelassenen in ein marokkanisches Gefängnis.
Musa Ben Naseir eroberte nun selbst das restliche Spanien, doch als er sich daran machte, auch die Nordprovinzen am Fuß der Pyrenäen zu erreichen, kam ein strenger Brief aus Bagdad: Kalif Welid wünschte seinen Statthalter zwecks Rechnungslegung zu sprechen.
Musas sprichwörtliche Ungenauigkeit bei der Buchführung wird dazu kaum der Anlass gewesen sein.
Der Statthalter hatte Schlimmeres verbrochen: Er war zu erfolgreich. Er hatte Marokko unterworfen und nun Spanien Welid fürchtete, der allmächtige Gouverneur könnte noch auf die Idee kommen, sich selbst zum Kalifen zu machen. Als Musa mit einer prachtvollen Karawane und unglaublich kostbaren Geschenken zu seinem Kalifen aufbrach, stand die Sache bereits unter keinem guten Stern. Ahnungsvoll setzte Musa seinen Sohn als Stellvertreter ein: "Ich gehe nun in die Höhle des Löwen. Bete für meine Knochen". Es kam noch schlimmer, als Musa befürchtet hatte: Als er 715 in Palästina ankam, erreichte ihn eine Botschaft von Salaiman.
Sein Bruder, der Kalif, sei schwer erkrankt, und Salaiman bitte, mit der Überreichung der Geschenke zu warten bis Welid entweder völlig genesen oder gestorben sei. Salaiman hatte seine Gründe - sollte Welid den Tribut empfangen und dann sterben, würde die Erbschaft an Welids Kinder fallen und nicht an ihn, den künftigen Kalifen. Musas Lage war heikel: Wartete er, wäre dies dem Kalifen gegenüber Befehlsverweigerung gewesen. Nach einigen Tagen verzweifelten Zögerns erreichte ihn eine neue Nachricht. Welid befände sich auf dem Weg der Besserung, und nun hastete Musa geradezu nach Damaskus.
Als er ankam, hatte der Kalif gerade sein Krankenlager verlas sen. Er empfing seinen Statthalter sehr unfreundlich nahm sich aber die Mühe, Musas Geschenke zu besichtigen: 18.000 Sklaven, 4.000 Pferde und achtzig Kamelladungen aller möglichen Schätze. Welid freute sich darüber so sehr, dass er auf der Stelle starb.
Am nächsten Morgen war Salaiman Kalif, und der nahm Musa ins Gebet. Er ließ ihn öffentlich auspeitschen, erklärte sodann seine völlige Enteignung und sperrte den erfolgreichen Feldherrn in ein entlegenes Wüstenfort. Ehe sich dies noch bis Marokko herumsprechen konnte, sandte er eine Mordbrigade zu Musas Sohn. Salaiman befürchtete natürlich, diese Behandlung Musas könnte in Marokko einen Aufstand verursachen.
Zwei Wochen später erhielt Musa in seinem Gefängnis als Paket den Schädel seines Sohnes.
Tarik aber wurde auf Befehl Salaimans aus dem Gefängnis entlassen und erhielt auch wieder seinen alten Posten als Bibliothekar. Sein Leben lang soll er kein militärisches Fachbuch mehr angerührt haben.
Europa ist noch einmal davongekommen
Was der Kalif aber auch immer gegen Musa Ben Naseir haben mochte - das Konzept dieses zu erfolgreichen Feldherrn war genial. So wurde es auch nach seinem Sturz beibehalten. Im Prinzip war es ein schlichter Nussknacker, angesetzt auf Konstantinopel.
Von Süden her stand die Kaiserstadt stets unter Druck. Beinahe jährlich brachen islamische Armeen in Anatolien ein. Doch sie konnten auch auf die Dauer nicht gefährlich werden. In Kleinasien und Griechenland funktionierte noch die mustergültige römische Verwaltung, und die war der islamischen zumindest ebenbürtig. Eine kluge Steuerpolitik Konstantinopels ließ die Muslims bei den Eingeborenen stets nur als lästige Räuber er scheinen, und so fanden sie in Anatolien nie die zur Sicherung eroberter Gebiete unentbehrlichen Kollaborateure. So sehr sich die Edlen des byzantinischen Reichs auch untereinander stritten - Intrigen, Gift und Meuchelmord gehörten fast schon zum Ritual einer Thronbesteigung -, gegen die Muslims waren sie allemal einig. Daher sahen beide Parteien in den dauernden Rangeleien an der byzantinisch-islamischen Grenze eigentlich nur eine Art Beschäftigungstherapie ihrer Truppen.
Der entscheidende Schlag sollte aus dem Westen kommen, von Spanien aus und quer durch Europa. Dieser Umweg schien der kürzere, denn hier war kaum mit Widerstand zu rechnen. Auf den Trümmern des westlichen Imperium Romanum hatten die Germanen ihre frühen Reiche gegründet. Den römischen und keltischen Bevölkerungsgruppen galten sie nach wie vor als Barbaren, die Langobarden ebenso wie die Franken, die 466 in der ehemaligen Provinz Gallien ein Königreich errichtet hatten.
Musa Ben Naseir baute darauf, dass sich in Frankreich und Norditalien ebenso viele Überläufer finden würden wie im gotischen Spanien. Der Balkan wäre dann für seine Armee kein wesentliches Hindernis gewesen. Dort war ein ausgesprochenes. Machtvakuum entstanden. Wiederholte Einfälle östlicher Awarenvölker hatten die byzantinischen Städte und Garnisonen praktisch vernichtet.
Nach Musas Sturz sollte Abd-er-Rachman Ben Abdallah diesen Plan ausführen. Wie Musa war er zuvor Provinzgouverneur in Persien gewesen und hatte dort mit einigem Erfolg gegen die Charidschiten gekämpft.
Er war schon Ende der Vierzig, als er 716 in Spanien eintraf, ein ruhmbedeckter Feldherr, mit einem Hang zu einsamen Entscheidungen und so misstrauisch, dass er neben sich auch keinen Stellvertreter hochkommen lassen wollte. 718 überquerte er mit einer stattlichen Armee die Pyrenäen und führte auch siebzig Kampfelefanten mit sich. Abd-er-Rachman war gut vorbereitet: Er hatte sich sogar die Mühe gemacht, die Geschichte von Hannibals Zug über die Alpen zu studieren, und so ging ihm auch bei der Bergtour durch die Pyrenäen kein einziger der wertvollen Vierbeiner verloren. Nach zweiwöchigem Marsch standen die Truppen des Islam bereits in Südfrankreich. Dort hatte sich der fränkische Herzog Odo von den Merowingerkönigen ziemlich unabhängig gemacht und regierte in seinem selbst gebastelten Staat Aquitanien ganz nach eigenem Gutdünken.
Als die Araber anrückten, entdeckte Odo wieder sein Herz für den großen Frankenstaat und schrieb seinem König einen rührenden Brief mit der Bitte um Hilfe. Unglückseligerweise war der Merowingerkönig Analphabet und hatte in seinem Reich schon lange nichts mehr zu sagen. Wahrer Herr der Franken war ein gewisser Karl Martell, von Beruf Generalfeldmarschall und Staatskanzler. Er konnte zwar auch nicht lesen und schreiben, hatte sich aber vom Papst ein Sekretariat ausgezeichneter Kleriker schicken lassen, und mit diesem beherrschte er seinen König und das Land.
Natürlich hatte ihm der Papst diesen Freundschaftsdienst nicht selbstlos erwiesen. Karl Martell war an seinem König zum Hochverräter geworden: Heimlich hatte er dem Papst versprochen, das Frankenreich dem Stellvertreter Petri auf Erden auszuliefern.
Auch auf Odos Hilferuf reagierte Karl Martell mit einer unverschämten Forderung: Wenn Odo unbedingt sein Reich retten wolle, brauche er ja nur zu Karls Gunsten abzudanken. Dann werde Karl die Araber schon gern zu Paaren treiben.
Odo lehnte ab, und noch 718 verlor er Carcassone und Narbonne an die Muslims. 721 konnte Odo gerade noch Toulouse halten, doch 725 wurde Nimes und die gesamte Wüste bis zur Rhonemündung islamisch besetzt. Abd-er-Rachmans Strategie richtete sich nach dem Wetter: Im Herbst zog er selbst mit dem Gros seiner Truppen nach Spanien zurück.
In den besetzten Gebieten blieben nur schwache Garnisonen, und die Südfranzosen müssen schon sehr araberfreundlich gewesen sein, denn sonst hätten sich die Besatzungstruppen unmöglich im Lande halten können. Jeden Frühling aber kam Abd-er-Rachman wieder und stets mit einer größeren Armee. 732 vertrieb er Odo aus dessen Residenzstadt Bordeaux und besetzte alles Land bis zur Loire.
Anscheinend hatte Abd-er-Rachman Ben Abdallah vor, Tariks Siegesmarsch zu wiederholen. Im September gab er seiner Armee den Befehl, direkt nach Paris zu marschieren, obwohl schon wieder Herbst gekommen war.
Nun musste auch Karl Martell handeln. So gleichgültig ihm das Schicksal Aquitaniens gewesen war - jetzt standen die Araber an der Grenze des Frankenreichs, und reichlich hastig hob Karl eine kleine Armee aus. In Tag- und Nachtmärschen zog er den Muslims entgegen, und schon im Oktober traf er sie bei Tours an der Loire.
In unseren Geschichtsbüchern wird die Schlacht von Tours stets als entscheidendes Ereignis des christlichen Abendlandes bezeichnet. Eigenartig ist, dass wir so wenig darüber wissen. Nur, dass Karl Martell einen gewaltigen Sieg errungen und der Retter Europas gewesen sein soll. Das aber dürfte mit Sicherheit nicht zutreffen.
Arabische Historiker berichten, dass in diesem Jahr 732 der Winter unverhältnismäßig früh gekommen sei. Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit herrschte an diesem Oktobermorgen bei Tours strenger Frost. Am Vorabend hatten die Muslims am anderen Loireufer einen kleinen Brückenkopf errichtet. Erst fünf-hundert Krieger hatten den Fluss überquert. Am Morgen wollte Abd-er Rachman mit seiner kleinen Leibgarde den Vorposten besichtigen. Just in diesem Augenblick fiel Karl Martell mit etwa tausend fränkischen Soldaten über das Lager her. Ohnmächtig musste das Gros der islamischen Armee zusehen, wie ihre Vorhut in den Fluss zurückgeworfen wurde und ihr General dabei fiel.
Nun sollte sich bitter rächen, dass Abd-er-Rachman so einsam kommandiert hatte und neben sich kein strategisches Talent aufkommen ließ. Nach seinem mehr zufälligen Tod war weit und breit kein Nachfolger in Sicht. Die Obersten der Armee bildeten zunächst ein siebzehnköpfiges Kommandogremium, dessen einzige Entscheidung war, einen Brief nach Damaskus zu schreiben und den Kalif um seine Entscheidung zu fragen.
Bis zu dieser allerhöchsten Entscheidung wollten sie geduldig Posten schieben, und so blieben sie ganze neun Monate in ihrem Lager am Ufer der Loire.
Der Sieg Karl Martells war also eigentlich nur ein Zufallstreffer und auch kein entscheidender. Die fränkischen Truppen wagten nicht einmal, über die Loire zu setzen und dort die Muslims zu stellen. Hatte sich ein fähiger islamischer General gefunden und Abd-er-Rachmans Aufmarschplan fortgesetzt, wäre das Frankenreich binnen weniger Monate vom Erdboden verschwunden gewesen. Die Rettung des Abendlandes besorgten schon die Muslims selbst.
Zunächst zogen sie nach Südfrankreich zurück und bauten dort Arles zu ihrem Verwaltungszentrum aus. Mehr als zwanzig Jahre lang beherrschten sie ziemlich ungehindert die Provence und die gesamte Riviera. Nur mit den Langobardenkönigen gab es einige kleinere Scharmützel, und später auch wieder an der Nordgrenze ihres Territoriums mit Karl Martell. 735 war nämlich Odo von Aquitanien gestorben, im Exil zu Paris und ziemlich verbittert. Er hat Karl Martell innig gehasst, und daher staunten alle Franken, dass Odo in seinem Testament die Herzogswürde nicht etwa einem seiner Söhne, sondern ausgerechnet seinem Intimfeind vererbte. Nur einige der Geistlichen Karls lächelten weise - sie hatten schließlich die Urkunde gefälscht. Als Herzog von Aquitanien nahm Karl Martell den Kampf gegen die Muslims wieder auf. Er erreichte nicht viel nur einige kleine Städte zwischen den Fronten wechselten laufend ihre Besatzer. Im Sommer kamen die Araber und im Winter die Franken. Karl Martell aber verstand es meisterhaft, auch kleinere Niederlagen als große Siege verkünden zulassen.
Dass sich die Muslims schließlich über die Pyrenäen zurückzogen, bewirkte nicht Karl Martell, sondern die Berber Marokkos. Die Charidschiten hatten dort zahllose Anhänger gefunden, und 740 flatterten über allen Städten Marokkos und Südspaniens die roten Fahnen der Revolution. Bis 743 waren die islamischen Armeen des Westens voll damit ausgelastet, ihre eigenen Glaubensgenossen umzubringen. Dabei vergaßen sie die Eroberung des christlichen Abendlandes.
Karl Martell blieb während dieser Zeit nicht untätig. Ihn er schreckte die Zahl der islamischen Sympathisanten im Frankenreich. Seine erste Gegenmaßnahme war die untauglichste: Kollaborateure wurden ohne Verfahren hingerichtet.
Damit vervielfachte er nur die Zahl derer, die sich von einer islamischen Herrschaft ein besseres Regime erwarteten. Da schaltete Karl auf die weiche Welle um aus Rom und Konstantinopel ließ er erfahrene Verwaltungsfachleute kommen, die nun das Frankenreich nach römischem Vorbild organisierten. So hatte die arabische Bedrohung auch für die Untertanen der Franken ein Gutes.
Kaum waren die Charidschiten Aufstände der Berber im Westen des islamischen Reiches niedergeschlagen, begann im Osten die Revolte der Abbasiden, und damit waren die Muslims wieder für lange Zeit mit Bürgerkriegen beschäftigt. Wie wir wissen, ging die Sache für die Omajaden schlimm aus.
Nur zwei aus der Sippe waren dem blutigen Gastmahl zu Damaskus ferngeblieben. Sie waren Brüder, Seitensprosse einer Seitenlinie, und der ältere der beiden war noch nicht einmal zwanzig. Er hieß mit vollem Namen Abderrachman Ben Moawia Ben Hischam Ben Abdelmelik Ben Merwan, und mit diesem Zungenbrecher stand er bald auch auf allen Steckbriefen der Abbasiden, denn sie hätten den jungen Mann nur zu gerne umgebracht.
Abderrachman hatte sich in einem kleinen Landhaus am Euphrat verborgen. Zwei Monate hauste er dort mit seinem Bruder ziemlich ungestört, da erfuhr sein Kammerdiener, wie viel die Köpfe der beiden Jüngling wert seien. Am nächsten Morgen marschierte eine regelrechte Division unter schwarzen Fahnen auf das kleine Haus zu. Die Prinzen wollten gerade Toilette machen; nun sprangen sie nur mit Unterwäsche bekleidet in den Euphrat.
Der jüngere Bruder war kein guter Schwimmer. Bald zeigte er Erschöpfungserscheinungen, und die Soldaten riefen ihm vom Ufer aus zu, er solle nur kommen, ihm würde nichts geschehen, großes abbasidisches Ehrenwort. Der Junge glaubte das. Kaum hatte er Land unter den Füssen, wurde er auch schon enthauptet. Abderrachman schwamm allein weiter und wurde am Abend halb tot ans Ufer getrieben.
In Palästina hatten sich die Abbasiden nicht sehr beliebt gemacht, und dort tauchte Abderrachman Im September 750 auf. Angeblich hatte er die ganze Zeit über als Ausgestoßener fernab von allen Menschen gelebt und sich nur von Wurzeln und Käfern ernährt.
Wahrscheinlich aber ist er unter falschem Namen mit Beduinen über Land gereist und nicht einmal sehr geheim. Am Toten Meer nämlich erwarteten ihn schon zwei ehemalige Sklaven, und sie hatten ihrem Herrn auch was mitgebracht: Aus zahllosen, Geheimtaschen ihrer weiten Kaftane schöpften sie siebzehn Kilo Edelsteine.
Der letzte Omajade besaß nun ein ansehnliches Kapital und beschloss, sich damit sein eigenes Reich zu basteln. Einer der beiden Sklaven wollte da nicht mitspielen. Er hatte in seinem Kaftan mindestens ebenso viele Juwelen behalten, als er seinem Herrn gegeben, und mit diesem Schatz blieb er in Syrien und gründete eine Bank. Der andere hieß Bedr und blieb ein treuer Diener seines Herrn.
So leicht, wie Abderrachman es sich vorgestellt hatte, war es gar nicht, als gejagter Prinz Anhänger zu finden. Voll rührender Naivität fing er auf der Suche nach Bundesgenossen bei den Statthaltern des Westens an. Doch diese waren mittlerweile selbst Abbasiden oder, wenn sie die große Säuberung überstanden hatten, schon längst ihre Parteigänger. Der einzige Erfolg der Briefe Abderrachmans war, dass die Herren nun auf ihn quer durch Nordafrika eine regelrechte Treibjagd veranstalteten.
Ausgerechnet in den Zenata fand Abderrachman seine Retter. Die hatten zwar den Omajaden wegen der Geschichte mit ihrer Königin Blutrache geschworen, doch das Gebot der Gastfreundschaft wog in den Augen von Nomaden immer schon schwerer. Dass sie sich schließlich mit dem Nachkommen ihrer Todfeinde regelrecht verbrüderten, erreichte ein abbasidischer General, der Abderrachman fangen wollte und zu diesem Zweck 300 Kamele der Zenata beschlagnahmte. Nun schworen sie den Abbasiden Rache und gaben Abderrachman eine Liste aller in Spanien zerstreuten Zenata. Da trennte sich der Prinz von der Hälfte seiner Barschaft und schickte seinen getreuen Bedr nach Spanien.
Über ein Jahr lang blieb Bedr samt Geld verschollen. Abderrachman war verzweifelt und schrieb einen Brief an die Wirtschaftsbehörde in Cordoba, ob dort vielleicht ein Handelshaus Bedr als Neueintragung bekannt sei; doch da tauchte Bedr mit dem gesamten Geld und schier unglaublichen Nachrichten auf: Seit dem Charidschitenaufstand herrschte in Spanien praktisch Bürgerkrieg, nun schon fast fünfzehn Jahre.
280
Wer auf welcher Seite stand, war schon längst nicht mehr auszumachen. Mit dem Sturz der Omajaden hatte sich ihr Statthalter selbständig gemacht und Spanien zu seinem eigenen Staat erklärt. Die Abbasiden hatten ebenfalls einen Gouverneur geschickt, und der tat genau dasselbe wie sein abgesetzter Kollege. Nun versuchten die beiden, einander umzubringen und Mansur hatte auch schon einen neuen Statthalter geschickt, der die Ordnung wiederherstellen sollte und sich ebenfalls... Nicht einmal Bedr konnte seinem Herrn erklären wer nun gerade wo, wie und warum seine Mitmenschen umbrachte. Immerhin hatte Bedr auch einige ziemlich geschlossene Parteiungen entdecken können. Die größte von ihnen waren die ehemaligen Staatssklaven der Omajaden. Kalif Merwan hatte sie, als alles schon verloren war, in Bausch und Bogen freigelassen. Natürlich wurde diese großzügige Geste weder von den rebellischen Statthaltern noch von den Abbasiden im Irak anerkannt. Abderrachman aber gewann damit rund 110.000 Spanier als natürliche Bundesgenossen. Die zweite Gruppe bildeten die vom neuen Regime entlassenen Beamten der Omajaden, und dann kam noch ein bunter Haufen aller, die sich von einem Machtwechsel persönliche Vorteile versprachen Zenata, Berber und zahllose von den Abbasiden enttäuschte Schiiten.
Sie alle hatte der tüchtige Bedr für seinen Herrn mobilisiert, und als Abderrachman im September 755 bei Malaga landete, wurde er wie ein Messias empfangen. Der Prinz hatte im Exil Geduld gelernt. Zunächst beschränkte er sich darauf, seine Freiwilligentruppen zu drillen und die Lage zu beobachten. Im Winter war nur noch ein nennenswerter Gegner auf dem Feld: Jusuf al-Fihri, von den Abbasiden gestellter Statthalter, der jedoch beschlossen hatte, das Land unter dem Titel eines Emirs als seinen Privatbesitz zu betrachten. Ihm erklärte Abderrachman den Krieg, und am 14. März 756 schlug er ihn entscheidend am Wadi al Kabir, dem "großen Fluss" der Araber und dem Guadalquivir der Spanier.
In einem wahren Triumphzug zog der letzte Omajade wenige Tage später in Cordoba ein, dem Verwaltungszentrum der Halbinsel. Dabei zeigte sich allerdings, dass seine Freischärler sehr bedenkliche Elemente gewesen sein müssen während sich Abderrachman in der Moschee als Garant für Sicherheit und Ordnung feiern ließ, legten die wildgewordenen Truppen die Stadt in Schutt und Asche.
281
Und mit der Hauptstadt hatte Abderrachman natürlich noch lange nicht das Land in seiner Gewalt. Noch im August desselben Jahres marschierte Jusuf mit einer neuen Armee auf. Zwar unterlag Jusuf wieder und fand bei der Flucht sogar den Tod, doch seine Truppen zogen während der nächsten Jahre plündernd und marodierend kreuz und quer über die Halbinsel.
Auch die Abbasiden blieben nicht untätig. Ihre Agenten schafften das diplomatische Kunststück, die versprengten Haufen Jusufs unter ihren schwarzen Fahnen zu sammeln, und 763 hatte Abderrachman sein frisch erobertes Reich nahezu völlig verloren. Da gelang es ihm, in einem kühnen Handstreich das feindliche Hauptquartier zu überrumpeln und sämtliche feindlichen Truppenführer mit einem Schlag gefangenzunehmen.
Zwei Monate später erhielt Kalif al-Mansur auf der Baustelle von Bagdad ein gewichtiges Paket. Eingewickelt war es in jene schwarze Fahne, die der Kalif seinem Geheimdienstchef nach Spanien mitgegeben hatte. Es enthielt achtzehn Tontöpfe, und in jedem steckte ein Kopf, zum Zwecke der Haltbarkeit in Kampfer und Salz eingelegt. Damit der Kalif auch wusste, wen er da vor sich habe, waren Elfenbeintäfelchen mit Namen und Titel an die jeweiligen Ohren gebunden. Al-Mansur war gewiss nicht zimperlich und weiß Allah kein sanftmütiger Charakter. Kurz zuvor hatte er noch geschnaubt: "Wenn dieser Omajade nicht so weit entfernt wäre, würde ich ihn eigenhändig erwürgen". Nun aber warf er die makabre Sendung angewidert in den Tigris und seufzte: "Vielleicht ist es doch ganz gut, dass ein Meer zwischen ihm und mir liegt".
Das System wechselseitiger Klemmen
Damit war die spanische Frage für die Abbasiden natürlich nicht erledigt. Die Wiedergewinnung der verlorenen Halbinsel sollte für lange Zeit die Triebfeder der Außenpolitik Bagdads werden. Und da Diplomatie in keiner Epoche der Geschichte ein moralisches Handwerk war, versuchten die Kalifen, diesen "Schlüssel zu Europa" durch Bündnisse mit den Herrschern Europas in ihre Hände zu bekommen.
Das aufgeklärte neunzehnte Jahrhundert glaubte ja, nicht nur die Geschichtsschreibung, sondern auch den internationalen Verkehr erfunden zu haben.
So wurden nicht nur die mittelalterlichen Chroniken als armselige Legendensammlungen belächelt, sondern auch den Herrschern jener Zeit prinzipiell kein anderer Weitblick zugetraut als bis zu den Grenzen ihrer eigenen Länder. Dieser Irrtum hat sich auch in unserem Jahrhundert gehalten mit welchem Recht könnten wir denn auch sonst auf unseren Fortschritt so stolz sein? Tatsächlich aber ist das berühmte "rote Telefon" unserer Staatsmänner nur eine unwesentliche Verbesserung der alten Kontakte, die unter den Machthabern des Mittelalters selbstverständlich waren. In einem Punkt war das Mittelalter unserer Gegenwart sogar voraus: Krieg zwischen zwei Mächten bedeutete keinesfalls den Abbruch diplomatischer Beziehungen. Nur in Bürgerkriegen fiel die Entscheidung endgültig auf dem Schlachtfeld. Normale Kriege aber sollten in der Regel nur Verhandlungspositionen beeinflussen. Während an den Fronten Generäle dafür sorgten, dass die verschiedenen Untertanen einander auch tapfer die Schädel einschlugen, tauschten die Herrscher im Hinterland mit den Gesandten des Feindes Artigkeiten aus und redeten über Geschäfte. Natürlich musste das charaktervollen Gemütern als ausgemachter Zynismus erscheinen, und so verschweigen auch heute Historiker ganz gerne, dass es zwischen den christlichen und islamischen Erbfeinden stets beste Beziehungen gab. Diesbezügliche Berichte werden oft als Märchen abgetan. Da aber in christlichen und islamischen Chroniken stets fast gleichlautend darüber berichtet wird, sind eigentlich keine Zweifel erlaubt.
Während sich Abderrachman in Spanien an die Macht kämpfte, schlossen die Abbasiden mit den Frankenherrschern ein Stillhalteabkommen. Freiwillig traten sie ihnen die Riviera ab unter der Bedingung, dass die Christen den islamischen Bürgerkrieg nicht als Anlass nähmen, nun selbst über die Pyrenäen zu marschieren. Doch die Franken hatten schon ihre Leute in Spanien: Bereits 733 hatten in der nordwestlichen Provinz Asturien einige christliche Fürsten erfolgreich gegen die Muslims rebelliert, und mit fränkischem Geld konnte 753 dort ein gewisser Alfons sein eigenes, kleines Königreich gründen. Als nun Abderrachman Emir von Spanien wurde, schickten die Abbasiden dem christlichen König Alfons eine runde Million Mark, auf dass er mit diesem Geld einen Krieg gegen die Muslims beginne.
Mit mindestens ebensoviel Geld zog 765 eine stattliche Diplomatenkarawane aus Bagdad über Venedig nach dem Frankenland.
Dort herrschte mittlerweile ein kleiner Mann mit großen Plänen: Pippin, der Sohn Karl Martells. Sein Vater hatte sich noch damit zufriedengegeben, im Namen der Merowingerkönige zu regieren. Pippin zog klare Verhältnisse vor. Er schubste den letzten Merowinger vom Thron; und damit aus dieser Sippe ja kein Rivale mehr erwachse, sperrte er die abgehalfterte Majestät in ein Kloster und ließ sie auch noch kastrieren. Mit ähnlicher Gründlichkeit ging er seine weiteren Pläne an: Er wollte aus dem Rudel fränkischer Herzogtümer ein regelrechtes, straff organisiertes Königreich machen. So hörte er mit Interesse was ihm die Gesandten des Kalifen vorschlugen: Wenn Pippin den Abbasiden behilflich wäre Abderrachman aus Spanien zu vertreiben, würde er zur Belohnung die nördliche Hälfte der Halbinsel erhalten. Pippin versprach, sich die Sache zu überlegen, und schickte noch im selben Jahr eine eigene Gesandtschaft nach Bagdad.
Mit von der Partie waren auch fünf Priester, persönliche Gesandte des Papstes, denn auch er wollte mit dem leibhaftigen Antichrist in Verhandlungen treten.
Die Verhandlungen in Bagdad wurden geheim betrieben. Christen und Muslim wurden sehr bald handelseins. 767 wurden die abschließenden Verträge unterzeichnet, und ein Exemplar davon ruht heute noch in den Archiven des Vatikan, das Dokument eines weltweiten Komplotts.
Pippin sollte rund 17 Millionen Mark erhalten, um einen Krieg gegen Spanien zu führen, und im Falle eines Sieges Nordspanien einschließlich Barcelona. Dafür verpflichtete er sich den Abbasiden gegenüber friedlicher Koexistenz. Außerdem aber gab der Frankenkönig das feierliche Versprechen eines Handelsboykotts gegen Konstantinopel.
Der Papst meinte dazu nur, nun sehe man endlich, welch charakterloses Verräterpack die Muslims seien, dass sie ihre eigenen Glaubensgenossen an die Christen Verkauften.
Doch auch der Papst verfolgte irdische Ziele. Seit einiger Zeit schon stritt er mit dem Kaiser in Konstantinopel, wer nun eigentlich oberster Herr der Christenheit sei. Auf theologischer Ebene wurde diese Frage als "Bilderstreit" ausgetragen, ob Heiligenbilder heilige Bilder seien und als solche verehrt werden sollten. In Wahrheit ging es natürlich um anderes: Der Papst wollte sich in Italien ein Reich errichten, das durchaus von dieser Welt war. Doch gehörte die italienische Halbinsel noch zum Hoheitsgebiet Konstantinopels.
Daher schloss der Nachfolger Petri einen Vertrag mit dem Kalifen: Zum selben Zeitpunkt, da der Islam seinen Krieg gegen das Oströmische Reich wieder beginne, wolle der Papst in einer konzertierten Aktion ebenfalls zum Krieg blasen lassen. Natürlich aus rein theologischen Gründen, finanziert jedoch vom Kalifen. Denn die Einnahmen aus der Kirchensteuer flossen damals noch nicht so üppig, dass sich der Papst eine Armee leisten konnte. So erlaubte das Oberhaupt aller Christen die Errichtung einer Filiale der islamischen Staatsbank, gleich neben der Peterskirche, und mit deren Krediten wurde nun eine stattliche Armee ausgerüstet. Als Gegenleistung erklärte der Papst Sizilien zu islamischem Einflussgebiet, und darüber freute sich der Kalif so sehr, dass er dem Papst auch noch die geistliche Schutzherrschaft über die Christen von Jerusalem, Antiochia und Alexandrien überließ, die bisher zu den Titeln des Kaisers in Konstantinopel gehört hatte.
Schon nach einem Jahr konnte die berühmte Frage beantwortet werden, wie viele Soldaten der Papst denn habe: Dank der islamischen Finanzhilfe waren es genau 27.512 Mann.
Doch auch die Opfer der Bagdad-Verträge traten in Verhandlungen. Abderrachman in Spanien schloss 768 ein Bündnis mit Konstantinopel, das sogar einen Austausch von Militärexperten enthielt, und dritter im Bunde war ein kleiner Staat, der ganz nebenbei zwischen den Franken und dem Papst zerrieben werden sollte: das kleine Königreich der Langobarden in Norditalien.
Sämtliche Parteien begannen ein fieberhaftes Wettrüsten, und der erste Weltkrieg hätte eigentlich schon 768 beginnen können. Die Aufmarschpläne waren bereits ausgearbeitet, als völlig überraschend Pippin, der Herrscher der Franken, verstarb.
Karl der Grosse war in den Augen Papst Stephans ein Kleingeist und für den Kalifen ein unkultivierter Barbar. Auch Vater Pippin konnte sich nicht für ihn erwärmen - während Bruder Karlmann am Hofe erzogen wurde, wuchs der Knabe Karl mehr unter den Stallknechten auf, und dementsprechend waren seine Manieren.
Fast wäre Karl der Welt erspart geblieben. Sein Papa wollte den Rüpel leer ausgehen lassen, als er nach seinem Schlaganfall sein Testament diktierte.
Da aber wurde der Knabe Karl fürchterlich. Mit einer Horde Pferdeknechte stürmte er in das Krankenzimmer, setzte seinem sterbenden Papa ein Messer an die Kehle und meldete nachdrücklich seine Wünsche bezüglich der Erbschaft an. Seinen Bruder hatte er gleich mitgebracht, und einer von Karls Kerlen stocherte mit einem Speer in dessen Magengegend herum, bis Vater Pippin schweren Herzens entschied, das Reich zwischen den ungleichen Brüdern zu teilen. Karl bekam den Nordosten die unzivilisiertere Gegend. "Die passt zu dir", ächzte Pippin und starb.
Damit waren die Bagdad-Verträge zunächst auf Eis gelegt. Karlmann, der sie eigentlich ratifizieren und erfüllen sollte, kam nicht dazu, da ihm sein Bruder laufend Scherereien machte. Karl aber konnte weder lesen noch schreiben und wollte im übrigen seine eigene Politik machen. Deren erstes Ziel aber war, zunächst einmal seinen Bruder vom Thron zu jagen. Dafür war ihm jedes Mittel recht. Der Papst war entsetzt, als Karl 770 mit den Langobarden paktierte. Karl führte die Tochter des Langobardenkönigs zum Traualtar, nur um Hilfstruppen für den Bruderkrieg zu bekommen, und der Papst plante, den Franken für diese Verletzung ausgehandelter politischer Spielregeln mit dem Kirchenbann zu belegen.
Da starb 771 Bruder Karlmann. Bis heute blieb es eine offene Frage, ob nicht sein später heilig gesprochener Bruder dabei nachhelfen ließ. Auf jeden Fall war Karl nun Alleinherrscher der Franken, und das veränderte schlagartig seine bisherige Politik. Noch im selben Jahr ließ er bei Papst Stephan nachfragen, wie das Oberhaupt der Kirche über Ehescheidungen denke. Natürlich gab der Papst begeistert seinen Segen, als Karl die Langobardentochter mit Schimpf und Schande ihrem Papa zurückschickte.
König Desiderius der Lombardei nahm übel. 773 begann der Krieg und endete ein Jahr später damit, dass der letzte Langobardenkönig in ein Kloster gesteckt wurde und sich Karl dessen Krone aufsetzte, einen schlichten Eisenreif, geschmiedet aus einem garantiert echten Nagel vom Kreuz Christi. Solche Reliquien waren im Mittelalter ungeheuer beliebt, und die Christen dürften tatsächlich geglaubt haben, der Heiland sei auf einem Nagelbett verstorben: Zur Zeit Karls des Grossen waren 7.239 Kreuzesnägel im Umlauf, und die unzähligen Kreuzessplitter hätten mühelos einen ganzen Wald ergeben oder Heizmaterial für ein Jahrzehnt.
Der Papst zum Beispiel spendierte Karl bei dieser Krönung sechs Kilo Kreuz, 3 Nägel, ein Pfund Dornen aus der Marterkrone Jesu, den Gürtel Marias und ein Fläschchen mit ihrer Muttermilch, ein Stück vom Tischtuch des letzten Abendmahls, einen Armknochen Johannes des Täufers, ein Schienbein Petri, den Weisheitszahn des heiligen Paulus und den Augenbrauenstift Maria Magdalenas.
Von Mansur aus Bagdad kam nichts er hielt den neuen Frankenkönig für einen unsicheren Kantonisten und investierte lieber in Bestechungen der Offiziere Abderrachmans in Spanien. Besonderen Erfolg hatte er bei Salaiman al-Arabi, dem Gouverneur von Barcelona. Nach und nach wurden an diesen ungetreuen Vertrauten Abderrachmans siebzehn Millionen Mark überwiesen, und als al-Mansur 775 starb und sein Sohn Mahdi neuer Kalif wurde, gelangte auch eine beglaubigte Abschrift der Bagdad-Verträge nach Barcelona.
Mit diesen Papieren und fünf Millionen Mark in Gold reiste Salaiman im Jahr 777 zu Karl nach Paderborn. Dort ließ der "allerchristlichste König der Franken", um seinen vom Papst verliehenen Titel mit einem Hauch von Wahrheit zu garnieren, gerade massenhafte Zwangstaufen sächsischer Adliger veranstalten. Was ihm Salaiman mitzuteilen hatte, war natürlich viel interessanter. Tatsächlich schien Karl bislang die Bagdad-Verträge nicht gekannt zu haben, und auf jeden Fall war die Aussicht, im reichen Süden was holen zu können, wesentlich lockender als ein Missionskrieg gegen die sächsischen Habenichtse.
Schon am nächsten Tag befahl Karl seiner Armee eine scharfe Kehrtwendung. Einige Wochen später marschierten die Franken in Spanien ein.
Chronisten haben diesen Aufmarsch gerne als Kreuzzug bezeichnet. Karls privater Geschichtsschreiber Einhard war da ehrlicher: "Seine Majestät zog in der Hoffnung aus, einige reiche Städte in Spanien zu erobern." Aber auch dafür war das Unternehmen einfach zu dilettantisch geplant. Zehn Jahre hatten die Verträge auf Eis gelegen, und nun musste Karls überstürzte Aktion ein Chaos herbeiführen. Eine Koordination der einzelnen Partner war nicht mehr möglich. Der Papst erfuhr von Karls Aufmarsch erst, als die Franken schon vor Saragossa standen, der Kalif wahrscheinlich noch später.
Als die Flotte der Abbasiden in Richtung Spanien auslief, waren schon sämtliche Pläne gescheitert.
Abderrachman, der Omajade, hatte sich in den letzten zehn Jahren in ganz Spanien Respekt erworben. Dass sich nun ausgerechnet die christlichen Franken in innerspanische Angelegenheiten mischten, trieb auch sämtliche Opponenten auf seine Seite: Für einen Bürgerkrieg wären sie zu haben gewesen; Karls Auftritt aber machte aus der Sache einen "Heiligen Glaubenskrieg", genannt Dschihad. Salaiman wurde von seinen eigenen Leuten gefangengenommen und als Verräter hingerichtet. Dann prügelten die Muslims in überraschender Einigkeit die Franken aus dem Lande.
Der Spanienzug 777/778 wurde Karls des Grossen schlimmste Pleite. Zu allem Unglück fehlte es ihm auch an fähigen Generälen. Der dümmste von ihnen hieß Roland und kommandierte die Nachhut. Beim schimpflichen Rückzug ließ er seine Truppen durch enge Hohlwege marschieren, ohne auch nur die umliegenden Höhen abzusichern. Eine baskische Räuberbande beobachtete diesen Offenbarungseid strategischen Unvermögens mit größtem Interesse. Auf der Passhöhe von Roncesvalles prasselten plötzlich Steinlawinen auf die Franken, und einige Stunden später war die gesamte Nachhut Karls aufgerieben.
Die Werbefachleute der Franken machten aus dem Debakel später ein Heldenepos, genannt "Rolandslied". Es zählt zu den berühmtesten Dichtungen des Abendlandes und ist ein Kunstwerk von hohem Grad, denn selten wurde mit der Wahrheit freier umgesprungen. Wäre Roland nicht persönlich auf der Strecke geblieben, hätte er wegen totaler Unfähigkeit vor ein Kriegsgericht gestellt werden müssen seine rund fünftausend Mann wurden von ganzen zweihundert Basken erledigt. Doch Karls Journalisten waren wesentlich talentierter als seine Heerführer, und aus dem Versager Roland wurde eine strahlende Heldengestalt. Noch heute stehen auf deutschen Stadtplätzen zahllose Rolandsäulen herum, als Vorbild deutschen Heldenmutes.
Karl selbst hatte nach diesem Desaster dringend Trost nötig, und tatsächlich kamen schon ein Jahr später Gesandte des Kalifen. Sie brachten Seide, einen heute in der Wiener Schatzkammer ruhenden Säbel und vor allem zwei Säcke Goldmünzen, als Ersatz für die in Spanien entstandenen Unkosten.
Leider berichten weder islamische noch fränkische Chroniken, wie sich die diplomatischen Beziehungen in den nächsten fünfzehn Jahren entwickelten. Lange Zeit wurde angenommen, es habe eine Art Denkpause stattgefunden, zumal Karl hinreichend damit beschäftigt war, sein Reich in Mittel- und Osteuropa zu festigen. Als erster Germane träumte der Franke von einem vereinten Europa, natürlich unter seinem Kommando. Dazu erfand er eine Devise, die so ungeheuerlich vermessen klang, dass sie auch später für alle tausendjährigen Expansionsversuche herhalten musste: Es fehlt unserem Volk an Lebensraum. Der Osten aber ist primitiv und ohne Geist - dort werden wir ihn finden. Das Land der Primitiven war das heutige Deutschland, und hier betrieb Karl der Grosse eine gründliche Endlösungspolitik. 782 ließ er in Verden anlässlich einer Friedensfeier etliche tausend freie Sachsen erschlagen, 785 zwängte er den letzten Sachsenherzog Widukind in eine christliche Kutte. 788 wurden schließlich die Bayern dem Reich eingemeindet und ihr Herzog Tassilo nach bewährter Manier kastriert und in ein Kloster gesteckt. Von Bayern aus ging es weiter nach Osten, und 792 bereits begegneten die Franken auf vorgeschobenen Grenzposten der anderen Supermacht. Europas: Dem Reich von Konstantinopel.
Während dieser ereignisreichen Jahre fanden jedoch auch ständig Geheimverhandlungen zwischen dem Kalifen und Karl statt. Obgleich fast alle Dokumente verloren gingen, können wir annehmen, dass der Kalif zu einem gewissen Maß den Frankenherrscher finanzierte. Karls Krieger wurden nämlich nur noch teilweise mit Ländereien entlohnt. Ein Viertel des Soldes wurde bereits in bar bezahlt, überwiegend in klobigen Silbermünzen mit der Aufschrift CAROLVS. Generäle aber waren Karl Gold wert, und diese Münzen trugen interessanter weise den Prägestempel des Kalifen.
Warum dieser Goldregen über die Franken kam, werden wir wohl nie erfahren. Mit Sicherheit kam er nicht über den Handel, denn wirtschaftlich hatten die Franken nichts zu bieten. Höchstwahrscheinlich dürfte es sich um Zahlungen aufgrund der Bagdadverträge gehandelt haben, die ja immer noch galten. Schließlich hatte sich der Kalif verpflichtet, dem Frankenherrscher 10.000 Mann zu bezahlen, zum Zwecke einer Invasion Spaniens. Karl aber dürfte einen Teil dieses Geldes zur Eroberung Osteuropas zweckentfremdet haben.
795 besann sich der Franke schließlich wieder der alten Verträge. Mit genau zehntausend Soldaten überquerte er die Pyrenäen und fiel in Spanien ein. Dort war sieben Jahre zuvor Abderrachman gestorben und hatte seinen Sohn Hischam zum Nachfolger bestimmt. Hischam versuchte noch einmal, ein Stück Riviera nördlich der Pyrenäen in seine Gewalt zu bekommen und konnte 793 auch für kurze Zeit Narbonne einnehmen. Damit aber machte er Karl auf sich aufmerksam, und der erinnerte sich seines alten Paktes mit dem Kalifen. In einer konzertierten Aktion fielen beide über den Omajadenspross her: Während die Flotte der Abbasiden die Küsten Südspaniens verunsicherte, besetzte Karls Infanterie einen rund hundert Kilometer breiten Landstreifen Nordspaniens. Beide Gegner auf einmal waren zu viel für Hischam. Die Abbasiden konnte er zurückschlagen; gegen die Franken aber war er machtlos. Ohnmächtig musste Hischam zusehen, wie Karl die einstige Nordprovinz seines Emirates zur "Spanischen Mark" ausbaute und sämtliche Muslims erschlagen ließ.
Damit war allerdings nur ein Teil der Bagdad-Verträge erfüllt. Der andere betraf Konstantinopel, doch da hatten sich die Verhältnisse gründlich geändert, und Karl hatte auch gar nicht die Absicht, die geradlinige Bündnispolitik sein es Papa fortzusetzen.
Am Bosporus regierte eine Dame namens Irene, zu deutsch "die Friedfertige". Genau dies aber war sie nicht. Ihren Weg zum Thron hatte sie mit Leichen gepflastert, unter anderem mit der ihres Gemahls, und ihre Minister mussten sich zuerst in ihrem Bett als fähige Männer erweisen. Wer da versagte, wurde auf dem Bettvorleger geköpft. Ebenfalls persönlich befasste sie sich mit dem Haushalt ihres Reiches, und bald spürten auch die entlegensten Untertanen, dass eine sehr straffe Steuerverwaltung eingerissen war. Besser hat die Beamtenschaft des Reiches nie wieder funktioniert, und angeblich ließ die resolute Dame 12.000 Beamte, die Unterschlagungen begangen hatten, einen Kopf kürzer machen.
Friedlichkeit zeigte Irene nur in ihrer Außenpolitik. Zunächst setzte sie einen Diplomatentrupp auf Karl an. Der bewies dem Frankenherrscher, dass Karl bei den Bagdad-Verträgen eindeutig auf der Verliererseite stünde - der Hauptnutznießer sei nämlich der Papst. Karl ließ sich die alten Papiere nochmals vorlesen und fand, die Dame habe nicht unrecht. Schließlich hätten sich Kalif und Papst brüderlich in das Erbe Konstantinopels geteilt, während die Franken leer ausgegangen wären.
Damit war ein erster Schritt zu freundschaftlichen Beziehungen zwischen Konstantinopel und Frankenreich getan. Irene wollte noch einen Schritt weitergehen und 787 ihren Sohn Konstantin mit Karls Tochter Rotrud verheiraten, doch ihr Sohn spielte da nicht mit: Heimlich hatte er sich mit einer Kammerzofe vermählt, und Mama ließ ihn dafür öffentlich verprügeln. Das kühlte die neue Völkerfreundschaft etwas ab, zumal beide Staaten bald gemeinsame Grenzen und damit auch Grenzstreitigkeiten hatten.
Papst Hadrian zu Rom aber fühlte sich bedroht. Eilig sandte er seine Agenten los, gegen ein mögliches Bündnis zwischen Karl und Irene zu intrigieren - schließlich wäre seine irdische Macht zwischen diesen beiden Supermächten schnell zerrieben worden. Von allen Kanzeln des Frankenreichs verkündigten Prediger, die Byzantiner seien auf jeden Fall schlimmere Gottesfeinde als die Muslims. Vier hochgestellte Kleriker aber reisten nach Bagdad und baten den Kalifen, dringend etwas gegen die Annäherung Konstantinopels zu den Franken zu unternehmen.
Harun al-Raschid ließ unternehmen, und das Diplomatenkarussell rotierte wieder einmal. 796 traf eine Delegation des Kalifen in Aachen ein. Sie brachte reiche Geschenke und wurde glänzend empfangen. Ein Jahr lang wurde verhandelt, und dann waren sich die Parteien einig: Franken und Muslims wollten die Dame Irene gemeinsam zur Kasse bitten. Sie boten ihr unbegrenzte Waffenruhe an, solange Irene alljährlich Tribute an den Kalifen, aber auch an Karl bezahle.
Im Frühjahr 797 zogen die Diplomaten wieder nach Bagdad. Mit ihnen reiste die erste ständige Vertretung der Franken, zwei Ritter namens Sigismunt und Lantfried sowie ein jüdischer Dolmetsch namens Isaak. Außerdem zog auch ein Muslim namens Abdallah an den Kalifenhof, und der muss eine seltsame Figur gewesen sein: Er war der zweite Sohn des Omajaden Abderrachman, hatte seinem Bruder Hischam die Thronfolge streitig gemacht und war von ihm außer Landes gejagt worden. Neun Jahre lang hatte er am Hof Karls ein komfortables Exil genossen. Nun hoffte der Omajade, ausgerechnet mit Hilfe der Abbasiden doch noch Emir von Spanien zu werden.
Damit hatte das diplomatische Verwirrspiel jener Zeit seinen Höhepunkt erreicht. Nie wieder wurde Machtpolitik mit derart unverhülltem Zynismus inszeniert, und selbst heute fällt es schwer, die gesamte Tragweite jener mittelalterlichen Diplomatie abzuschätzen.
Moralische Klammern, aus denen sich politische Linien konstruieren ließen, gibt es nicht - die Fronten verliefen quer durch die Glaubens- und Kulturkreise. Der Antrieb territorialer Vergrößerung spielt auch keine wesentliche Rolle, denn die paar hundert Quadratkilometer spanischer Halbinsel fielen bei dem Riesenreich Karls kaum ins Gewicht. Am ehesten könnte sein, dass der Franke Karl davon träumte, das Imperium Romanum erneut zu errichten. Dafür spricht, dass Karl ein fanatischer Sammler altrömischer Fossilien war. In seiner Schatzkammer häuften sich antike Gemmen mit den Bildnissen längst verblichener Kaiser, und für seine Urkunden verwendete der Analphabet ein Siegel des römischen Kaisers Claudius. Seine Palastkapelle zu Aachen ließ er mit geklauten Römersäulen aus Italien verzieren, als seinen Sarg kaufte er schon 790 einen antiken Sarkophag, und seine berühmte "Palastschule" versuchte ernsthaft eine Wiederaufnahme altrömischen Formgutes. Ausgebildet aber wurden Karls Kunsthandwerker von islamischen Meistern, denn in den Ländern des Halbmondes war die römische Kultur lebendig geblieben. Muslims waren höchstwahrscheinlich am Guss der gewaltigen Domtüren von Aachen beteiligt, doch der Stil dieser Bronzewände ist eindeutig römisch.
Durch seinen Pakt mit dem Kalifen hat Karl auf jeden Fall zwei Mächte in die Klemme gebracht, die ebenfalls das Erbe des alten Rom beanspruchten: Den Papst und Kaiserin Irene. Beide versuchten, sich mit dem Frankenherrscher zu arrangieren. Irene bot ihm 798 sogar ihre Hand und damit den Kaisertitel an. Karl verhielt sich nicht galant: Ruppig ließ er der Dame antworten, sie habe doch schon einen Ehemann ins Grab gebracht, und im übrigen denke er gar nicht daran, Imperator Romanorum zu werden.
Das letztere allerdings war eine glatte Lüge. Karl wollte sogar unbedingt Kaiser werden, und ausschließlich zu diesem Zweck trat er auch wieder mit dem Papst in Verhandlungen. Papst Hadrian hatte gefürchtet, Karl werde ihn aus Rom verjagen und seinen Kirchenstaat dem Reich angliedern. Noch auf dem Sterbebett grübelte er, wie das Reich Gottes auf Erden diesem Schicksal entgehen könne, und er empfahl seinen Kardinälen, sicherheitshalber gleich einen Vertrauten des Frankenkönigs zu wählen.
Das taten Sie auch, und Leo III. kannte seinen Karl so gut, dass er ihn bei den Verhandlungen erfolgreich übers Ohr hauen konnte: Am 23. Dezember 800 wurde ein feierlicher Vertrag aufgesetzt und von Karl mit drei Kreuzen signiert - darin wurde Mittelitalien einschließlich Ravenna "auf ewige Zeiten" dem Papst übereignet. Als Gegenleistung erhielt Karl nichts als einen prächtigen Titel - "Romanum gubernans imperium", Führer des Römischen Reiches. Sogar die Krone für den feierlichen Staatsakt in der Peterskirche am Heiligen Abend 800 musste Karl selbst mitbringen. Und Kaiser des Römischen Reiches war er deswegen noch lange nicht. Dieser Titel blieb in Konstantinopel, und Irenes Nachfolger Michael verhandelte darüber mit Karl nicht weniger erfolgreich als der Papst: 812 wurde in den Aachener Verträgen vereinbart, dass sich Karl Kaiser nennen dürfe, vorausgesetzt, er zahle samt Zinsen alles zurück, was er einst von Kaiserin Irene erpresst hatte.
Als Karl sich mit dem Papst geeinigt hatte, kühlten auch die Beziehungen zum Kalifen ab. Ein Grund dafür mag gewesen sein, dass Karl den Kalifen bei seinen Verhandlungen mit Rom nicht konsultiert hatte. Der andere war zweifellos, dass Sigismunt und Lantfried im Jahr 800 zu Bagdad verstarben, der erste an Cholera, der zweite an Syphilis. Harun al Raschid fand, unter den gegebenen Umständen sei eine ständige Gesandtschaft nicht mehr nötig, und schickte den Dolmetsch Isaak nach Aachen zurück. Mit der Botschaft, dass von nun an keine Zahlungen mehr zu erwarten seien, und mit einem weißen Elefanten als Trostpflaster für Karl.
Der Dickhäuter hieß Abul Abbas und war ebenso alt wie weitgereist. Ein mittelindischer Fürst hatte ihn einst an Kalif Mansur nach Bagdad geschickt. Das Elefanten-Albino erregte allgemeines Staunen, erwies sich aber als dümmer denn sämtliche seiner Artgenossen. Nicht einmal als Reittier war es zu gebrauchen, .M und so ließ es Mansur außerhalb der Stadt in ein Freigehege stecken und vergaß es dort. Erst Harun al-Raschid erinnerte sich seiner wieder, aber nur, um es loszuwerden. Im Reisegepäck Isaaks trampelte Abul Abbas nun von Bagdad bis Antiochia; dort wurde er auf ein Schiff verladen und bald fürchterlich seekrank. Nachdem er das ganze Schiff verpestet hatte, wurde Abul Abbas in Venedig halbtot an Land gezogen und nach einwöchigem Erholungsurlaub quer über die Alpen geschleift. Karl staunte, als das Vieh in Aachen ankam.
Zunächst erfreute sich Abul Abbas der uneingeschränkten Huld Karls. Sogar am kaiserlichen Gottesdienst sollte das Monstrum teilnehmen. Damit es stillhalte, hatte es Isaak noch gut füttern lassen. Die entsprechenden Bedürfnisse erledigte Abul Abbas dann im Münster, und die Gläubigen hielten, was dabei herauskam, für eine Wundermedizin und prügelten sich darum. Karl nahm beide Ereignisse mit Wohlgefallen wahr und lud den Elefanten darauf zu seiner Tafel. Abul Abbas aber wusste diese Ehre nicht zu schätzen. Selbst die ausgesuchtesten Filetstücke verschmähte er und wollte nicht einmal den Kammerdiener fressen, den ihm Karl servieren ließ. Vergeblich versuchte Isaak, seinem Herrscher klarzumachen, Abul Abbas sei Vegetarier. Karl glaubte dem Juden nicht und ließ dem Elefanten so lange Braten servieren, bis sich Abul Abbas selbst bediente: Während Karl der aller höchsten Ruhe pflegte, trampelte sein Elefant eine Palastmauer nieder und fraß den Lieblingsgarten des Kaisers ratzekahl. Da aber hatte es sich Abul Abbas mit Karl verscherzt. Seine Majestät verachtete Vegetarier, und noch am selben Tag schenkte er das Vieh dem Kloster Lippenheim.
Dort ist Abul Abbas im Jahr 810 verstorben. Seine abenteuerliche Wanderung aber war damit noch lange nicht beendet. Einige seiner Knochen erlebten allerhöchste Ehren: Noch vor zweihundert Jahren wurden sie im Dom zu Mainz von gläubigen Christen verehrt, als Gebeine des sagenhaften Riesen St. Christophorus.
Karl überlebte das arme Tier um vier Jahre. Am 28 Januar 814 verstarb der Kaiser zu Aachen, und auch seine Knochen wurden nicht in Ruhe gelassen. Der skrupellose Machtpolitiker wurde ein anerkannter Heiliger der katholischen Kirche, und damit wurden die Gebeine des begeisterten Reliquiensammlers selbst Sammelobjekte. Feierlich wurde der antike Sarkophag erbrochen und sein Inhalt in verschiedene goldene Behältnisse abgefüllt. Der Grossteil davon ruht heute in einem kostbaren Schrein über dem Hochalter des Aachener Doms.
Spanien blieb noch jahrhundertelang unter islamischer Herrschaft, und die Christen sollten ihrem Gott dafür danken, denn von Andalusien aus wurde Europa mit Kultur infiziert.
Als Machtfaktor spielte die Iberische Halbinsel keine Rolle verglichen mit den Supermächten der Zeit, dem Frankenreich, dem Staat der Abbasiden und Konstantinopel, war der Staat der Omajaden auch auf dem Höhepunkt seines Glanzes ein Zwerg.
Vor allem gelang es dem Islam nie, die ganze Halbinsel zu beherrschen. Im Nordwesten hielt sich hartnäckig das christliche Königreich Asturien mit seiner Hauptstadt Santiago da Compostella, Barcelona ging bereits 803 an die Franken verloren, und seit 811 wurde der Ebro die Grenze zwischen Christen und Muslims, die Städte Saragossa und Tortosa Grenzfestungen.
Zu Trockenzeiten können auch Kinder diesen Fluss bequem durchwaten, und daher konnte nie von einer natürlichen Grenze zwischen den Staaten die Rede sein. Spaniens Geschichte ist daher auch die ständiger Rangeleien zwischen Christen und Mauren, die allerdings selten so ernsthaft ausgetragen wurden, dass es einer der Parteien an die Existenz ging. Derlei hätte sich ja störend auf die Wirtschaft auswirken können, und auf diesem Gebiet herrschte zwischen den verfeindeten Staaten Spaniens echte Partnerschaft. Die Traumgüter des Mittelalters wurden auf der Halbinsel hergestellt oder nahmen ihren Weg durch Andalusien: zierlich eingelegte Waffen aus Toledo; feinstes Leder aus Marokko, das heute noch als Maroquin internationale Spitzenpreise erzielt; hauchzarte Spitzen; mit Lüsterfarben leuchtend glasierte Keramik aus Malaga und vor allem der berühmte spanische Wein. Nur selten wurden diese Köstlichkeiten direkt an das christliche Abendland verkauft. 95 Prozent des Warenangebotes gingen zunächst an Zwischenhändler in Asturien, die sich dabei noch einen gewaltigen Aufschlag vergönnten. Die Landschaft Galicien, das Herzland des kleinen christlichen Königreiches, blühte dabei auf. In Santiago lag schließlich der Apostel Jakob begraben, und eine Pilgerfahrt zu diesem Heiligtum war die gängigste Geschäftsreise des Mittelalters. Allein im Jahr 893 brachte die Warenumsatzsteuer dieses Landstrichs 117 Millionen Mark ein.
Den größten Profit machten natürlich die Juden, schon aufgrund ihrer Geschäftsverbindungen zum islamischen Landesteil. Die christlichen Könige sahen das nicht gerne. Um den Handel in ihre Kontrolle zu bekommen, vertrieben Sie wiederholt die Juden Galiciens. Da der Handel natürlich nie ganz ohne Juden laufen konnte, kamen immer wieder welche nach, und daraus ergab sich ein Jahrhunderte dauerndes Katz- und Mausspiel.
Rund alle zwanzig Jahre wurde Galicien "judenfrei" gemacht. Häufig zogen die Flüchtlinge in den islamischen Landesteil zurück, oft übersiedelten sie nach Norditalien und Dalmatien, sehr oft in das Rheinland, wo sich ein neues Wirtschaftszentrum Europas entwickelte. Wo allzu große Gemeinden entstanden, kam es ebenfalls bald zu Judenverfolgungen. Um 1212 begannen die großen Pogrome im Rheinland. In einer Vorwegnahme der Reichskristallnacht wurde die noch aus der Römerzeit stammende Synagoge niedergebrannt. Die vertriebenen Juden zogen in großen Schüben weit nach Osten und fanden im heutigen Südpolen eine neue Heimat. Dort allerdings fühlten sie sich nie so zu Hause wie auf den Zwischenstationen ihrer langen Wanderung: Bis in unser Jahrhundert sprachen sie dort noch das Mittelhochdeutsch aus dem Rheinland des 12. Jahrhunderts, und das unwirtliche Land benannten sie nach der goldenen Provinz Spaniens - Galizien.
In Spanien selbst waren die Judenvertreibungen nur kleine, bedauerliche Randerscheinungen des "großen, heiligen Krieges" zwischen Muslims und Christen. Nach Koran und Bibel fühlten sich die Gläubigen beider Bekenntnisse dazu verpflichtet, aufeinander in Permanenz loszugehen, doch die Wirtschaftsinteressen sorgten gleichzeitig dafür, dass aus diesen religiösen Prinzipien nie blutiger Ernst wurde.
So entstand auf der Iberischen Halbinsel die graziöseste Abart der brutalen Gewalt, das Rittertum. Außer Ehre konnte nicht sehr viel dabei gewonnen werden. Dafür aber bot es das prickelnde Abenteuer echter Gefahr, ohne lebensgefährlich zu sein - zahllose Spielregeln sorgten dafür, dass es auch im Kampf beim Ritterspiel blieb.
Das muss man sich einmal vorstellen: Irgendwo in der Nähe der Grenze treffen zwei Feinde aufeinander. Dass sie Feinde sind, können sie selbst nur an ihren Schildern erkennen, denn Waffen und Rüstungen stammen meist aus denselben Werkstätten. Nun aber führt der eine ein Kreuz und der andere den Halbmond im Schilde, und das ist ein Kriegsgrund. Mit wohl-gesetzten Redewendungen beschimpfen die Herren einander, während die Dienerschaft dezent im Hintergrund wartet. Was geschimpft werden darf, steht genau im Anstandsbuch De procedere hostem, dessen deutsche Übersetzung bereits den sinnigen Titel "Di artige Protzerey" trug:
"Mein Panzer ist schöner als deiner !"-"Mein Pferd ist edler als deines !"-"Ich bin stärker als du, und wenn du nicht gleich abhaust, wirst du schon sehen...!". Hat der Gegner nach viermaligem Protzen, jeweils von einem markigen Trompetenton untermalt, das Feld noch nicht geräumt, kommt es wirklich zu Tätlichkeiten. Mit gestreuter Lanze reiten die Feinde aufeinander los, und wer zuerst vom Pferd geschubst wird, hat Panzer, Pferd und Ehre verloren. Besitzt er außerdem noch Vermögen, kann ihm noch etwas Lösegeld abverlangt werden. Sollte er sich jedoch bei dem Sturz das Genick gebrochen haben, muss der Sieger an die Witwe ein Schmerzensgeld bezahlen.
Auf diese sportliche Weise wurde ein Krieg natürlich fast schon zum vergnügen, und dass Sieger wie Verlierer aus derlei Abenteuern regelmäßig mit Ruhm bekleckert heimkehrten, besorgten ihre Troubadoure. Diese fahrenden Dichter waren die ersten hochdotierten Werbefachleute Europas, und die Kunst des Verseschmiedens hatten die meisten von ihnen an islamischen Fürstenhöfen gelernt. Von Burg zu Burg zogen sie als Abendprogramm der Recken und Damen. Sentimentale Liebeslieder, genannt Minnedichtung, sonderten sie nur selten ab. Überwiegend sangen sie vom Ruhm ihrer Auftraggeber, und dessen Größe ergab sich aus dem Honorar. In der Regel machten sie aus dem feindlichen Ritter eine ganze Armee, und Spanien wurde in ihren Liedern das Land der unbegrenzten Abenteuer: Hier gab es den Heiligen Gral und den Zauberer Klingsor, der in Wahrheit Almansor hieß und Wesir zu Cordoba war; hier lauerten stolze Mauren auf ahnungslose Parsivale und hinter goldenen Gittern dunkelhäutige Frauen der Erlösung. Wer sich mit ihnen einließ, musste allerdings damit rechnen, gescheckte Kinder zu bekommen. Die dichterische Freiheit ist mit der Iberischen Halbinsel schon damals arg umgegangen: Kamele waren selbstverständlich feuerspeiende Drachen, die perfekten Panzer der Muslims von Dämonen geschmiedet und ihre Ärzte unheimliche Zauberer.
Keinem der Zuhörer im langweiligen Christenland kamen diese bunten Schilderungen spanisch vor, und so drängten vor allem fränkische Jungmänner zum Abenteuer jenseits der Pyrenäen. Kehrten sie zurück, konnten sie natürlich nicht weniger auf schneiden als ihre Vorgänger, und damit waren die Grundlagen für die ritterliche Dichtung des Abendlandes geschaffen.
Natürlich musste es ein Spanier sein, der Jahrhunderte später das Strickmuster dieser Romanzen mit einer genialen Parodie der Lächerlichkeit preisgab Miguel de Cervantes mit seinem unsterblichen Don Quichotte.
Viele der christlichen Ritter blieben gleich im Heidenland. Schließlich war das Leben bei den Muslims um vieles angenehmer, und da vergaßen sie gerne den Kampf für das Christentum.
Um das Jahr 1000 bestand die islamische Armee Spaniens zu 70 % aus christlichen Söldnern. Viele der Abenteurer pendelten zwischen den Fronten - je nach Bezahlung kämpften sie mal für die Heiden und mal für den christlichen König von Asturien. Der berühmteste von ihnen hieß Don Ruy Diaz de Vivar und brachte es bis zum Statthalter und Festungskommandanten von Saragossa. Insgesamt hatte er siebenmal auf christlicher und neunmal auf islamischer Seite gekämpft. Mit vierzig begann ihn der Rheumatismus zu plagen. Von da an verhielt er sich neutral und ließ sich von beiden Parteien bezahlen. Gewissen ist eine Geldfrage, meinte der Recke. Als "el Cid" wurde er unsterblich.
Die Jahrhunderte Andalusiens könnten wir am ehesten als "kriegerische Koexistenz" bezeichnen. Zwar gelobte jeder christliche König bei seiner Thronbesteigung, ganz Spanien dem Kreuz zurückzuerobern, doch solange seine Staatskasse auf den islamischen Zwischenhandel angewiesen war, wurden diese schönen Schwüre natürlich nicht in die Tat umgesetzt. Und solange die Muslims an den christlichen Kunden verdienten, hielten auch sie Frieden. Dass ein "Gleichgewicht des Schreckens" die tödliche Auseinandersetzung verhindert habe, kann nicht behauptet werden - sowohl islamische als auch christliche Staaten Spaniens zeigten oft und deutlich militärische Schwächen, ohne dass sie vom Gegner ausgenutzt wurden.
Die einzige ernsthafte Bedrohung kam aus dem Norden: 844 fuhren die Drachenboote der Wikinger im Hafen von Lissabon ein und sollen fast 700 Kilo Gold weggeschleppt haben. Im selben Jahr noch ruderten sie sogar den Guadalquivir hoch und plünderten Sevilla. Doch die Muslims wurden selbst mit den rauen Nordmännern handelseins - von nun an plünderten die Wikinger nur noch im christlichen Königreich Asturien. Dort gab es zwar weniger zu holen, das aber gefahrloser.
So wenig fühlten sich die Muslims vom christlichen Norden bedroht, dass sie sich bald auch in Spanien die beliebteste Form arabischer Politik leisten konnten, den permanenten Bürgerkrieg. Das Reich der Omajaden zerfiel um 950 in eine Unzahl untereinander zerstrittener Kleinstaaten, von denen einige sogar unter marokkanischen Einfluss gerieten.
In wirtschaftlicher Hinsicht aber wurde jedes dieser kleinen Fürstentümer eine Großmacht. In Andalusien entstanden kunstgewerbliche Zentren, deren Einfluss sich keine Stadt Europas entziehen konnte. Die mittelalterlichen Goldschmiede des Rheinlandes haben fast alle von Mauren gelernt, die flandrischen Tuchweber kopierten die Webstühle und Stoffmuster von Sevilla, und hinsichtlich "höherer Lebensqualität" gab Andalusien das ganze Mittelalter lang den Ton an: Die Dichter und Minnesänger übernahmen den islamischen Endreim in ihre Sprache und als "Alexandriner" eine arabische Versform. Und das Epos der Griechen kehrte über Spanien als "Romanza" und "Roman" in das Abendland zurück. Christliche Mystiker schöpften ausgiebig in den Quellen arabischer Philosophie, und sogar Thomas von Aquin, der Großmeister der Scholastik, betätigte sich nebenbei als Übersetzer arabischer Literatur. Andalusia patria fontium, notierte sein Schüler Bernhard von Clairvaux: Andalusien ist das Mutterland der Quellen, und Wolfram von Eschenbach lässt seinen Parzival in Andalusien nach dem Heiligen Gral suchen.
In Spanien hinterließ der Islam auch einige der schönsten Zeugnisse seiner hohen Kultur. Nach den Vorstellungen des Koran ist das höchste Ziel aller Kunst die Überwindung und Auflösung der Materie. Nach diesem Prinzip entstanden in Andalusien Stein gewordene Träume. Die große Moschee von Cordoba bietet ein heute noch unübertroffenes Raumerlebnis einen - Wald von neunhundert Säulen, auf denen seit mehr als tausend Jahren zierliche Steinbögen schweben! Und aus der Abenddämmerung Andalusiens stammt der schönste Palast, der je gebaut wurde, die Alhambra zu Granada.
Viele Bücher sind über dieses Wunderwerk geschrieben worden, und doch kann ihm keine Beschreibung gerecht werden" Kein Foto kann den unwirklichen Zauber der stillen Höfe wiedergeben und nicht einmal ein Film das verwirrende Spitzengewebe, das die Phantasie eines unbekannten Architekten aus der tonnenschweren Kuppel im "Saal der zwei Schwestern" geschaffen hat.
Als dieser Inbegriff der Romantik entstand, waren Andalusiens Tage bereits gezählt. In dem Maß, wie das Abendland vom Islam lernte, wurde der Lehrmeister entbehrlich und lästig. Europa wurde von islamischer Kunstfertigkeit zunehmend unabhängiger, und damit war die Macht Andalusiens vorüber. Aus Bewunderung wurde Neid, und als im 13. Jahrhundert die weltweite Macht des Islam stürzte, endete auch in Spanien die Toleranz zwischen den beiden Religionen. Im Auftrag ihrer christlichen Fürsten begannen Abenteurer, die islamischen Kleinstaaten der Halbinsel zu erobern.
Das Ende Andalusiens war langsam und blutig. Muslims wurden aus den christlich eroberten Gebieten gnadenlos vertrieben und schließlich im Süden der Halbinsel geradezu zusammengedrängt. Viele Mohammedaner traten natürlich zum christlichen Glauben über, schon um ihre Besitztümer zu erhalten. Es half nichts - die Inquisition konnte ihnen jedes mal erfolgreich nachweisen, dass ihr Christentum doch nicht das rechte sei. Damit waren sie dem Scheiterhaufen und ihr Besitz der Kirche verfallen.
Am längsten hielt sich Granada. Dorthin flüchteten auch die besten Künstler Andalusiens. Ihre Produkte waren weltweit gefragt, doch davon profitierte nur der spanische Zwischenhandel und die kleine Fürstenfamilie der Nasriden, die sich die Alhambra leisten konnte. Auf dem Basar wurden Kunstwerke gegen Gemüse aufgewogen, und so ergriff kein Andalusier eine Waffe für sein Fürstenhaus, als König Alfons und Königin Isabella beschlossen, auch das letzte islamische Fürstentum auf der Halbinsel ihrem jungen Staat einzuverleiben. Am Neujahrsmorgen des Jahres 1492 übergab der letzte Nasride seinen Kleinstaat ohne weitere Förmlichkeiten dem "allerchristlichsten Königspaar". Noch im selben Jahr wanderte eine halbe Million Muslims aus und fand meist in Marokko eine neue Heimat. Und im Herbst schickte die Königin einen Abenteurer aus Genua los, einen direkten Seeweg nach Indien zu finden. Er hieß Columbus, und damit beginnt ein neues Kapitel der Geschichte.
Die Landkarte allerdings, die Columbus benützte und die sich als so fehlerhaft erwies, war die Kopie einer viel älteren, angefertigt im Jahr 802 zu Bagdad am Hofe Harun al-Raschids. Und bis heute hat sich in Spanien zumindest ein islamisches Erbe im täglichen Gebrauch erhalten - aus dem arabischen "insch-Allah" wurde das Vielzweckwort Ole.
|
|
Harun al-Raschids Pleite
"Dem schlichten Urteil handle ich zuwider. Mich überwältigt, was mir widersteht. Wie kann ich das Gegeb'ne wieder nehmen, Wenn nach der Beuteteilung nichts mehr geht? Ich fürchte die Verwicklung der Geschäfte Und dass sich auflöst, was ich fest gedreht." (Harun al-Raschid)
|
|
|
Tausendundeine Nacht
Natürlich durften auch in Bagdad Damen nur verschleiert auf die Strasse gehen. Viele jüngere fanden, diese altmodische Vorschrift passe so gar nicht in die eleganteste Stadt der Welt, und eine von ihnen entschloss sich zu einem unübersehbaren Protest: als Straßenkleid wählte sie einen hauchdünnen, durchsichtigen Seidenschleier, und darunter trug sie nichts.
Die Dame kam nicht weit. Schon nach zwei Straßenecken wurde die Feministin verhaftet und vor das Bezirksgericht geschleppt. Der Fall war delikat, und der Kadi beschloss, lieber den Kalifen entscheiden zu lassen. Einige Stunden später stand die unzüchtige Verschleierte vor dem allmächtigen Harun al-Raschid.
Der besah sich den Fall eingehend. Dann erhob er sich und sprach das Urteil: "Das Gesetz bestimmt, dass sie gesteinigt wird." Aus seinem Turban löste er einen Diamanten und warf diesen ersten Stein auf die Sünderin. Es folgte der Rubin des Großwesirs, ein Saphir des obersten Richters, der Smaragd des Polizeipräsidenten, ein funkelnder Regen aus den Reihen der Minister und Hofbeamten. Als solcherart dem Gesetz Genüge getan war, sammelte die hochkarätig Gesteinigte den Sündenlohn in ihrem sündhaften Schleier und entschwebte, höchstwahrscheinlich in den Harem Haruns.
So kennt die Nachwelt den berühmtesten Kalifen. Seine Züge leuchten unsterblich aus einem bunten Mosaik zahlloser Geschichten, und da stört auch nicht sonderlich, dass jede der anderen widerspricht. Alle Legenden, die je von Herrschertugenden und Herrscherlaunen berichtet wurden, hat der Märchendurst der Untertanen auf Harun gehäuft, wie jener die Juwelen seines Hofstaates auf die schöne Sünderin, und nur manchmal geriet unter die funkelnde Pracht auch ein Körnchen Wahrheit.
Da gibt es die rührende Geschichte vom gerechten Kalifen, der in einfacher Kleidung unerkannt durch Bagdad bummelte, um Gesetzwidrigkeiten seiner Beamten auf die Schliche zu kommen. Sämtliche Fürsten der Geschichte scheinen auf Haruns Spuren gewandelt zu sein. Johann Peter Hebel erzählt haargenau dasselbe Märchen in seinem "Schatzkästlein des rheinischen Hausfreundes" über den guten Kaiser Josef, und im Jahre des Herrn 1974 stand die Geschichte als ernsthafte Reportage über den dortigen König im Staatsorgan des kleinen Himalayalandes Nepal.
Soweit die Sache Harun betrifft, hat das Märchen einen wahren Kern. Niemand in Bagdad nämlich wusste, wie der Kalif aussah, denn kein Bürger der Stadt bekam ihn je zu Gesicht. Daher konnte natürlich mit Fug und Recht in jedem Dunkelmann auf nächtlichen Strassen der Märchenkalif vermutet werden.
Auch die Geschichte der Edel-Steinigung könnte wahr sein - in seinem täglichen Umgang mit den Gesetzen bewies Harun meist einen ähnlich eleganten Zynismus, der allerdings nur höchst selten den Opfern der Justiz zugute kam.
Unbestritten jedoch ist, dass unter Haruns Herrschaft der Halbmond seinen höchsten Glanz entfaltete. Von da an ging's bergab und eigentlich schon mit Harun, den der Franke Karl stets mit seinem biblischen Namen Aaron titulierte (und dabei nicht verhehlte, dass er sich selbst für eine Neuauflage von dessen biblischem Bruder Moses hielt).
Schließlich wurde auch auf Harun al-Raschid das berühmte arabische Sprichwort geprägt, dass eine tüchtige Familie stets im dritten Glied verkomme.
Harun wurde 765 zu Bagdad geboren, im elften Regierungsjahr seines Großvaters al-Mansur. In den Hofannalen wurde seine Geburt als Routinefall verzeichnet, denn sein Papa war zwar der älteste Sohn des Kalifen, spielte aber sonst keine Rolle. Al-Mansur hatte das Reich von seinem Bruder nur unter der Bedingung geerbt, dass nach ihm wieder ein Sohn Saffahs Kalif werden solle, und daher war Mahdi Ben Mansur von der Thronfolge ausgeschlossen. Dadurch aber gewann der Abbasidenprinz genügend Freizeit für sein Hobby, und das waren Frauen. Mahdi sammelte sie mit wahrer Leidenschaft. Außer seinen acht Hauptfrauen tummelten sich noch siebenhundertachtunddreißig Nebendamen und Sklavinnen in seinem Harem. Da fiel nicht sonderlich auf, dass die Sklavin Chaiseran eines Knaben entbunden wurde, zumal dieser schon der zweite war.
Chaiseran dürfte Mahdi von allen seinen Frauen am besten gefallen haben. Während Mahdi mit den anderen 745 Damen nur 149 Söhne hatte, war die schlanke Perserin gleich Mutter von zweien, Hadi und Harun. Außerdem war Chaiseran ehrgeizig.
Sie sorgte dafür, dass sich ihre Sprösslinge nicht allzu sehr in das Prinzen Gewimmel der anderen mischten, und erreichte sogar, dass diese beiden Enkelkinder dem allmächtigen Großvater al-Mansur vorgeführt wurden. In seinen Memoiren beschreibt Harun seinen Eindruck von dem großen Kalifen: "Ich war neun Jahre alt und furchtbar aufgeregt. Ich sah aber nur einen mageren, Mann mit gelber Haut, traurigen Augen und ständigen Bauchschmerzen."
Al-Mansur bereiteten damals nicht nur seine Magengeschwüre Sorgen, sondern auch die Thronfolge. Der Kalif wollte das Reich nämlich seinem eigenen Sohn Mahdi vererben, und dabei wollte der eigentliche Thronfolger Ben Saffah nicht mitspielen. Al-Mansur war gewiss nicht zimperlich, doch bei Ben Saffah biss er auf Granit. Der Thronfolger hatte sich in Syrien verschanzt und weigerte sich, seinen Onkel "zwecks freundlicher Unterredung" zu besuchen. Er kam auch nicht, als Mansur den gesamten Harem des Prinzen umbringen ließ. Erst Chalid Ben Bermek, der unermüdliche Großwesir, konnte das Problem lösen: Zu ihm hatte der Prinz Vertrauen, und er empfing den Wesir sogar in seinem Wüstenschloss. Bei dieser Gelegenheit schlug ihm Chalid den Schädel ein.
Damit war das Thronfolgeproblem glücklich gelöst. Ein Jahr später erlitt al-Mansur einen Magendurchbruch, und der dreiunddreißigjährige Mahdi wurde Kalif.
Die meisten Muslims bekamen den Thronwechsel kaum zu spüren. Mahdi kümmerte sich auch als Kalif nicht sonderlich um den Staat. Ihn interessierten nach wie vor nur Wein, Weiber und die Jagd. Die Regierungs-Geschäfte besorgten in schöner Eintracht Chalid Ben Bermek und Chaiseran, die Lieblingssklavin.
Natürlich sorgte Chaiseran nun erst recht dafür, dass ihre Söhne gebührend gewürdigt wurden. Der ältere, Hadi, wurde gleich bei der Thronbesteigung seines Vaters zum Thronfolger erklärt, während der zehnjährige Harun den Rang eines Generalfeldmarschalls erhielt. Schon mit vierzehn erntete der junge Prinz erste Lorbeeren auf dem Feld der Ehre und auf Kosten Konstantinopels.
Derlei früher Ruhm war auch bei Christlichen Edel-Knaben nicht ungewöhnlich. Karls Kinder haben schon im Baby-Alter gewaltige Heldentaten begangen. Es gehörte Zu den Propagandamethoden des Mittelalters, künftige Herrscher und Feldherren aus der Gehschule auf die hohe Schule der Kriegskunst zu katapultieren - die Söldner gewöhnten sich beizeiten an die Namen ihrer künftigen Henker,
und dass die Kleinen als Generäle keinen Schaden anrichten konnten, besorgten schon im Anonymen wirkende Fachleute, ausgesucht von versierten Pragmatikern. Im Falle Haruns wissen wir auch, wer dem Kleinen die Hand führte: Jahja Ben Chalid Ben Bermek, der Sohn des Großwesirs.
Die Familie Bermek hatte sich um das Haus Abbas verdient gemacht. Da Chalid auch im Falle Mahdi "Kalifenmacher" war, galt das Wort des Großwesirs im Reich sogar mehr als das des Kalifen. Und Chalid hatte arrangiert, dass sein Sohn Jahja das Amt des Ministerpräsidenten erben sollte. Dabei berief sich der Wesir auf einen gespenstischen Präzedenzfall: Rund fünfzig Jahre zuvor hatte im Frankenland Karl Martell dieses Amt zu einem Erbstück seiner Familie gemacht, und sein Sohn Pippin setzte dann gleich den König ab. Dem Kalif schien das egal zu sein Hauptsache, er selbst brauchte sich nicht um den Staat zu kümmern und hatte genügend Zeit für sein ausgedehntes Privatleben. In einer feierlichen Urkunde ließ er im Frühjahr 782 das Amt des Ministerpräsidenten zu einer Erbpfründe der Sippe Bermek erklären. Sein Großwesir revanchierte sich für diese großzügige Geste mit einem diplomatischen Meisterstück: Nach kurzen Kampfhandlungen und langen Friedensverhandlungen zwang er Kaiserin Irene von Konstantinopel zu jährlichen Tributen von 35 Millionen Mark in bar, zahlbar in die Privatkasse des Kalifen. Kurz darauf verstarb der alte Königsmacher im Kreise seiner Familie, und neuer Großwesir wurde vertragsgemäß sein Sohn Jahja, zuvor Erzieher des "zweiten Prinzen" Harun al-Raschid.
Der einzige, der was gegen dieses Arrangement hatte, war der "erste Prinz" und Thronfolger Hadi. Er hatte andere Erzieher, die ihm schon beizeiten klarmachten, dass er als Kalif höchstens eine Puppe in der Hand der Bermekiden sei, eventuell noch unter der Zusatzfuchtel seiner Mama Chaiseran. Und so stellte sich Hadi das Kalifat nicht vor. Nach allem, was von ihm an Äußerungen erhalten blieb, schienen seine Vorstellungen als künftiger Herrscher des Halbmondes in Richtung Sonnenkönigtum zu zielen. Daher musste es zum Konflikt mit den Bermekiden und Mama kommen. Und Hadi hatte auch schon einen Punkt gefunden, wo er bei seinem Papa einzuhaken hoffte: Chaiseran hatte ein Verhältnis mit dem Großwesir. Darüber wollte der Prinz mit seinem Papa einmal ernsthaft reden.
Hadi hatte Pech. Er kam nicht einmal bis zu seinem Papa. Der Kalif blieb stets auch für seinen eigenen Sohn unerreichbar. Entweder ließ er sich von seinen 746 Haremsdamen den schon sehr umfänglich gewordenen Bauch kraulen, oder er spielte mit seinen anderen 150 Söhnen Schach, oder er war gerade auf Jagdausflug oder bei einer Staatsbesprechung unabkömmlich. Vier Jahre lang stand der Thronfolger auf irgendwelchen Vorzimmermatten, und im Frühling 785 erfuhr er zufällig, sein Papa sei gerade mit Mama und Jahja dabei, das Thronfolgeproblem neu zu überdenken. Chaiseran und Jahja nämlich fanden, der zweite Prinz Harun sei ein Wesentlich bequemerer Charakter als Hadi. Nun war der offene Konflikt unvermeidlich geworden, und eilends suchte Hadi Bundesgenossen für seine Sache. Anscheinend fand er einen im Statthalter Nordpersiens. Jedenfalls brach Kalif Mahdi höchst-persönlich im späten Juli 785 aus Damaskus in Richtung Norden auf, um den Gouverneur von den Argumenten seiner Favoritin und seines Großwesirs zu überzeugen. Chaiseran und Jahja selbst blieben in Bagdad. Der Karawane des Kalifen aber folgten im Abstand von einer halben Tagereise zwei weitere: eine prunkvolle des Thronfolgers Hadi und, mit einer Meile Respektabstand, eine geradezu bombastische mit Harun al-Raschid.
Es war eine seltsame Reise. Alle drei Karawanen lagerten stets in Sichtweite, aber jede igelte sich vor den anderen ein, als Würden sich drei feindliche Heerlager gemeinsam durch das Land bewegen. Am 4. August beschloss jede Karawane, einen Erholungstag mit Jagdausflug einzulegen. Das Gelände war unübersichtlich und mit zahllosen Ruinen einer alten Perserstadt gespickt. Als am Abend, in jedem Lager natürlich gesondert, zum Halali geblasen wurde, fehlte der Kalif. Erst in der Nacht fand man Mahdi neben seinem Pferd unter einem alten Torbogen und mit gebrochenem Genick.
In Eilmärschen rasten nun alle drei Karawanen zurück nach Bagdad. Hadis kam als erste an, und er verkündete auch die offizielle Todesursache seines Vaters: Das Pferd des Kalifen sei allzu hoch unter einem allzu niedrigen Torbogen durch gesprungen, und dabei habe sich Mahdi den Kopf angeschlagen. Das verhängnisvolle Mauerloch wird heute noch etwas südlich von Kermanschah in Persien gezeigt - es ist gute fünfzehn Meter hoch. Damit war Hadi Kalif geworden.
Seine Mama und Jahja aber nicht los, und auch Harun erklärte war er deswegen noch lange sich keinesfalls bereit, die Sache so hinzunehmen. Welche Intrigen nun in Bagdad gesponnen wurden, lässt sich nicht mehr feststellen. Hadi versuchte, sich mit seinem Bruder zu einigen und erklärte ihn Zum Thronfolger. Andererseits soll Hadi ernsthaft versucht haben, Harun ermorden zu lassen. Und nicht nur Harun, sondern auch Chaiseran und Jahja Bermek. Fast hätte er damit auch Erfolg gehabt, hätten nicht die vorgesehenen Opfer... Tatsache ist, dass ein Jahr und zwei Monate lang weder der Kalif noch Harun noch der Großwesir noch Chaiseran in der Öffentlichkeit gesehen wurden. Jeder hielt sich in einem anderen Flügel des Palastes verschanzt, und nur höchst gelegentlich erschien ein Hofbeamter minderen Ranges vor dem schwarz-goldenen Vorhang des Thronsaales und verlas ein meist sehr nebensächliches Bulletin.
Am 15. September 786 erscholl plötzlich in allen Gassen Bagdads die Fanfare des Kalifen, Zeichen für alle Würdenträger des Reiches, sich schleunigst im Thronsaal einzufinden. Eine Stunde später hob sich unter rauschenden Jubelchören der Vorhang: Auf dem Thron saß Harun al-Raschid.
Ehe sich noch die Versammelten von ihrem, Staunen erholen konnten, trat auch schon der Großwesir vor und erklärte, Kalif Hadi sei diesen Morgen friedlich in den Armen seiner Mutter entschlafen.
Dass dem so sei, bezweifelte niemand. Keiner aber glaubte, dass dies friedlich geschehen sei. Noch im selben Jahr vermerkte ein Historiker unwidersprochen, Chaiseran habe ihren Sohn vergiftet, und als dies nicht schnell genug gegangen sei, habe die Mutter noch einige Kissen genommen und Hadi eigenhändig erstickt. Außerdem erklärte der Wesir, im Harem der verblichenen Kalifen Mahdi und Hadi sei Ordnung geschaffen worden, um künftige Thronstreitereien zu verhindern. Auch davon konnten sich die Versammelten durch Augenschein überzeugen: Vor dem Thron Haruns lagen die Köpfe, seiner 149 Halbbrüder und 6 Neffen.
Harun al-Raschid war bei seiner Thronbesteigung erst zweiundzwanzig Jahre alt. Ein bequemeres Geschöpf hätten sich seine Mama und ihr Wesir nicht wünschen können.
Harun war von Jahja zu einem willenlosen Papagei. erzogen worden, und Haruns erstes Wort als Kalif galt seinem Großwesir: "Ich lege die Verantwortung für meine Untertanen auf deine Schultern. Regiere sie nach deinem Gutdünken. Ernenne und entlasse, wen du willst. Hier ist mein Siegelring - ich vertraue ihn dir an."
Damit zog sich Harun von den Regierungsgeschäften zurück und wurde nur höchst selten im Thron- und Kabinettssaal gesehen.
In Wahrheit war Harun al-Raschids glorreiche Regierung die seines allmächtigen Großwesirs. Der Kalif selbst kümmerte sich überhaupt nicht um das Riesenreich, und es war schon viel, wenn er ab und zu einmal aus Neugierde eine ausländische Gesandtschaft empfing. Jahja Bermek sorgte auch dafür, dass bei dieser Dauerfreizeit keine allerhöchste Langweile aufkam - er gliederte seinem Kabinett ein Ministerium für Allerhöchste Vergnügen an, und darin arbeiteten bald an die sechstausend Staatsbeamte.
Der Großwesir hatte sein Handwerk von seinem Papa gründlich gelernt, und wenn die Qualifikation von Staatsmännern ausschließlich nach Erfolg beurteilt wird, gehört der Bermekide durchaus zu den größten dieser amoralischen Zunft. Ein Riesenreich zusammenzuhalten, ist schon eine Kunst. Eines mit Arabern dazu, bereits ein Genieakt. Jahja Bermek schaffte es, und dabei war er mit seinen Methoden gewiss nicht zimperlich.
Die wichtigste Stütze der Macht war ein ausgezeichneter Geheimdienst, von dem durchaus auch unsere heutigen Supermächte einiges lernen könnten. Geld aus Bagdad finanzierte die Innenpolitik Europas, ein Wink des Wesirs ließ die Mächtigen in Konstantinopel und Rom erzittern, und mit unverschämter Offenheit bestimmte Jahja Bermek für die übrige Welt, was Freiheit und Rechtsstaatlichkeit sei und wie er sie verstanden haben wolle.
Zumindest der katholische Papst Hadrian war lange Zeit nur eine Marionette an der goldenen Leine Bagdads.
Allerdings erlitt auch die Supermacht Bagdad ihr Vietnam: Trotz intensivsten Einsatzes gelang es nicht, das abtrünnige Spanien wieder an die Kandare zu bekommen, und die ungeheuren Aufwendungen, die dieses zwecklose Unterfangen verschlang, sorgten dafür, dass das Volk nicht sehr viel von dem märchenhaften "Goldenen Zeitalter" verspürte. Der Lebensstandard in den Ländern des Kalifats hätte beträchtlich höher sein können, wären nicht alljährlich Milliarden für die Rückeroberung der rebellischen Halbinsel verbuttert worden.
Der Grund für diesen Wahnsinn ist eine gespenstische Parallele der Geschichte: Auch Jahja Bermek hatte seine Domino-Theorie. Würde Spanien seine Unabhängigkeit ungestraft behaupten können, wären bald auch Afrika und Ägypten für Bagdad verloren.
Tatsächlich hatte Bagdads Lage einen großen Nachteil: Der Westen des Reichs war von dieser Verwaltungszentrale aus nur schwer in den Griff zu bekommen. Bagdad lag zu weit östlich, und die Entfernung der Hauptstadt förderte ebenso wie das drückende Abgabensystem die Unabhängigkeitsbestrebungen der Westprovinzen.
Schließlich war es auch den Abbasiden nicht gelungen, den ganzen Stamm der Nachkommen Alis auszurotten. Ein Alide namens Idris schlug sich bis Marokko durch, warb dort unter den Berbern genügend Anhänger und erklärte sich nach einem kurzen, aber erfolgreichen Guerillakrieg zum unabhängigen Herrscher Marokkos, lustiger weise am selben Tag, an dem Harun den Thron zu Bagdad bestieg.
Jahja nahm diese Nachricht Zunächst nicht ernst und schickte nur eine Armee und eine Brigade seines Geheimdienstes in die rebellische Provinz. Die aber bewirkte, dass Idris 788 in ganz Nordafrika als "Beherrscher der Rechtgläubigen" anerkannt wurde. Daraufhin schloss Jahja mit dem Aliden einen feierlichen Friedensvertrag und schien sich dem Schicksal zu fügen.
An einem Sommerabend des Jahres 792 ließ Idris seinen Leibarzt rufen. Der Fürst litt an heftigen Zahnschmerzen. Der Medikus gab ihm eine Salbe, und am nächsten Morgen war Idris tot. Als seine Beamten den Quacksalber suchten, war der verschwunden. Kurz darauf wurde er nach einer abenteuerlichen Flucht ehrenvoll zu Bagdad empfangen, ein Meisteragent Jahjas. Damit herrschte im Westen vorübergehend Ruhe, doch Jahja beschloss, für künftige Aufstände die stehende Armee des Islam zu vervierfachen. Araber und Perser erschienen ihm als Söldner für Bürgerkriege natürlich zu unzuverlässig, und so beschloss der Großwesir, für das blutige Handwerk Gastarbeiter zu engagieren. Im Nordosten des Reiches, dem heutigen Südrussland, hausten damals die Nomadenstämme der Türken, und die holte nun Jahja, in das Land. Das Gold des Kalifen lockte im Lauf der nächsten Jahre eine wahre Völkerwanderung in den Nahen Osten:
Bereits im Jahr 800 standen 280.000 türkische Gastarbeiter in den Diensten Bagdads.
Kalif Harun al-Raschid bemerkte von alledem nicht viel. Er kam vor lauter Festlichkeiten gar nicht dazu.
Im Jahr seiner Thronbesteigung ehelichte der Kalif die schönste Tochter seines Erziehers und Wesirs, Sobeida. Das Bankett dauerte siebzig Tage lang, und am 11. Tag des Riesengelages wurden unter anderem frischer Helgoländer Hummer und Austern aus der Bretagne serviert. In eisgekühlten Töpfen hatten die Leckereien den weiten Weg tatsächlich heil überstanden. Am Abend des letzten Tages nahmen der Kalif und seine Braut auf einem Teppich Platz, der mit 17.000 Edelsteinen bestickt war. Dann trat der Großwesir hinter die beiden und ließ aus einer diamantbesetzten Schale 2.000 Perlen über das Paar rieseln, jede mindestens zehn Karat schwer. 200.000 Öllampen erhellten die märchenhafte Szenerie.
Der Teppich wurde nach der Zeremonie zerteilt und in kleinen Flicken als Ehrengabe an befreundete Fürsten und Würdenträger verschenkt. Einen Zipfel davon erhielt auch Karl der Grosse, und einige Edelsteine daraus leuchten heute in der tausendjährigen Reichskrone zu Wien.
Die solcherart geschlossene Ehe soll eine überaus glückliche gewesen sein, und als glückliches Paar wurden Harun und Sobeida die Helden der Märchensammlung "Tausendundeine Nacht". In Wahrheit aber dürfte Sobeida eine sehr launenhafte Dame gewesen sein und Harun ihr folgsamer Pantoffelheld. In der Hochzeitsnacht besorgte ihr's der Kalif nicht so ganz, wie Sobeida sich die Sache erwartet hatte. Beim Frühstück schmollte die junge Ehefrau und erklärte, so lange in Streik zu treten, bis ihr der Kalif einen Wunsch erfüllt habe. Harun al-Raschid war bestürzt und erklärte sich sofort bereit, alles zu tun, was Sobeida verlange. Da klatschte Sobeida in die Hände, und aus den Falten eines seidenen Vorhangs trat die hässlichste Negerin, die je den Sklavenmarkt von Bagdad verunstaltet hatte. Sie hieß Meradschol, war vierzig, hatte einen Buckel, schielte, hinkte und war ein so schlimmer Ladenhüter, dass sie schließlich nur fünf Mark gekostet hatte, weniger als ein Huhn. "Schlaf mit ihr," befahl die Gattin dem Kalifen. Harun sträubte sich lange, und dann tat er es doch. Aus dieser bösen Laune Sobeidas wurde Haruns erster Sohn. Da Sobeida kinderlos blieb, wurde der Mulatte Mamun später sogar Kalif.
Denn Harun hatte für Frauen nicht sehr viel übrig.
Sein Harem wimmelte zwar von Frauen aller Farben und Formen, doch mit sämtlichen 2045 Damen zeugte der Kalif nur elf Söhne. Mehr als zu Sobeida fühlte sich Harun zu ihrem Bruder Dschaffar hingezogen, dem jüngsten Sohn Jahjas.
Dschaffar Bermek war zwei Jahre jünger als Harun, und der Kalif liebte ihn abgöttisch. Vater Jahja aber hatte mit seinem Sohn andere Pläne und ernannte ihn wie dessen beide Brüder zu einem Provinzgouverneur. Doch da spielte Harun nicht mit. Kaum war Dschaffar in sein neues Amt abgereist, trat der Kalif in Hungerstreik. Jahja reagierte zunächst nicht und erwartete, dass sich Harun wie üblich den Entschlüssen seines Wesirs fügen werde. Diesmal aber unterschätzte er al-Raschid. Einen vollen Monat lang fastete der unglückliche Liebhaber und war schon ziemlich entkräftet, als Jahja Dschaffar per Eilpost zurückholen ließ.
Überglücklich schloss der Kalif Dschaffar in seine Arme und beschloss, ihn nie wieder loszulassen. Der Hofschneider musste ein erstaunliches Kleidungsstück schneidern: Ein Hemd mit vier Armen und zwei Kragen. Fast ein Jahr lang wandelten der Kalif und sein Geliebter als siamesische Zwillinge durch Palast und Gärten. Auch auf dem Thron saßen sie zu zweit. In Bagdad wunderte sich bald niemand mehr darüber. Nur der Botschafter Konstantinopels berichtete seiner Kaiserin mit Nasenrümpfen, dass der Kalif während einer Audienz nicht nur auf dem Thron, sondern auch auf dem Schoss seines Geliebten saß. Wörtlich: "Da ihn dieser während der gesamten Feierlichkeit von rückwärts liebte, wurde mir nicht die uneingeschränkte Aufmerksamkeit des Beherrschers aller Gläubigen, Gott strafe sie, zuteil."
Solange der Kalif mit Dschaffar trudelte, konnten Jahja und seine beiden übrigen Söhne nicht nur das Reich ganz nach ihrer Lust und Laune regieren, sondern sich dabei auch einiges herausnehmen. Fahdl, der älteste Sprössling des Großwesirs und Statthalter von Chorassan, war Säufer und konnte oft bereits zur Mittagszeit nur noch lallen. In früheren Zeiten hätte ihn das auf jeden Fall seinen Posten gekostet. Als nun die Klagen über den entarteten Sohn allzu laut wurden und auch nach Bagdad drangen, konnte sich Vater Jahja mit einem milden Verweis begnügen:
"Solange Tag ist, suche Ruhm und Ehren und dulde des Geliebten Ferne.
Doch sinkt die Sonne erst und kommt die Dämmerung
und breitet über alle Sünden dunkle Schleier,
dann suche den Genuss, der dir gefällt.
Der weisen Männer Tag beginnt am Abend."
Eine Abschrift dieses Briefes gab er Harun, und der nahm sich die Ermahnung ebenfalls zu Herzen: Von Stund an blieb der Kalif tagsüber unsichtbar. Die Nächte aber verbrachte er weiterhin mit Dschaffar.
Als Anstands- und Gesellschaftsdame fungierte dabei Haruns Schwester Abbasa. Sie schien die einzige Frau zu sein, die Harun wirklich etwas bedeutete. Um nun auch bei diesen Zusammenkünften den vollen Schein der Moral zu wahren, schlug Harun vor, Dschaffar mit Abbasa zu verheiraten. Allerdings unter der Bedingung, dass die beiden nicht etwa aus dem Spaß Ernst machten. Harun wollte jeden für sich allein.
Kurz darauf wurde Hochzeit gefeiert, und die entsprechende Festlichkeit war nur um hundert Perlen bescheidener als Haruns eigene Vermählung. Bei dieser Gelegenheit wurde am Kalifenhof eine Zeremonie eingeführt, die wahrscheinlich aus Indien stammt; die "Gewichtsnahme". Harun al-Raschid wurde mit Gold aus der Staatskasse aufgewogen und sein Gewicht an " die Armen" verteilt. Von nun an ließen sich viele islamische Herrscher, meist an ihrem Geburtstag, aufwiegen, und aus diesem Brauch entstand das schöne islamische Gebet: "O Allah, gib uns einen fetten Herrn." Harun al-Raschids Großzügigkeit kam den Fiskus allerdings nicht so teuer zu stehen - der Kalif wog nur 53 Kilo.
Anschließend begab sich Harun wieder einmal auf Pilgerfahrt nach Mekka. Beinahe jedes zweite Jahr zog er auf die fromme Wanderschaft, der letzte Kalif, der sich eine längere Abwesenheit von der Hauptstadt leisten konnte. Da in Wahrheit Jahja das Regiment führte, wurde der Herrscher auch nie vermisst.
Auch Abbasa und Dschaffar vermissten Harun nicht Die beiden Gefangenen im goldenen Käfig fanden aneinander Gefallen, und während der nächsten Wallfahrten des Kalifen blieb dies nicht folgenlos. In aller Heimlichkeit gebar Abbasa zwei Kinder und schickte sie unter falschem Namen zu einer Berufsamme nach Mekka.
Was nun geschah, wird in den Geschichtsbüchern als schauerliche Eifersuchtstragödie geschildert: Harun bekam Wind von der Sache, und an einem Sommertag ließ er Abbasa zu sich rufen, die ihm zitternd so ziemlich die ganze Wahrheit gestand. Dschaffar hielt sich zu dieser Stunde gerade in seinem eigenen Palast auf, den er erst vor kurzem auf Staatskosten für 200 Millionen Mark hatte erbauen lassen.
Harun soll einen ziemlichen Schock erlitten und sich fürchterlich betrunken haben. Dann befahl er, den Palast seines Lieblings zu umstellen, und rief nach dem Kommandanten seiner persönlichen Leibwache. Der hieß Masrur, und mit ihm beriet Harun, was nun zu tun sei.
Masrur war ein kluger General. Zunächst befahl er, auch die anderen Paläste der Familie Bermek zu umzingeln. Dann verbeugte er sich vor dem schon schwer betrunkenen Harun: "Jeder Wunsch ist mir Befehl."
"Bring mir seinen Kopf," lallte der Kalif.
Masrur begab sich zu Dschaffar. Auch der war zunächst nur schwer ansprechbar. "Leg dir Eisstückchen auf dein besoffenes Hirn," sagte der General. "Der Kalif will deinen Kopf sehen."
"Der Kalif will mich sprechen?" stammelte Dschaffar.
"Nein, nicht dich, nur deinen Kopf." Sehr langsam begriff Dschaffar.
"Hat auch der Kalif ... ?" fragte er und deutete auf die zahlreichen Weinflaschen, die herumlagen.
Masrur nickte.
"Dann weiß er nicht, was er redet. Frag ihn noch einmal."
Tatsächlich ging Masrur noch einmal zum Kalifen. Doch der war mittlerweile nicht nüchterner geworden.
"Bring mir seinen Kopf! Ich mache dich dafür zum Großwesir." Masrur setzte sich wieder in Trab. Dschaffar hatte sich mittlerweile auf Verhandlungen eingestellt. Zunächst bot er Masrur fünfzig ausgesucht schöne Damen an.
"Bedaure, ich bin Eunuch," meinte Masrur.
Daraufhin schlug Dschaffar vor, alle Schätze der Familie mit Masrur zu teilen und gemeinsam Harun umzubringen.
"Wenn ich dich umbringe, werde ich Großwesir, und das ist sicherer," meinte Masrur und schlug Dschaffar den Kopf ab.
Einige Minuten später überreichte Masrur mit einer eleganten Verbeugung die blutige Reliquie seinem Kalifen.
Harun al-Raschid weinte wie ein kleines Kind : "Was hast du mir angetan, Dschaffar," schluchzte er und küsste den blutigen Schädel. "Was für eine Schande für uns! Warum sagst du denn nichts dazu? Warum willst du mich nicht mehr küssen?" Masrur veranlasste daraufhin alles übrige. Noch in derselben Nacht wurden sämtliche Angehörige der Familie Bermek samt Angestellten, Dienern und Sklaven umgebracht. Am nächsten Tag wurden die Leichen an allen Brücken Bagdads aufgehängt und Dschaffar gleich dreimal, säuberlich zerteilt. Sein Glied aber ließ Harun in eine goldene Dose einlöten und bewahrte es in seinem Schlafzimmer auf.
Natürlich ist diese schauerliche Geschichte nur ein Teil der ganzen Wahrheit. Zwar ließ Harun bei seiner Mekka-Wallfahrt im nächsten Jahr auch die beiden Kinder Abbasas vor seinen eigenen Augen in ein Feuer werfen, doch ist diese private Tragödie nur ein Glanzlicht der politischen. Die schreckliche Sommernacht des Jahres 802 lag schon lange in der Luft.
Ob die Familie Bermek tatsächlich versucht hat, die Abbasiden nach fränkischem Muster vom Thron zu drängen, wird wohl für immer ihr Geheimnis bleiben. Viele Anzeichen sprechen dafür. Schon lange war der Großwesir wesentlich reicher als sein Kalif, und Harun hatte Jahja oft genug um Geld anbetteln müssen. In vielen Provinzen glaubte die Bevölkerung sogar, der wahre Kalif heiße Jahja, und auf einem Stadttor Bagdads prangte die geradezu vermessene Inschrift: "Du kannst aus jedem Land der Welt her reisen
Den Weg wird dir der Name Bermek weisen." Der Großwesir war zu allmächtig geworden, und es war für Harun al-Raschid eine Frage der Selbsterhaltung, sich dieser bedrohlichen Sippe zu entledigen. Harun hat die Bermekiden in einem eleganten Staatsstreich gestürzt, meisterlich inszeniert von Masrur, dem Kommandanten der Leibgarde. Buchstäblich bis zur letzten Minute bekam nicht einmal der Geheimdienst des Wesirs Wind von dem Komplott, das der Perfektion nach, mit dem es schließlich ablief, lange und gründlich geplant sein musste. Doch war auch Harun nur eine Puppe in den Händen Jahjas, und dadurch entstehen einige Fragen: Wieweit war der Kalif in die Vorbereitungen des Putsches eingeweiht?
Spielte der Kalif tatsächlich eine entscheidende Rolle oder wurde ihm nur wie üblich mitgespielt? War das Ganze in Wahrheit nur eine Aktion Masrurs, um selbst allmächtiger Großwesir zu werden?
Dieses hochgesteckte Ziel erreichte der Eunuch nicht. Harun hatte nicht vor, sich ein zweites Mal entmündigen zu lassen. Von Stund an regierte der Kalif als sein eigener Ministerpräsident, und der Kommandant der Leibgarde wurde nur zum Generalfeldmarschall befördert.
Sämtliche Truppen aber erhielten einen Jahressold extra, ein Beweis dafür, dass sich der Beherrscher aller Gläubigen auf seine Truppen nicht mehr ohne ständige Geldzuwendungen verlassen konnte.
Im Sommer 802 wurde Harun al-Raschid somit wirklich Beherrscher der Gläubigen, siebzehn Jahre nachdem er den Thron bestiegen hatte. Und die Bedingungen, unter denen Harun nun zu regieren hatte, waren schlicht katastrophal.
Mit dem Sturz der Sippe Bermek wurde selbstverständlich auch das gesamte Kabinett geköpft. Jahja Bermek hatte sämtliche Beamte bis hin zum stellvertretenden Stellvertreter des zweiten Ministerialsekretärs ausschließlich mit seinen Leuten besetzt, und die konnten natürlich für Harun keine verlässlichen Stützen sein. Nur: Nun fehlten mit einem Schlag alle erfahrenen Beamten des Reiches, und Nachwuchs war weit und breit nicht in Sicht.
Zunächst zog Harun sämtliche Kompetenzen an sich. Abgesehen davon, dass der Kalif von Regierungsgeschäften bislang überhaupt nichts verstand, war dies natürlich ein unmögliches Unterfangen. Bald ächzte der Harem Haruns über seinen Gebieter. Die Tage der Feste waren vorbei al-Raschid hatte die zahllosen Damen zu Sekretärinnen umfunktioniert, und Hauptfrau Sobeida fungierte, obwohl selbst eine Bermek, als Innenminister. So entstand, ausgerechnet im Islam, das erste Frauenkabinett der Geschichte.
Die Sache ging schlimm aus. Die Damen wussten ja nicht, wie die Welt außerhalb ihrer vergoldeten Mauern aussah. Ihre einzigen Informationen waren die Plaudereien Haruns, und der kannte die meisten politischen Zusammenhänge ebenfalls nur vom entfernten Hörensagen. So verspielte Bagdad innerhalb eines Jahres so ziemlich seinen ganzen politischen Kredit.
Da schrieb eine Dame namens Fatima einen würdevollen Brief an den Papst: Mit Entrüstung, habe sie vernommen, dass die Moschee namens Peterskirche nicht die vorgeschriebene Gebetsrichtung nach Mekka aufweise. Das Gemäuer sei natürlich sofort einzureißen und gemäss den Bauvorschriften des Islam neu zu errichten, und was dem Papst denn einfalle ...
Eine andere Dame namens Assasa schien das Oberhaupt der Christenheit besser zu kennen. Erfolgreich verschacherte sie ihm eine Sammlung von achtzehn prominenten Heiligenköpfen. Jeder Schädel wurde mit Gold aufgewogen, und erst nach Jahrhunderten kam heraus, dass die heiligen Häupter in lebendigem Zustand zu einer Räuberbande gehört hatten, kurz vor Verkauf hingerichtet.
Insgesamt schrieben in jenem Jahr 803 sieben Damen aus Haruns Harem an den Papst, und keine wusste von der anderen. Auch über die Innenpolitik konnten sich die Damen nicht einigen. Als es darum ging, den Thronfolger Zu bestimmen, kam es im Harem zu bösem Streit. Außer Mamun, dem Nebenergebnis der bösen Laune Sobeidas, hatte Harun noch elf Söhne gezeugt. Der eine hieß Amin und sollte sogar Sobeidas einziges Kind sein, somit also der ranghöchste Anwärter. Sein Problem war nur, dass seine Mutter zwar Sobaida hieß, jedoch nicht die Gebieterin des Harem war, sondern nur eine gleichnamige Nebenfrau vierten Ranges. Doch schien Amin ein hübscher Junge zu sein: Sobeida adoptierte den Sohn Sobaidas, und damit wurde Amin ein ernsthafter Gegenkandidat des Erstgeborenen Mamun. Zur Wahl standen ferner noch die Knaben Mutamin und Mutasim und sieben weitere, von denen man nicht genau wusste, wer ihr Vater sei, da sie von Harun und Dschaffar in Gemeinschaftsaktionen gezeugt wurden. Nach langem Hin und Her kamen die Damen überein, das Reich zwischen allen zu teilen. In braver Reihenfolge sollten sie sich im Kalifat ablösen, und die zahlreichen Mütter verewigten diesen seltsamen Beschluss in einer bombastischen Urkunde.
Der Kalif aber sollte das Meisterwerk weiblicher Staatskunst seinen Untertanen schmackhaft machen. Zu diesem Zweck unternahm er eine Wallfahrt nach Mekka, hing den Erbvertrag an der Kaaba auf und versammelte davor sämtliche Beamte der Provinzialverwaltung.
Die Bermediken hatten die Reichsverwaltung neu und mustergültig organisiert.
Aus den Scheichs, den alten Stammesfürsten, waren Landkreisvorsitzende geworden, die außerdem noch den bargeldlosen Zahlungsverkehr überwachten. Moscheevorsteher und somit in kleineren Gemeinden auch Bürgermeister waren die Imams. Oberste Distriktrichter im Sinn einer Gewaltenteilung zwischen Exekutive und Justiz hießen Kadis. Sie sprachen nach dem Recht des Koran. Das Recht des Staates aber vertrat in jedem Dorf ein von der Bevölkerung selbstgewählter Friedensrichter. Dieses System war neu und revolutionär. Die demokratische Wahl des Friedensrichters fand zwar in der islamischen Praxis nie so recht statt, doch das Vorbild wirkte in alle Welt und mehr als ein Jahrtausend lang: Die Briten lernten es anlässlich der Kreuzzüge kennen und übernahmen es gleich für ihr eigenes Land, und von dort guckten es sich die jungen Gemeinden des Wilden Westens ab. So kam der islamische Friedensrichter bis in die USA, und sogar unter gleichem Amtsnamen Scherif.
Ihnen allen nun präsentierte Harun al-Raschid zu Mekka und im Jahr 803 die Ideen seines Harems, und die Beamten schüttelten die Köpfe. Das sei nackter Wahnsinn, meinten sie einstimmig, und keiner von ihnen werde die Urkunden anerkennen, es sei denn... So wurde Harun al-Raschid regelrecht erpresst. Schließlich musste er seine eigenen Beamten mit 53 Millionen Mark zum Gehorsam bestechen, und damit war der Nimbus seiner Allmacht endgültig verspielt.
Der nächste Ärger für Harun kam aus Konstantinopel. Dort war im Sommer 802 Kaiserin Irene vom Thron gejagt worden, und vorübergehend nahm darauf ein Herr Platz, der von sich behauptete, selbst arabischer Abstammung zu sein. Sein Urgroßvater soll als syrischer Provinzfürst zu den Widerstandskämpfern gegen den Islam gehört haben, und daher meinte Kaiser Nikephoros, er wisse schon, wie man mit Muslims umgehen könne.
Zunächst verweigerte er die Zahlung der jährlichen Tribute, zu denen sich Irene verpflichtet hatte. Als aus Bagdad ein Mahnschreiben eintraf, schrieb er eigenhändig und auf arabisch einen Brief an Harun:
"Von Nikephoros, dem Kaiser der Römer, an Harun, angeblichen König der Araber. Meine Vorgängerin hielt Dich auf dem Schachfeld der Politik für einen Turm und sich selbst für einen Bauern. Deshalb hat Sie an Dich ihr Geld vergeudet. Aber Du weißt ja aus eigener Erfahrung, dass Weiber nicht regieren können.
Zahle also alles zurück, was Du je von uns bekommen hast, sonst gibt es Krieg."
Als Harun al-Raschid diesen Brief bekam, lief er vor Wut rot an. Laut Chronik soll er nach fünf Minuten erbleicht sein und nach weiteren zwei Minuten wild zu brüllen begonnen haben. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich schon die meisten Hofbeamten unauffällig aus dem Staub gemacht. Eine volle Stunde dauerte der allerhöchste Wutanfall, und dann verlangte Harun nach Tinte und Feder. Eigenhändig schrieb er auf die Rückseite dieser Unverschämtheit seinen berühmtesten Brief:
"Im Namen Allahs, des Allmilden, des Allerbarmenden! Von Harun, dem Beherrscher der Gläubigen, an Nikephoros, den römischen Hund. Ich habe Deinen Brief gelesen, Du Sohn einer Hure. Meine Antwort aber wirst Du nicht hören, sondern sehen."
Am selben Tag noch ordnete Harun für sämtliche Truppen Generalmobilmachung an. An der Spitze der Armee stellte sich der sonst nur süßes Leben gewohnte Kalif, fiel in Kleinasien ein und verheerte das Land bis knapp vor Konstantinopel. Winselnd musste Nikephoros um Frieden bitten und alle ausstehenden Tribute samt Zinsen zahlen.
Seine Ruhe aber fand Harun al-Raschid nicht mehr. Nikephoros gab noch lange nicht auf, und so kam es mit schöner Regelmäßigkeit jedes Jahr zum Krieg. Und zu allem Überfluss brachen noch in fast allen Provinzen des Reichs Aufstände aus. Mal putschten die Schiiten, mal versuchte sich ein Statthalter unabhängig zu machen, und ab und zu gründete ein Imam eine neue Sekte. Im Jahr 806 reiste Harun noch einmal nach Mekka, aber nur, um auch dort einen Aufstand niederzuschlagen. Der Dichter Kelabi schreibt über die letzten Jahre des Kalifen: "Wo steckt der Kalif nur? Er sammelt Lorbeerkränze
quer durch die Wüste oder an der Grenze.
Man findet ihn im Feindeslande auf dem Ross
und wenn zu Hause, dann auch nur beim Tross." Die Wahrheit war noch viel prosaischer. Der Kalif zog wie ein Gehetzter durch sein Land und versuchte verzweifelt, sein zerfallendes Reich zusammenzuhalten. Bagdad, den Schauplatz seiner strahlenden Feste, hat er seit 803 nicht mehr betreten.
Dort regierte und intrigierte zwar sein Harem, doch der Kalif wurde vor allem von der Wirtschaft schwer vermisst. Die Grossaufträge des Hofes blieben aus, und so kam es in der elegantesten Stadt der Welt erstmals zu einer ernsten Beschäftigungskrise. Beinahe monatlich schrieb der Börsen-Scheich einen dringenden Brief an seinen Gebieter: "Komm zurück, o Sonne unserer Tage. Wir vermissen Dich schmerzlich, und unser Leben ist ohne Deine großzügige Nähe sinnlos." Harun antwortete jedes mal herzlich und bedauernd. Er konnte nicht. Fast ständig lebte er im Heerlager, misstrauisch bewacht von Masrur, der den Kalifen fast schon wie seinen Befehlsempfänger behandelte. Hätte sich Harun von der Armee entfernt, hätte sie geputscht. Wäre er mit ihr nach Bagdad gezogen, wahrscheinlich erst recht. Und dann wäre ihr auch die gesamte Zivilverwaltung in die Hände gefallen. "Ich bin ein Gefangener meiner eigenen Armee," schrieb Harun mit verzweifelter Offenheit an Sobeida. "Und ich bleibe es gerne, solange ich dadurch nur euch in Freiheit weiß."
Der einzige Ort, wo sich der Kalif noch längere Zeit aufhielt, war Rutba, schon damals ein trostloses Wüstennest zwischen Syrien und dem Irak. Zwei Monate pro Jahr fand Harun dort etwas Ruhe. Ein Gesandter des Papstes beschreibt den dreiundvierzigjährigen Märchenkalifen: "Als wir zu ihm vorgelassen wurden, sahen wir ihm die Strapazen des langen Marsches noch deutlich an. Er war wundgeritten und konnte kaum gehen. Obwohl er doch durchaus auf der Höhe seiner Jahre ist, sieht er aus wie ein gebrechlicher Greis. Seine Haut ist gelb und faltig, und er klagt über ständige Leibschmerzen. Um sie zu lindern, trägt er eine Seidenbandage, und er lässt Eure Heiligkeit bitten, Euren Segen auszusprechen."
Die Zeiten des Glanzes waren vorbei. Die Soldforderungen seiner Soldaten aber wurden immer unverschämter, und dadurch kam das gesamte Finanzsystem des Islam in Unordnung. Im Jahr 808 konnte das Reich Harun al-Raschids eine Inflationsrate von 23 Prozent verbuchen. Und zu allem Überfluss hatte auch noch der Statthalter der Provinz Chorassan "das Kleid des Gehorsams ausgezogen."
An der Spitze der Armee brach Harun nach dem Nordosten auf. In der Nacht vor dem Abmarsch quälte ihn ein Traum: Eine Hand mit zwei Warzen reichte ihm etwas rote Erde, und dazu sagte eine Stimme, in dieser werde der Kalif begraben.
Vergeblich bemühten sich sein Arzt und sein Hofnarr, den Herrscher zu beruhigen. Während der Reise diktierte Harun sein Testament.
"Ich habe eine Wasserleitung nach der Stadt Mekka gebaut.
Doch die Liebe meiner Völker ist vertrocknet. Ich habe mich dem Willen meiner Frauen und Söhne gefügt, doch sie interessieren sich nur noch für mich, um meine Atemzüge zu zählen. Ich wollte den höchsten Glanz des Islam, und nun kann ich nur seinen Bankrott vererben."
Tatsächlich zog ein bereits Todkranker durch sein Reich. Höchstwahrscheinlich litt Harun al-Raschid an Leberzirrhose. Seine Hofdichter feierten ihn natürlich als Musterbeispiel orthodoxer Tugend, doch der Kalif war sein Leben lang Alkoholiker, und während der letzten schlimmen Jahre war sein einziger Freund ein mörderisch hochprozentiger Dattelschnaps.
Als Harun al-Raschid die Stadt Tus in Chorassan erreicht hatte, wurde ihm ein Bruder des rebellischen Statthalters vorgeführt. Der Kalif befahl seinem Hofmetzger, den Gefangenen vor ihm zu zerhacken. Lange starrte der Kalif auf das im Sande versickernde Blut. Dann sprang er auf und brüllte nach Masrur.
"Nimm etwas von der Erde in deine Hand," befahl Harun dem General. Da sah Harun an Masrurs Hand die Warzen seines Traumes.
Von nun an verweigerte der Kalif die Nahrung. Nach zwei Tagen verfiel er zusehends und konnte kaum mehr sprechen. Vielleicht wird mein Grab einmal glänzen, waren seine letzten Worte. Am 23. März 809 verschied der mächtigste Herrscher seiner Zeit, 45 Jahre alt und im 23. seiner Regierung.
Er wurde der berühmteste aller Kalifen, doch daran hatte er wenig Verdienst. Die Märchensammlung 1001 Nacht, deren Held er ist, entstand drei Jahrhunderte später, und da war seine seltsame Regierung schon wieder gute, alte Zeit. Dass sie vergangen war, hat Harun al-Raschid selbst verschuldet - seine Regierung war das Ende der Allmacht des Kalifen. Die goldene Zeit war, wenn schon, das Regime der Sippe Bermek. Sie spannen das weltweite Diplomatennetz, das Harun schließlich auflöste, und sie schufen die erstklassige Verwaltung, die unter Harun korrumpierte.
Bemerkenswert bleibt allenfalls, dass der Kalif für das Schachspiel die Rochade erfand.
Dass er einen Kanal zwischen Mittel und Rotem Meer an genau der Stelle plante,wo heute der Suez-Kanal ist und zuvor schon ein ägyptischer war, und ihn dann doch nicht baute, weil sonst die Flotte Konstantinopels vielleicht Mekka hätte bedrohen können. Und ein kleines Gedicht aus der Feder Haruns, das zu den schönsten Liebesgedichten der Erde zählt: "Früher Tau wirbt um halboffene Kelche.
Der Wind des Südens, geliebtes Kind,
umarmt sie in trunkenen Stunden.
Deine Augen, geliebtes Kind,
sind kühle Seen in den Bergen meiner Seele.
Meine Lippen haben alles gekostet
und sehnen sich nach deinem Mund, geliebtes Kind,
den Mund, um den mich Bienen beneiden." Sein letzter Wunsch nach einem glänzenden Grab ging in Erfüllung, wenn auch anders, als sich Harun al-Raschid dachte. Im heutigen Mesched zu Nordpersien wurde er begraben. Genau dort wünschte sich auch ein Imam der Schiiten sein Grab, um dem Abbasidenhund die letzte Ruhe zu vergällen. Mesched wurde ein berühmter Wallfahrtsort der Schiiten. Wenn die Muslims ihre Andacht vor dem Grab des Heiligen und Propheten Nachkommen verrichtet haben, stellen sie sich vor dem Grabmal Harun al-Raschids an. Zum Ritual der Wallfahrt gehört nämlich auch, den schlichten Grabstein des Märchenkalifen zu bespucken.
|
|
Die Gastarbeiter Übernehmen die Firma
|
|
|
Der freundliche Imperialismus
Als Autor des "Dschungelbuchs" wurde Rudyard Kipling unsterblich. Dabei ist dieser Dauerbestseller nur ein Nebenprodukt seiner Literaturwerkstatt. In sämtlichen anderen Schriften vertritt der knorrige Brite ernsthaft die Ansicht, es sei "die Bürde des weißen Mannes", den übrigen Völkern der Erde Kultur beizubringen, mit Gewalt und gegen gesalzenes Lehrgeld. Damit wurde der pensionierte Kolonialoffizier zum Hofideologen des Imperialismus. Konservative und neo-linke Historiker sehen im Imperialismus gemeinhin ein Kind der Briten und des neunzehnten Jahrhunderts. Da aber kennen sie die Muslims des neunten Jahrhunderts schlecht. Abgesehen davon, dass Bagdad zu jenem Zeitpunkt ebenso groß war wie London zur Glanzzeit des Empire, hatten auch die Kalifen ihre Ideologen. Einer namens Hunein Ben Ischag schrieb so um 830: "Allah hat auf unsere Schultern die Last gelegt, die Erde mit Kultur und Zivilisation zu erhellen. Daher ist es unsere Pflicht, alle Dinge der Erde zu nehmen und durch die Berührung unserer Hände zu heiligen."
Wie die Chinesen darüber dachten, wissen wir nicht. Auch nicht, unter welchen Bedingungen sie ihre Städte Kanton und Schanghai als Kolonien an die Araber verpachteten. Auf jeden Fall saßen im neunten Jahrhundert bereits die Araber an sämtlichen Plätzen Asiens, wo sich ein Jahrtausend später Briten und andere Kolonialisten tummeln sollten, und meistens auch schon in denselben Erwerbszweigen. Von den Chinesen kauften sie Porzellan und jene berühmten Gewebe, die der Prophet als Luxus verboten hatte und auf deren Vertrieb sich die Firma "Sejd und Söhne" so nachhaltig spezialisierte, dass heute noch Seide nach Sejd benannt wird. Als Gegenleistung lieferten die Muslims einen weit gefährlicheren Traumstoff, Opium. Die persischen Mohnfelder, heute Privateigentum des Schahs, gehörten damals den Kalifen, und die arabische Opium-Vertriebsstelle zu Schanghai hielt sich bis vor hundert Jahren. Da wurde die Firma von den Briten übernommen und spielte als "Jardine, Matheson & Co" ihre unheilvolle Rolle weiter, bis 1949 zum 1111 jährigen Firmenjubiläum Mao den Laden endgültig schloss.
Auch in Bombay besaßen die Muslims eine blühende Kolonie.
So wie sie war, wurde sie neunhundert Jahre später von den Engländern übernommen.
In Java, Sumatra und Ceylon gab es selbstverständlich ebenfalls Niederlassungen, die jederzeit Schecks aus Bagdad akzeptierten, und falls als Zahlungsmittel Gold gefragt wurde, kam es aus islamischen Bergwerken an der Goldküste Ghana.
Der barbarische Norden war für das hochentwickelte Banksystem der Kalifen natürlich zu unterentwickelt. Hermelin, Birkenrinde, Fischleim, Rohleder, Pfeile und blonde Sklaven wurden an die arabischen Außenhandelsstationen nur gegen Barzahlung verschachert, und so finden sich zahllose Münzen des Kalifen noch heute in schwedischer, finnischer und selbst isländischer Erde.
Bagdad erschien wahrlich als der Mittelpunkt der Welt, und wer in Mitteleuropa was darstellen wollte, kleidete sich auch nach der Mode Bagdads. Am erfolgreichsten setzte sich die Dschubba durch, ein kurzes und bei kaltem Wetter potenzmörderisches Kleidungsstück, aus dem unsere Joppe wurde.
Doch der Glanz Bagdads warf zu kurze Schatten, als dass er der anderen Welt auf die Dauer hätte erträglich sein können. Staunend betrachteten die Bauern den Goldregen, der auf die Hauptstadt und die großen Städte niederging, und von dem weder Kalif noch Kaufleute einen Tropfen abgeben wollten.
Schon zu Haruns Zeiten formierten sich die ersten sozialistischen Gruppierungen des Islam. Lautstark forderten sie eine Demokratisierung des Systems und eine gleichmäßige Verteilung des Volksvermögens. An eine Internationale allerdings dachten sie nicht, eher an eine Art Revolution in der Chefetage, und da diese selbstverständlich die Länder des Islam waren, fanden sie in den Provinzen auch begeisterten Zulauf.
Harun al-Raschid aber dachte gar nicht daran, über derlei Unsinn auch nur zu diskutieren. Militär sollte diese Drecksarbeit erledigen, aber dafür waren die arabischen Krieger nicht nur zu schade, sondern auch zu unzuverlässig. So kamen die Gastarbeiter in das islamische Reich.
Die meisten waren Nomaden türkischer Abstammung aus der weiten südrussischen Steppe. Vor Jahrhunderten hatten sie Chinas Westgrenzen unsicher gemacht und waren von den Chinesen Hiun-nu genannt worden. Unter diesem Namen hatten sie sich auch einmal bis Westeuropa durchgeplündert, und Harun engagierte sie nach seinen eigenen Worten aufgrund ihrer Charaktereigenschaften: "Sie haben keine Kultur, denken nicht viel und tun, sofern man sie bezahlt, stets blind, was man von ihnen verlangt."
Damit sind sie ideale Garanten für Sicherheit und Ordnung, denn deren Feinde sind stets Leute, die sich Gedanken machen und mehr im Kopf haben als nur Geld. Als Harun al-Raschid starb, dienten in der Armee bereits 20.000 türkische Gastarbeiter. Viele von ihnen hatten aus der Steppe ihre Familien nachkommen lassen, und die übernahmen bald alle Arbeiten, für die sich Araber und Perser zu schade waren. Bereits 909 wurden in Bagdad Straßenreinigung und Müllabfuhr von Fremdarbeitern besorgt.
Kalif aber wurde Amin, der Lieblingssohn Harun al-Raschids. Er sah blendend aus wie sein Papa, war ebenfalls bei der Thronbesteigung 22 Jahre alt und teilte auch Papas Vorliebe für Knaben, die aber noch viel einseitiger.
Sobeida, die im Kabinett noch immer und im Harem erst recht das Regiment führte, musste ihren Liebling geradezu überlisten, pflichtgemäß einen Nachkommen zu zeugen: Die schönsten Sklavinnen wurden in Männerkleidung gesteckt und kredenzten so dem jungen Kalifen seinen heißgeliebten Rosenlikör. Eines Abends und nachdem Amin sehr viel getrunken hatte, verfing die List, und daraus wurde der Knabe Musa.
Amin hatte damit seinen kaliflichen Pflichten nach eigenem Ermessen Genüge getan und widmete sich hinfort nur noch einem griechischen Eunuchen namens Kewser. Die als Männer verkleideten Damen aber wurden beibehalten und gehörten noch bis in unser Jahrhundert in jeden fürstlichen Harem des Orient. Als Ghulamijet, zu deutsch "Knäbinnen", bildeten sie zusammen mit den Eunuchen das exotische Inventar sexueller Orientierungslosigkeit.
Mit dem so entstandenen Baby hatte Sobeida große Dinge vor.
Musa war noch keine sechs Monate alt, als Sobeida ihn schon zum Thronfolger erklären und seinen Namen im offiziellen Freitagsgebet verlesen ließ.
Damit musste es zu Streit mit den anderen Brüdern Amins kommen, auf die Vater Harun das Reich verteilt hatte und die der Reihe nach Amin im Kalifat nachfolgen sollten. Bereits 810 stellte Mamun, der den Nordosten und Chorasan geerbt hatte, seine Zahlungen nach Bagdad ein.
Ein Jahr später wollte Sobeida mit einer Armee von 40.000 Türken* das ausständige Steuerfünftel eintreiben lassen, doch Mamun war besser gerüstet und schlug das Heer Amins vernichtend. Noch im Juni wurde
Mamun im Norden zum Kalif ausgerufen, und das war auch für die anderen Provinzen ein Signal zum Aufstand.
Amin kümmerte sich darum wenig. Während sein Reich verloren ging, unternahm er mit Kewser eine dreimonatige Angeltour den Tigris entlang. "Das nennt ihr eine schlechte Nachricht?" fragte er die Boten, die ihm gerade zitternd den Verlust seiner Armee gemeldet hatten. "Seht mich erst an - Kewser hat schon zwei Fische gefangen und ich noch keinen einzigen!!!"
Das sprach sich herum, und die türkischen Söldner fanden, mit einem solchen Kalifen könne man getrost neue Politik betreiben. Mit schöner Regelmäßigkeit trat nun Amins Armee jeden Monat in Streik. Erst wenn der Kalif Solderhöhungen von mindestens 15 Prozent bewilligt hatte, wurde wieder zwei Wochen lang so getan, als würde gekämpft. Im Juli 812 erhielt bereits ein einfacher Reiter soviel Gehalt, wie unter Harun al-Raschid ein Staatssekretär; die einst so gut gefüllten Staatskassen leerten sich immer schneller.
Mamuns Armee hatte einen pfiffigen General. Sein Spitzname war "der mit den zwei rechten Händen", aber seine Geschicktheit bestand letztlich darin, keine zu rühren. Sobald sich Amin einer neuen Erpressung seiner Armee gefügt hatte, der Krieg also wieder hätte beginnen können, zog sich General Tahir zurück. Herrschte dann im Lager Amins wieder einmal Streik, besetzte Tahir völlig widerstandslos die nächste Provinz.
Am 1. September 812 erreichte Mamuns Armee auf diese Weise Bagdad, und nun wurde es für Amin blutiger Ernst. Er ließ Bagdad zur Festung erklären, und als seine Schatzkammern geleert waren, erlaubte er seinen Truppen auch, die Stadt zu plündern. Auf diese Weise hielten ihm seine türkischen Söldner noch ein ganzes Jahr die Treue. Bagdad aber wurde schlimm verwüstet.
* Korrekter weise spricht man von "Türken" erst seit 1326, vom Zeitpunkt der osmanischen Reichsgründung an. Bis dahin hießen die in den Vorderen Orient Eingewanderten "Türk - Stämme". Der Einfachheit halber und das Stirnrunzeln aller Historiker in Kauf nehmend, habe ich mich für die Bezeichnung "Türken" entschieden, möchte aber darauf verweisen, dass jene Türken nur sehr mittelbare Vorfahren unserer heutigen Türken sind.
Mamuns Armee nahm zuerst die Vororte unter Dauerbeschuss. Die prunkvollen Paläste Haruns und der Bermekiden sanken in Schutt und Asche; zahllose Fabriken und Manufakturen gingen in Flammen auf. Im März hatten sich die Belagerer bereits bis zur Innenstadt durchgekämpft. Nun bissen sie sich an Mansurs Ringmauern die Zähne aus.
Amin zog sich mit seinen Türken in Mansurs runden Palast zurück. Das gewaltige Gemäuer hatte Haruns Komfortansprüchen schon lange nicht mehr genügt, und so ,war jahrzehntelang nur noch die Thronhalle benützt worden. Die anderen Räume waren ausgeräumt und so ungemütlich, dass die türkischen Söldner wieder einmal zu streiken beschlossen, diesmal für Rosshaarmatratzen. Die konnte ihnen Amin natürlich bei bestem Willen nicht beschaffen, und so musste er den Soldaten freien Eintritt in einen gut versteckten Keller gewähren. Dort lagen aus Mansurs Zeit noch etwa 300 Kilogramm Gold, die eiserne Reserve des Kalifen. Als sich die Türken bedient hatten, verbeugte sich ihr Kommandant vor dem Kalifen: "Da Eure Herrlichkeit nun ja leider nicht mehr in der Lage sind, uns weiter angemessen zu bezahlen, werden Eure Herrlichkeit ja nichts dagegen haben, wenn wir uns untertänigst aus dem Staube machen."
Eine Stunde später waren Amin, Sobeida, das Baby, der geliebte Eunuch Kewser und einige Harems Sklavinnen allein in der Festung. Die Belagerer konnten bereits raue Scherze zu dem verzweifelten Haufen über den Tigris-Kanal brüllen.
Eine Flasche Wein und eine Sängerin waren dem Kalifen geblieben, und in einem Anfall von Galgenhumor wollte Amin noch ein allerletztes Fest veranstalten. Der Wein war gut, doch das Programm der Dame missfiel dem Beherrscher der Gläubigen sie war von Harun als Spezialistin für Trauergesänge gekauft worden und konnte beim besten Willen nur klagen, klagen, klagen. Wütend warf Amin die halbvolle Flasche nach ihr, und die Belagerer lachten dröhnend.
In derselben Nacht versuchte der Kalif, mit einem Boot zu fliehen. Natürlich wurde er aus dem Wasser gefischt. Als der Beherrscher der Gläubigen in ein halbzerstörtes Haus der Vorstadt Karch gebracht wurde, klammerte er sich verzweifelt an ein Seidenkissen, das ihm noch verblieben war. Kurze Zeit später bekam er Gesellschaft: Kewser war im Tigris herum geschwommen, seinen Herrn zu suchen.
Amin entwarf ein Gnadengesuch an seinen Bruder. Kewser sollte es im Morgengrauen zu General Tahir bringen. Doch als er aufbrechen wollte, klammerte sich Amin an ihm fest: "Bleib bei mir, ich habe solche Angst."
Minuten später erklang Hufgetrappel auf der Strasse. Dann wurde die Tür aufgerissen, und mit blanken Schwertern stürzte eine Gruppe Perser in den Raum. Mit seinem Seidenkissen versuchte der Kalif, die tödlichen Hiebe abzuwehren.
Am Morgen des 25. September 813 wurde der kopflose Leichnam des Beherrschers der Gläubigen durch das schwer zerstörte Bagdad geschleift. Über das Schicksal Kewsers, Sobeidas und des Babys berichtet keine Chronik.
Damit war Mamun Kalif und Herr des Reichs, doch die Staatskasse war leer, viele Provinzen wurden durch Aufstände derart verunsichert, dass Karawanen nur unter starker militärischer Bedeckung passieren konnten, und Bagdad selbst war so verwüstet, dass die letzten zehn Jahre ein Jahrhundert zurückzuliegen schienen.
Amins Türken boten ihre Dienste natürlich auch bereitwillig dem neuen Kalifen an, selbstverständlich unter der Beibehaltung der letzten Soldhöhe, aber Mamun dachte gar nicht daran, sich auf derlei einzulassen. So machte sich Amins Armee selbständig und durchzog plündernd und marodierend das ganze Zweistromland, ziemlich ungehindert, denn auch Mamun konnte gegen die räuberischen Türken wiederum nur Türken ins Feld schicken.
Die nächsten sechs Jahre blieb der Kalif daher sicherheitshalber in Chorassan. Unter der Bevölkerung dort war er sehr beliebt, hatte er doch den lokalen Würdenträgern erfolgreich erzählen können, seine Mutter sei eine chorassanische Prinzessin gewesen. Die von seiner wirklichen Mama ererbte dunkle Farbe übertünchte er durch reichliche weiße Schminke, und sein Leben lang gerbte der Kalif seine Haut mit allen möglichen Weißmachern.
Von dieser kleinen Schwäche abgesehen, war Mamun durchaus ein fähiger Staatsmann und von einer für Abbasiden geradezu verblüffenden Konzilianz. Für die vom Bürgerkrieg am schlimmsten betroffenen Gebiete erließ er eine zehnjährige Steuersenkung
und erfand sogar eine staatliche Investitionsprämie, mit der natürlich auch schon die damaligen Unternehmer arg Schindluder trieben. Am bemerkenswertesten erschienen seine wiederholten Versöhnungsversuche mit dem Haus Ali und somit den Schiiten. Damit aber setzte sich der Kalif nur zwischen sämtliche Stühle. Die Schiiten, jahrzehnte-lang unter den Abbasiden praktisch Frei wild, misstrauten diesem friedfertigen Spross aus der Sippe ihrer Schlachter, und die übrigen Abbasiden wollten Mamun sogar stürzen, als er 819 doch nach Bagdad einzog und dabei den grünen Mantel der Schia trug und nicht den schwarzen des Hauses Abbas.
Nur seine türkische Leibgarde sicherte ihm den Thron, und die ganzen zweiundzwanzig Jahre seiner Regierung blieb die Frage offen, ob er die Türken beherrschte oder sie ihn. In den meisten Geschichtswerken wird Mamuns Herrschaft als letzte Glanzzeit der Abbasiden bezeichnet, doch wenn dem so war, handelte es sich höchstens um das Nachleuchten einer schon untergegangenen Sonne. Der Westen des Reichs hatte sich unabänderlich selbständig gemacht - bereits Harun al-Raschid hatte nicht verhindern können, dass im Jahr 800 Ibrahim Ben Aghlab aus der Statthalterschaft Afrika sein eigenes privates Königreich machte. 827 eroberten die Afrikaner auch Sizilien und führten von dort aus einen "Heiligen Seekrieg" gegen Konstantinopel, aber auch gegen ihre eigenen Glaubensgenossen im Nahen Osten. Mamun musste sich fügen, als der siegreiche General seines Bürgerkrieges, Tahir, aus Chorassan ein eigenes Sultanat machte, und bald kam "das fränkische Verhängnis", wie es Mamun nannte, auch über sein Reich: Seine Generale gaben sich nicht mehr mit Gold zufrieden, sondern wollten Land. Damit aber musste aus dem "Schatten Gottes auf Erden", wie der Kalif unter anderem hieß, tatsächlich ein Schatten werden.
Seine Ministerpräsidenten spielten dabei zweifellos eine verhängnisvolle Rolle. Der erste Großwesir war Schiit, und der Kalif der Sunna hoffte damit, einen genialen politischen Kompromiss geschlossen zu haben. Doch so einfach ging die Sache nicht ab unterstützt vom Großwesir brachen an allen Orten schiitische Aufstände aus, und wer schwarze Kleidung trug, wurde erschlagen. Daraufhin machten die Truppen des Kalifen Jagd auf jeden, der grüne Kleidung trug. Mamun und sein Wesir verstanden sich privat ganz gut, doch so verschiedene politische Ansichten waren nicht vereinbar.
So wurde der Wesir eines Tages im Bad erschlagen. Obwohl Mamun die Mörder sofort hinrichten ließ, wurde ihm die Schuld an dem Attentat gegeben schließlich hatten die Delinquenten noch auf dem Schafott behauptet, der Kalif persönlich hätte die Tat angeordnet.
Mamuns nächster Wesir Hasan war bereits ein General. Zu nächst ließ er sämtliche Aufstände niederschlagen, doch als die Ordnung hergestellt war, wurde Mamun zur Kasse gebeten.
Zum Anlass nahm Hasan die Hochzeit seiner Tochter mit dem Kalifen. Es wurde die Hochzeit des Jahrtausends.
Tausend Perlen wurden über der Braut ausgeschüttet, jede mindestens haselnussgroß. Und vor dem Kalifen brannte eine vierhundert Kilogramm schwere Kerze aus reiner Ambra. Dieser exklusive Duftstoff aus dem Gehirn des Pottwals kostet heute pro Gramm gute 200 Mark und war damals auch nicht billiger. Das ist ja Verschwendung, ächzte der Kalif, doch war diese Kerze noch Billig wahre, verglichen mit dem Glückstopf, um den sich nun Generäle und Offiziere der Armee beinahe prügelten. Der war aus reinem Gold, etwa einen Meter hoch und zwei Meter im Durchmesser. Darin lagen an die tausend Moschuskugeln, in feinstes Papier gewickelt. Schon zur Zeit des Kalifen war Moschus wesentlich kostbarer als Gold, doch das Einpackpapier war noch wertvoller: Auf jedem Blatt stand der Name einer Landschaft, vererbbarer Besitz für den glücklichen Gewinner. Die Hochzeit des Kalifen war der Ausverkauf des Reiches.
Über Nacht waren aus dem Weltreich 975 kleine Fürstentümer geworden. Vierzehn Großstädte und Bagdad waren nicht in der Lotterie - sie unterstanden weiterhin direkt dem Kalifen. Und von den anderen Ländereien hatte sich Mamun ausbedungen, ein Fünftel der Steuereinnahmen weiterhin abgeliefert zu bekommen. Vielleicht hielt Mamun den Glückstopf auch für eine glückliche Idee - zu den Teilnahmebedingungen gehörte, dass jeder Fürst selbst die Kosten für die Verteidigung tragen müsse und sich mit Truppenkontingenten an allgemeinen Feldzügen zu beteiligen habe. Doch damit war das Reich endgültig zerfallen. 782 der neuen Emire waren Türken, nur fünfundzwanzig davon Araber und einer von denen ein Kameltreiber, der zufällig und angeblich irrtümlich zugelangt hatte.
Mamun konnte sich von nun an ziemlich unbehelligt seinen Hobbys widmen, vor allem der Wissenschaft und der Astrologie.
Hier geruhte der Kalif, wahrlich Bedeutendes leisten zu lassen.
Die heute noch gültigen Mathematikformeln wurden an seinem Hof errechnet, und das Wort Algebra ist bekanntlich arabisch.
Mamuns Festungsarchitekten erfanden die Zinnen und Pechnasen, die natürlich begeistert von den Baumeistern abendländischer Burgen übernommen wurden. Das bedeutendste Bauwerk aber war ein schlichter Ziegelkomplex von riesigen Ausmaßen, errichtet zu Bagdad am Tigrisufer gegenüber dem alten Palast Mansurs. Es hieß "Haus des Wissens" und war die erste Universität der Welt.
Die Erfindung der Universität lag gewissermaßen in der Luft. Schon die griechischen Gelehrten der Antike gaben ihr Wissen in Öffentlichen Hallen jedem zum besten, der ihnen zuhören wollte, und die Römer verpflanzten diese "Akademie" in ihre Öffentlichen Badeanstalten. Mohammed hatte ausdrücklich bestimmt, dass die Moscheen jederzeit Gelehrten als Vortragshallen zur Verfügung stehen sollten, und dabei entwickelten sich die Gotteshäuser allmählich auch zu den ersten Öffentlichen Bücherhallen. Doch in dieses mehr oder minder zufällige System der Wissensvermittlung Organisation zu bringen, blieb Mamun vorbehalten. 829, sieben Jahre nach der Gründung, verfügte die Universität Bagdad bereits über zweihundert festangestellte Professoren, rund zehntausend Studenten und eine Bibliothek von einer halben Million Bänden. Für künftige Staatsangestellte waren als Fakultäten Jura, Wirtschaftswissenschaften und sogar schon Soziologie geschaffen; Ärzte wurden in 12 Universitätskliniken nach den Fachrichtungen Innere Medizin, Chirurgie, Zahnmedizin und Pharmazie ausgebildet; Mathematik, Philosophie, Chemie galten seltsamerweise als Tochterfakultät der Theologie, und im "Turm der Ehre" residierten die ersten wissenschaftlich ausgebildeten Historiker der Geschichte, allerdings gemeinsam mit den Dichtem. Mamuns Auftrag an die Geschichtswissenschaftler lautete, einmal ernsthaft zu überprüfen, ob sich nicht im Lauf der Weltgeschichte alles wiederhole und Dummheit ganz besonders. Die Gelehrten Arabiens kamen zu der Ansicht, Geschichte sei tatsächlich nur eine manchmal spannende, manchmal zur Verzweiflung bringende Wiederholung von Wiederholungen stets der im Grunde selben Prozesse. Poetisch, wenn auch nicht respektvoll, formulierte Masudi, einer der Väter orientalischer Geschichtsschreibung: Nur die Flaschen wechseln. Die Essenz bleibt leider meist dieselbe.
Die Historiker der abendländischen Tradition haben sich darauf geeinigt, dass Wiederholungen in der Menschheitsgeschichte höchstens äußerlich und zufällig seien. Einen Kernsatz des alten Masudi aber zitieren auch Sie gerne: "Aus der Geschichte können wir lernen, dass die Menschen noch nie aus der Geschichte gelernt haben."
Wie Kalif Mamun darüber dachte, ist nicht bekannt. Am liebsten soll der Beherrscher der Gläubigen Geschichten über das alte Rom gelesen haben, vorzugsweise über die sogenannten Soldatenkaiser, jene seltsamen Imperatoren, die in Wahrheit nur hilflose Marionetten ihrer Prätorianerleibgarde waren. Der Schatten Gottes auf Erden kannte diese Probleme: In seiner eigenen Armee dienten rund 40.000 Gastarbeiter, und die wollten beschäftigt sein. Mamun hatte sich zwar vorgenommen, als Friedenskalif zu regieren, und kümmerte sich daher auch nicht sonderlich um die ständigen lokalen Rebellionen, doch seiner Armee behagte das Programm nicht. Ganze Truppenverbände betätigten sich in ihrer Freizeit als Räuberbanden, und so nahm Mamun 830 wieder den ewigen Krieg gegen Konstantinopel auf.
Die neuen Feldzüge waren hauptsächlich als Beschäftigungstherapie für die Armee gedacht. Obwohl Mamun wiederholt entscheidende Siege errang, hütete er sich, dem byzantinischen Reich den Todesstoss zu geben - Wogegen sollen die Leute denn dann marschieren, seufzte der Kalif, als ihm seine Logistiker eine versäumte Chance zur Eroberung Konstantinopels vorrechneten. Wenn sie nicht mehr die Ungläubigen zu Feinden haben, werden sie den Krieg gegen mich beginnen. Tatsächlich war der Kalif gerade im Schutz seiner Türkenleibgarde nicht mehr sicher. Als Mamun am 9. August 833 ganz plötzlich nach dem Genuss einiger Feigen verstarb, wusste niemand, ob nicht vielleicht ein Giftmord geschehen sei - zwar hatte der Kalif in seinem eigenen Reich mehr Freunde als Feinde, doch zählte vergiftetes Obst zum ältesten Inventar orientalischer Kriminalität. Und Mamun war der letzte, der mit seiner selbstherrlichen Leibgarde noch einigermaßen fertig wurde.
Sein Bruder Mutasim, der Kalifat und Türken erbte, konnte sich gegen seine Beschützer bereits nicht mehr durchsetzen.
Bagdad erlebte bald wieder schlimme Zeiten. Die Garde des Kalifen hauste in der Stadt, als befände sie sich in Feindesland. Wer ihren Pferden mit den goldenen Zaumzeugen nicht sofort aus dem Weg sprang, wurde niedergeritten, und wer in seinem Laden allzu schöne Dinge hatte, musste damit rechnen, dass sich die Söldner ohne Bezahlung selbst bedienten. Die Bürger Bagdads ließen sich das natürlich auch nicht gefallen. Bald bildete jede Vorortstrasse eine eigene Bürgerwehr, die jeden Türken auf der Stelle erschlug.
Mutasim war so ziemlich das Gegenteil seines Bruders. Für Wissenschaft hatte er absolut nichts übrig und konnte sogar und das war im arabischen Raum seit Mohammed ein beinahe einmaliger Fall - nur mangelhaft lesen und schreiben. Daher nahm er seinen Türken nicht übel, als sie eines Tages mit ihren Pferden in die Universität sprengten und ausgerechnet in der Bibliothek ein Polospiel veranstalteten. Die Professoren und Studenten aber gingen gemeinsam auf die Barrikaden, und bei diesen ersten Studentenunruhen der Geschichte wurde der Kalif eine Woche lang in seinem Palast belagert, ohne dass auch die Leibgarde dagegen etwas unternehmen konnte.
Schließlich ließ der Kalif eine gemischte Delegation aus Studenten, Bürgern und Professoren kommen. Die aber überbrachte ihm nur ein Ultimatum. Der Kalif solle seine Türken ent- oder samt ihnen die Stadt verlassen. Sonst gäbe es Krieg.
Belustigt fragte der Beherrscher der Gläubigen: "Aber mit welchen Waffen wollt ihr denn überhaupt kämpfen?" Da rief ein Student der Theologie: "Mit unseren Fingern, die wir nachts zum Gebet erheben, um Gottes Hilfe gegen dich zu erflehen, du Hund." Ungestraft verließ die Delegation den Palast. Kurz darauf verließ Kalif Mutasim samt seiner Türkengarde Bagdad. Rund hundertzehn Kilometer Tigris aufwärts ließ der Sohn Haruns eine neue Residenzstadt errichten. Sie hieß Samarra, arabisch Sermenrei, es freut sich, wer das sieht, und gilt als bedeutendste städtebauliche Schöpfung des Islam. Sie wurde in einem atemberaubenden Tempo errichtet: 836 war Grundsteinlegung, und sechs Jahre später zog sich Samarra bereits dreißig Kilometer den Tigris lang. Mittelpunkt der Stadt war natürlich der Palast des Kalifen. Er stand auf einem künstlichen Hügel von drei Kilometern Länge, 700 Metern Breite und 20 Metern Höhe.
30.000 Pferde hatten die Erde dazu herbei geschleppt. Von dem Märchenpalast, der sich darüber erhob, ist nur noch ein Torbogen erhalten, doch der ist gute fünfzehn Meter hoch.
Samarra war die Stadt der Superlative. 150 Kilometer Asphaltstrassen bildeten einen schnurgeraden Raster, in dessen Gevierten an die hunderttausend Menschen wohnten. 400 Kilometer Wasserleitung versorgten die zahllosen Brunnen, 700 Badeanstalten, 500 Poloplätze, 628 Nachtlokale und eine Bibliothek garantierten den hohen Freizeitwert der neuen Stadt. Die Freitagsmoschee, von Mutasims Sohn Mutawakkil errichtet, ist das größte Gemäuer des Islam der Innenhof misst 180 X 260 m und bot ausreichend Platz für 100.000 Gläubige. Die Außenmauern stehen heute noch, und ihre ungeheuren Türme beweisen, dass hier Militärarchitekten zugeschlagen haben.
Samarras Glanzzeit währte nur kurz, etwa sechzig Jahre. Von da an wurde die glanzvolle Stadt nur noch als Steinbruch benützt. So blieben nur wenige Mauertrümmer von diesem größten Luxusgefängnis aller Zeiten. Denn Samarra war vor allem der Käfig des Kalifen. Außer ihm wohnten hier nur die türkischen Gardisten und ihre umfänglichen Familien. Der Kommandant der Leibgarde nannte sich stolz Emirol-Umera, Fürst aller Fürsten, und das war er auch im Reich des Kalifen. Er ernannte den Großwesir und die Minister, und Verordnungen trugen sein Siegel neben dem des Kalifen.
Der wahre Herrscher hieß nun Bugha Asch-Scharabi und hatte als Kammerdiener angefangen. Sein Geburtsdatum wusste er nicht, nur, dass er in Nomadenzelten zwischen Schafen aufgewachsen war, jenseits der Zivilisation und des Oxus, dem alten Grenzfluss zwischen Nahem Osten und Zentralasien. Er behauptete stets, als freier Mann nach Bagdad gekommen zu sein, war jedoch mit ziemlicher Sicherheit nicht als Söldner geworben, sondern höchstwahrscheinlich schon im Jungenalter als Sklave gekauft worden. Mutasim dürfte ziemlich in ihn vernarrt gewesen sein und machte ihn schließlich zu seinem ersten Kammerdiener. Wann der Butler zum Kommandanten der Garde wurde, ist unbekannt und auch nicht, warum. Seine erste Amtshandlung jedenfalls war, sämtliche Söhne Kalif Mamuns einzufangen und im Gefängnis verhungern zu lassen.
Im Koran waren Diktaturen allerdings nicht vorgesehen, und schon unter den ersten Kalifen hatte sich eine kritische Instanz gegen die Pragmatik der Macht entwickelt, die Ulema.
Das Abendland kennt nichts Vergleichbares, denn die Kirche Christi hat sich nie als kritischer Gegenpart der weltlichen Macht verstanden, und so erscheint uns die Institution der Ulema als geradezu paradox: Die Ulema sollte die Rechte der Gläubigen im Namen des Koran vor den Nachfolgern der Propheten schützen. Justiz also als Kritik an Gesetzen, die Rechts- und Religionsgelehrten als Kritiker der Richter. Die Richter hießen Kadis, die Rechtsgelehrten aber Mullahs.
Schon früher hatte es häufig Streit gegeben zwischen den Kalifen und den Mullahs, und bei den daraufhin ausgehandelten Kompromissen hatten sich die Vertreter der Ulema häufiger durchgesetzt als der Beherrscher der Gläubigen. Selbst Mansur, der uneingeschränkteste Autokrat auf dem Kalifenthron, hatte überraschend oft den kürzeren gezogen. Dass nun mit Bugha ein ungebildeter Militär die Staatsführung bestimmen wollte, musste die Ulema herausfordern. In den Moscheen der Großstädte sammelten die Mullahs Unterschriften zur Absetzung des allmächtigen Gardekommandanten, und allen Ernstes sollte gegen Bugha das erste Volksbegehren in der Geschichte des Islam gestartet werden.
So wollte sich Bugha natürlich gar nicht erst kommen lassen. Er steckte etwa ein Drittel seiner Soldaten in Zivilkleidung, und Anfang Januar ereigneten sich in sämtlichen persischen Städten dieselben Schreckensszenen: Welcher Mullah auch immer gegen Bugha sprach - jeweils sechs Zivilisten stürzten sich auf ihn und erdolchten ihn vor den entsetzten Gläubigen. Und die Polizei hielt sich jedes mal erstaunlich zurück. Nun begriffen auch die letzten Muslims, dass Allahs Reich auf Erden eine handfeste Militärdiktatur geworden war.
Zur selben Zeit, am 5. Januar 842, starb auch Kalif Mutasim, und Zahlenmystiker werden seitdem nicht müde, die seltsame Bedeutung der 8 im kläglichen Leben des Herrschers zu erwähnen: Er war der 8. Kalif aus der Sippe Abbas, nach islamischer Zeitrechnung geboren im 8. Monat des Jahres 180 und verstorben an einem 18., regierte 8 Jahre, 8 Monate und 8 Tage, war 48 Jahre alt, soll 8 Söhne und 8 Töchter gezeugt, 8 Schlachten geschlagen, 8 Städte erobert und in seiner Privatschatulle 88.000 Goldstücke hinterlassen haben.
Über seinen Sohn und Nachfolger Watik ist nicht einmal so etwas zu berichten, und als 847 sein Bruder Mutawakkil Kalif wurde, erregte dieses Ereignis nur deshalb Aufmerksamkeit, weil sich Bugha aus gegebenem Anlass einen neuen Titel zulegte: Sultan. Zur selben Zeit erhielten die Offiziere der Leibgarde, die nun auch ganz offiziell die Regierung bildeten, eine neue Kopfbedeckung. Unter den Muslims löste das Kleidungsstück zunächst lautes Gelächter aus. Spötter meinten nun sieht man schon am Hut, dass Allahs Blitz die Schädel spalten soll, denn das Ding war eine hohe, zwei spitzige Mütze. Allerdings hatte das Unding eine gewisse Tradition - vor langer, langer Zeit hatte es den persischen Königen als Krone gedient. Die Muslims stopften es daraufhin als Zeichen vermessenen Machtanspruchs in die Mottenkiste, aus der es Bugha wieder ausgrub und zu neuen Ehren erhob. Im Islam wurde die zwei spitzige Kappe daher nie gern gesehen. Das Christentum jedoch kopierte diese Mode wie alles, was aus dem Nahen Osten kam. Der Papst beispielsweise war von dem Machtsymbol so beeindruckt, dass er sofort die Mitra als Kopfbedeckung für seine Bischöfe verordnete, und in deren Gebrauch blieb sie bis heute unverändert, wenn auch seit einigen Jahrhunderten um einen Winkel von neunzig Grad gedreht. Auch weltliche Herrscher kombinierten gerne ihre Kronen mit einer Mitra - die Krone des Heiligen Römischen Reiches enthielt eine aus Samt, und die österreichische Kaiserkrone schließlich ist eine veritable Mitra aus Gold. Wirklich volkstümlich aber wurde die Mitra auf ganz anderen Köpfen: als Narrenkappe Till Eulenspiegels und anderer Querschädel.
Mit Bugha allerdings, dem ersten Mitraträger, war nicht zu spaßen, und das musste vor allem Kalif Mutawakkil erfahren. Nachdem er vierzehn Jahre im Schatten seines allmächtigen Beschützers folgsam leben durfte, scheint der Kalif den Plan gefasst zu haben, die Regierungsgeschäfte selbst zu übernehmen. So jedenfalls wurde die Sache Bugha von seinem Geheimdienst berichtet. Vielleicht war auch alles ganz anders - in Samarra waren Kalif und Leibgarde ganz unter sich, und daher wird es nie möglich sein, über das Intrigengewirr jener Zeit einen objektiven Überblick zu bekommen.
Auf jeden Fall hatten Bugha und sein Kalif am Abend des 10. Dezember 861 einiges über den Durst getrunken. Plötzlich stürzten fünf Türken mit gezogenen Schwertern in den Raum.
"Was soll denn das?" fragte der Kalif seinen Sultan, und war offensichtlich schon zu betrunken, um zu erschrecken.
Diese Ruhe brachte auch Bugha aus der Fassung. Während die Söldner ratlos herumstanden und ihre Schwerter wieder in die Scheide steckten, stotterte Bugha: "Das sind jene Männer, die deine Nachtruhe behüten sollen, o Beherrscher der Gläubigen. Dann sollen sie wieder hinausgehen und uns in Ruhe lassen", entschied Mutawakkil und ließ sich ein neues Glas geben.
Folgsam trollten sich die Mörder, und Bugha brauchte eine Weile, bis er seine Fassung wiedergewonnen hatte. Dann aber ging er auf den Korridor und sprach mit seinen Türken ein ernstes Wort. Gemeinsam kamen die sechs wieder in das Gemach des Kalifen.
"Was soll denn das schon wieder"? fragte Mutawakkil.
Da schlug der erste mit dem Schwert nach dem Kalifen. Er hieb dem Beherrscher der Gläubigen aber nur ein Ohr ab.
Grosse Verlegenheitspause bei allen Beteiligten. Mutawakkil fasste sich an den Kopf, nahm sein Ohr ab, besah es eingehend und wusste immer noch nicht, was das alles zu bedeuten habe. Aber auch die Attentäter wussten nicht weiter. Einer von ihnen gab dem, der den ersten Streich geführt hatte, gute Ratschläge: "Wenn du richtig zuschlagen willst, darfst du nichts übereilen, Mann. Man muss genau zielen, Mann, sonst hat es gar keinen Sinn." Da mischte sich der anwesende Butler ein: "Aber meine Herren, ich bitte euch zu bedenken, dass ihr euch vor dem Beherrscher der Gläubigen befindet. Halts Maul, brüllte da Bugha und stieß ihm ein Schwert in den Bauch."
Damit war der Bann gebrochen, und einige Sekunden später lag der Kalif erschlagen neben seinem Weinglas. Bugha aber irrte mit seinen Totschlägern durch den weiten Palast und suchte einen Sohn Mutawakkils. Aus Sicherheitsgründen schliefen die Prinzen jede Nacht in einem anderen Raum des Riesengemäuers, und anscheinend hatte Bugha seinen Putsch so wenig geplant, dass er nicht einmal wusste, wer gerade wo schlief.
Nach langem Umherirren sah Bugha am Ende eines Korridors gerade eine schattenhafte Gestalt in einem stillen Örtchen verschwinden. Seine Killer rannten klirrend los, und die Gestalt ergriff die Flucht. Nach einer wilden Verfolgungsjagd durch den halben Palast wurde sie schließlich ergriffen und vor Bugha geschleift. Zufällig war die Jammergestalt ein Prinz.
Er zitterte am ganzen Körper, doch Bugha beruhigte ihn : Wir tun dir schon nichts, Beherrscher der Gläubigen. Der Zufallstreffer dürfte jedoch nicht ganz Bughas Geschmack gewesen sein, denn schon nach sechs Wochen verschied auch dieser Kalif unter ungeklärten Umständen. Von nun an setzte Bugha und später seine Erben zum Kalif ein, wer immer ihm passte, und manchmal wechselten die Beherrscher der Gläubigen dreimal jährlich.
Das Weltreich des Islam hatte schon lange vor dem Kalifen den Todesstoss erhalten. Mitte des neunten Jahrhunderts bestand es
aus einer Unzahl kleinerer Fürstentümer im Schatten einiger größerer. Mit denen aber konnte es immer noch keine Macht Chinas oder Europas aufnehmen.
Den Fernen Osten bildete ein Konglomerat islamischer Fürstentümer in Nordindien, unter denen bald das Sultanat von Delhi übermächtig wurde. Im persischen und irakischen Raum bestimmten Bughas Erben, die Bujiden, zumindest die Außenpolitik der aus Mamuns Glückstopf entstandenen Kleinstaaten. Im Jemen hatte sich ein neues Königreich unter Führung einer altbekannten Sippe gebildet: Die Nachkommen Sejads, des einstigen Schlächters von Kufa, hatten in Südarabien ein eigenes kleines Imperium errichtet. In Zentralarabien herrschten wie vor Mohammeds Zeiten die untereinander verfeindeten Beduinenclans. In Syrien und Palästina gab es ebenso viele Fürstentümer wie Städte, ständige Zankäpfel zwischen Samarra und Ägypten, der dritten Großmacht.
Am oberen Ende des Nildelta war neben Fostat eine neue Stadt namens Kairo entstanden, und dort residierten nun die Aghlabiden. An die Macht gekommen waren sie wie im Märchen, und darauf Waren sie ebenso stolz wie Millionäre aus der späteren Märchenzeit des Kapitals, zu deren Lebensweg ja auch das Tellerwaschen unentbehrlich scheint. Aghlab war aus einer unbekannten Grenzprovinz Indiens als Sklave in die Hofküche des Kalifen gekommen. Sein Sohn Ibrahim begann dort selbst ebenfalls als Tellerwäscher. Da die Teller des Kalifen aus Gold waren, konnte man dies schon als Vertrauensposten bezeichnen. Nach kurzer Dienstzeit wurde er als Steuerkassier nach Ägypten geschickt, und das war ein höherer Vertrauensposten.
Etwa ein Achtel der Steuern verschwand in seinem eigenen Kaftan. Das war nichts Ungewöhnliches, und die Geschichte verschweigt Tausende von Steuereintreibern, die sich auf veruntreutem Geld zur Ruhe setzten. Ibrahim aber setzte sich nicht zur Ruhe, Sondern investierte in eine kleine Privatarmee, und als der Statthalter in die Bücher des Steuereinnehmers einmal Einsicht nehmen wollte, sah er sich plötzlich von Schwerbewaffneten umstellt.
Der Beamte war kein Held. Widerstandslos räumte er seinen Stuhl, auf dem nun Ibrahim Ben Aghlab Platz nahm, und Harun al-Raschid konnte nur noch Ja und Amen dazu sagen.
Die Aghlabiden waren eine ehrgeizige Familie und hatten keines falls vor, sich mit Ägypten zufriedenzugeben. 827 eroberte ein Sohn des ungetreuen Steuereintreibers Sizilien, und kurz darauf erging an den Papst ein Brief des Inhalts, dass sich ab sofort die Familie Aghlab in Europafragen als Rechtsnachfolger des Kalifen betrachte. Postwendend folgte ein Schreiben des Papstes, dass er die Sache erst mit seinen Rechtsberatern klären müsse. Das Problem war tatsächlich knifflig. Das Oberhaupt der Christenheit stand beim Islam tief in der Kreide. Insgesamt mit etwa zwei Milliarden Mark, ohne Zinsen. Seit Mansurs Zeiten hatte der Papst seine Politik stets vom Kalifen finanzieren lassen. Noch Harun al-Raschid hatte gut zwanzig Millionen in bar bezahlt, nur damit der Papst unter den Christen Konstantinopels Unfrieden stifte, und keine der Parteien betrachtete diese Zahlungen eigentlich als Darlehen - Bagdad ertrank ja fast in Geld, und woher hätte der Papst die ungeheuren Beträge zurückzahlen sollen? Zwar herrschte nun auch in der Staatskasse des Kalifen Ebbe, doch konnten die Kalifen nicht einmal ein Mahnschreiben aufsetzen, und zu einer nachdrücklichen Außenpolitik fehlte ihnen erst recht Zeit und innenpolitische Ruhe. Dass sich nun ausgerechnet die Sippe Aghlab meldete und überdies auch den genauen Betrag kannte, war da schon ausgesprochen peinlich.
Des Papstes Juristen klärten bis Sommer 833. Dann ging ein kühles Schreiben nach Ägypten: Als einzigen Verhandlungspartner akzeptiere Seine Heiligkeit den Filialleiter der arabischen Staatsbank in Rom. Der aber harrte schon seit einigen Jahren vergeblich auf Weisungen aus Bagdad.
Jahrelang wurden Rechtsgutachten zwischen Kairo und Rom gewechselt.
Dann starb 842 Kalif Mutasim, und der Papst benützte die Todesnachricht zu einem anscheinend genialen Streich: Über Nacht verwandelte er die islamische Bankniederlassung in sein eigenes privates Geldinstitut und nannte es "Bank des Heiligen Geistes", denn der hatte ihm angeblich die Idee zugeflüstert.
In Ägypten wurde dies als Frechheit aufgefasst. 843 ließ die Familie Aghlab als ersten Warnschuss Messina besetzen. Doch der Papst schien nicht zu verstehen, und sowohl in den Mahnbriefen als auch seinen Antwortschreiben wurde der Ton zusehends schärfer. Der Papst glaubte, sich das erlauben zu können. Emir von Ägypten und Nordafrika war gerade ein sehr trinkfreudiger Fürst namens Mohammed, mit dem Rom ein leichtes Spiel zu haben glaubte. Aus dem Jahr 845 ist ein neckisches Schreiben des Papstes erhalten: Seine Heiligkeit sei leider völlig bargeldlos, so sehr, dass selbst Christus darüber Tränen vergossen habe, von denen einige in die beiliegenden Flaschen abgefüllt seien, und ob sich nicht der Emir damit vorläufig zu trösten geruhe... Der beiliegende Wein heißt noch heute "Lacrimae Christi" und muss schon damals ein besonders süßes Getränk gewesen sein, doch Mohammed war sauer. Im August besetzte seine Flotte vorübergehend Ostia, und vier Divisionen Araber erschienen vor den Mauern Roms.
Der Papst wurde deshalb nicht Zahlungswilliger. Im Gegenteil: Nun erklärte er, die strittigen Beträge seien Tribute des Kalifen an das Oberhaupt der Christenheit gewesen. Der Kommandant der Araber weigerte sich, dieses Schreiben auch nur in Empfang zu nehmen. In mustergültiger Ordnung rückten die Truppen am nächsten Morgen in der Ewigen Stadt ein. Keinem römischen Bürger wurde auch nur ein Haar gekrümmt, und aus den Läden der Stadt verschwand kein einziges Stück. Sämtliche Kirchen aber wurden ausgeräumt, aus den Wänden der Peterskirche sogar die goldenen Mosaiksteinchen gelöst, und Petri Schatzkammer samt der Banco de Santu Spirito bis auf den letzten Heller geleert.
Damit war der Papst wieder einmal so arm geworden, wie es die Kirche nach Christi Willen stets hätte sein sollen, und die Aghlabiden beschäftigten sich fortan damit, andere Schulden einzutreiben. In ähnlichen Pfändungsaktionen zogen sie in das Frankenland und räumten zwischen 842 und 850 die Steuerkassen Südfrankreichs aus. 890 schließlich besetzten ägyptische Truppen die französische Riviera, und dort blieben sie bis zum Jahr 973.
Doch auch die Aghlabiden hatten ihre Steuereintreiber. Einer von ihnen hieß Tulun, und so regierten in Ägypten und Nordafrika seit 868 die Tuluniden.
Sooft die Menschheit zeigen wollte, wie weit sie's gebracht hat, baute sie einen Turm. Das fängt beim Kind mit dem Baukasten an, in der Bibel mit Babel und reicht bis zu unseren Wolkenkratzern und Fernsehtürmen. Über das Motiv haben Philosophen und Psychologen so heftig gegrübelt, dass sie damit ganze Bibliotheken füllten, und doch fanden sie kein anderes als die Babylonier der Bibel, die bis zu den Wolken bauen wollten, um den Göttern zu zeigen, dass sie fast so gut seien. In Babel ging die Sache schlimm aus, aber dafür wissen wir aus den Rekonstruktionsversuchen der Archäologen, dass der babylonische Turm auch gar keiner war, sondern nur eine bessere Pyramide.
Griechen und Römer hielten nicht viel von Türmen als Zeichen der Herrlichkeit. Ihre Machtsymbole waren körperlicher Art der Koloss von Rhodos, die große Statue Neros, die dem benachbarten Stadion zu Rom den Namen Kolosseum eintrug, die Monster - Statuen des Phidias aus Gold und Elfenbein. Nur ein riesiger Turm der Antike wurde bekannt und zu den Weltwundern gezählt. Er stand bezeichnender Weise in Ägypten, und nach den erhaltenen Beschreibungen scheint der Leuchtturm von Alexandria tatsächlich ein Wolkenkratzer gewesen zu sein. Schule jedoch machte er nicht. Die Türme der Antike waren handfeste Gebrauchsgegenstände, Festungswerke und nur genauso hoch, wie es der militärische Bedarf erforderte. Auch die Chinesen haben es nicht anders gehalten, und ihre Türme waren nie etwas anderes als gut angelegte Bastionen.
Der Turm als Symbol menschlicher Errungenschaften ist eine Erfindung des Islam. Vielleicht konnte die absonderliche Idee nur in den Weiten der Wüste geboren werden, einen riesenhaften Phallus in die Landschaft zu setzen, um der Nachwelt zu zeigen, dass man hier gewesen. Natürlich passt dieser aufgetürmte Größenwahn nicht zum religiösen Gebot menschlicher Bescheidenheit vor Gott, und so fanden schon die ersten Turmbauer der Muslims einen fadenscheinigen Vorwand für ihre Leidenschaft.
Seit Mohammed war es üblich, dass der Muezzin vor der Moschee den Beginn von Gottesdiensten lauthals verkündete, und bereits der allererste des Islam hatte dazu eine Leiter benützt. Lag da nicht die Idee nahe, ihn turmhoch über die Dächer der Dörfer zu erheben, auf dass die Stimme des Gottesmannes um so weiter erschalle?
Dieser ganz praktische Zweck war natürlich nicht der wahre, denn bald türmte sich der Minar, wie das arabische Wort für Turm heißt, so hoch, dass die Stimme des Muezzin kaum mehr die Irdischen erreichen konnte, auch nicht mit riesigen Sprechtüten, die eigens zu diesem Zweck erfunden wurden. Schon zu Zeiten Harun al-Raschids war es daher üblich, neben den Minars noch Minaretts zu bauen, Türmchen, von denen aus das Wort Gottes noch der Erde verständlich blieb.
Auch die frömmsten Minars waren von Anfang an reine und sonst sinn- und zwecklose Denkmäler menschlicher Macht und menschlichen Erfindergeistes, phallische Monumente der Potenz von Machthabern und Architekten. Weithin sichtbar ragten die Symbole aus der Landschaft, Lockzeichen für den Wandersmann, dass in ihrem Schatten Herrliches zu erwarten sei.
Um 850 begann das Turmfieber in der islamischen Welt. Die berühmte Himmelsschraube von Samarra zählt zu den ersten dieser. Absonderlichen Bauwerke. Als Minarett zum Ausrufen der Gebete war der Turm von Anfang an untauglich. Ich habe es selbst einmal ausprobiert so sehr ich auch brüllte, meine Freunde unten in der Wüste verstanden kein einziges Wort und hörten kaum einen Laut. Doch die Aussicht ist überwältigend. Es ist schon schwer dort oben, nicht schwindlig zu werden vor Größenwahn. Die Welt schien mir zu Füssen zu liegen wie einst den Kalifen, die sonst schon nichts mehr zu bestellen hatten, und ich kam nach vielen tiefen Atemzügen ganz klein und etwas blass unten an. Die Spirale von Samarra bietet ein Turmerlebnis eigener Art.
Ihre Treppen liegen offen, und so ähnelt ihre Besteigung einer Bergtour. Dieses Prinzip scheint Jahrtausende alt zu sein und direkt von den Stufenpyramiden der Babylonier abgeleitet. Schon wenige Jahre später kombinierten die Architekten das Turmerlebnis mit Überraschungseffekten. Der Aufstieg fand im Inneren statt, und nachdem der Kletterer sich mühsam über zahllose Stufen in halbdunklen und beängstigend engen Gewölben hochgekeucht hat, öffnet sich plötzlich eine Luke zu einer Terrasse mit überwältigendem Ausblick.
Eine alte Geschichte illustriert die Absicht: Einst führte ein Emir von Sevilla einen Bischof auf den Turm der Moschee. Er steht heute noch und ist schlicht grandios. Auch die Wolkenkratzer-Versuche des neuen Spanien können mit ihm nicht konkurrieren. Für das Mittelalter aber muss er ein schieres Wunderwerk gewesen sein. Für den Bischof war die Besteigung etwas mühselig - etwa im letzten Stockwerk wurden ihm die Augen verbunden, und die Eminenz musste sich stolpernd hochtasten.
Erst auf der Terrasse des Daches wurde die Seidenbinde abgenommen, und während der Gottesmann noch nach Luft schnappte, fragte der Muslim: "Na? Gib doch zu, dass Allah herrlicher ist als das, was ihr für Gott haltet."
Der Gottesmann gab nicht zu, doch das Christentum übernahm die Türme begeistert. Bald wurden sie selbstverständliches Utensil der Gotteshäuser, und die frühesten zeigen deutlich, dass hier der Islam kopiert wurde. Und als das Bürgertum zeigen wollte, dass es neben der Kirche auch was darstelle, wurden die Rathäuser ebenfalls mit Türmen gespickt. Ihr Gebrauchswert stand in keinem Verhältnis zu dem Aufwand, ob man nun Glocken hineinging oder Aussichtwarten daran klebte. Wie irrational Turmbauleidenschaft ist, bewiesen auf neckische Weise die ehrbaren Reichen der Stadt Bologna. Angeblich um vor ihren Nachbarn sicher zu sein, hatte jede der Familien ihr Haus betürmt. Damit waren Türme nichts Besonderes mehr. Als sich aber nun herumsprach, dass die Stadt Pisa als ganz besondere Absonderlichkeit gar einen schiefen Turm besitze, begannen die Bologneser, um die Wette schiefe Türme zu bauen. Viele von ihnen stehen heute noch und verwirren Touristen, denn die glauben, der seltsame Anblick könne auch am italienischen Wein liegen.
Damit war der Weg frei für die Säkularisierung der ursprünglich Kirchen vorbehaltenen Türme. Ihre Symbolik aber wurde im Abendland schamhaft verschwiegen. In der arabischen Sprache ist das Wort Minar gleichbedeutend für Erektion und Turm.
Die hochgereckten Phalli gotischer Kathedralen aber wurden höchstens dezent als "Zeigefinger Gottes" bezeichnet, was natürlich auf dasselbe herauskommt, denn in Michelangelos berühmtem Gemälde wird Adam auch per Zeigefinger gezeugt. Das Beispiel göttlicher Zeuge - Finger führte schließlich zur weltlichen Nachkommenschaft der Eiffel- und Fernsehtürme bis zu den Monstern unserer Versicherungshochhäuser.
Die schönsten, atemberaubendsten Türme aber bleiben wohl die des Islam. Bezeichnenderweise türmen sich ihre gewaltigsten in den Grenzgebieten der Religion, weithin sichtbare Prestigesymbole von unübertrefflicher architektonischer Vollkommenheit. Bevor der Architekt Eiffel sein Stahlmonster plante, sammelte er begeistert Abbildungen des Kutab Minar in Delhi.
Das Kutab Minar ist zwar nur etwa 73 Meter hoch, doch von allen Türmen der Welt der erregendste. 1199 wurde das Bauwerk vollendet, und sein Ruhm ging schon damals um die Welt. Der komplizierte Grundriss lässt den Wunderbau auch an seiner fünfzehn Meter breiten Basis zierlich erscheinen, und zahllose Reliefs vermitteln den Eindruck einer schwerelos schwebenden Architektur. Da sich der Turm nach oben beträchtlich verjüngt, wirkt er wesentlich höher, als er ist, doch muss letztlich jede Sprache bei der Beschreibung passen. Allein Kutab Minar ist eine Reise nach Indien wert, und mit vielen anderen Türmen hat auch dieser Traumbau das Schicksal gemein, bevorzugtes Reiseziel für Selbstmörder zu sein.
Ein Turm ist auch schuld daran, dass wir heute noch über einen seltsamen Türken namens Kabus nachdenken. Er muss eine ziemlich geheimnisvolle Persönlichkeit gewesen sein, da sich die Gelehrten nicht einmal über seinen Namen einig sind. Schemsal-Malai Kabus soll er geheißen haben oder auch Kabus Ben Waschemgir und kam auf jeden Fall im Jahr 976 wie ein Orkan über den persischen Landstrich Gorgan, etwas südlich des Kaspensees. Er dürfte im heutigen Südrussland geboren sein, und von seiner Autobiographie blieben einige Fragmente erhalten: Kabus heiße ich und bin ein großer Mann. Ich komme aus den Ländern der unendlichen Wiesen, und wo ich hintrete, wächst kein Gras mehr. Über das Letztere zumindest bestehen keine Zweifel. Mit etwa 500 Haudegen fiel Kabus über Gorgan her, vertrieb den dort friedlich hausenden Türkenfürsten und verwandelte binnen fünf Jahren das Land buchstäblich in eine Wüste.
Natürlich ließen sich das die dortigen Anwohner nicht gefallen, und vier Jahre später gelang es ihnen, die Landplage Kabus außer Landes zu jagen. Wohin Kabus weitergezogen ist, blieb unbekannt. Als Ort seines Exils wird Konstantinopel angegeben, Ägypten, Spanien, Rom und sogar Bagdad, wo aber nur der Henker auf ihn gewartet hätte. Immerhin muss Kabus in der Fremde mit Kultur in Berührung gekommen sein, denn als er nach zwölf Jahren wieder über Gorgan herfiel, konnte Kabus sogar lesen und schreiben.
Der arme Landstrich wurde Kabus nicht wieder los. Ohne Rücksicht und auf Kosten seiner ächzenden Untertanen ließ der Fürst einen gewaltigen Palast aus dem Boden stampfen, und die meisten Historiker bestach er von nun an als großzügiger Förderer der Künste. Kabus interessierte sich für Philosophie, Dichtkunst, Astrologie und Ästhetik, und wie viele Ästheten war er auch ein ausgesprochener Sadist. Als solcher wurde er sprichwörtlich und sogar vom berühmtesten dieser perversen Zunft, dem leibhaftigen Marquis de Sade, im Irrenhaus zu meinen glorreichen geistigen Vätern gezählt. Während jedoch der Namensgeber des Sadismus sich seine zahllosen und erfindungsreichen Techniken nur vorstellen durfte, konnte Kabus sämtliche Phantasien in Wirklichkeit umsetzen. Am liebsten zerstückelte er persönlich und ganz langsam zum Tode Verurteilte, und dieser Chance konnte jeder Untertan aus jedem Grund teilhaftig werden. Um die Jahrtausendwende dachte Kabus daran, dass es wohl auch mit ihm einmal zu Ende gehen könne, und ließ sich ein Grabmal bauen. Da er selbst als Sexualpartner am liebsten leicht verweste Leichen hatte, zerbrach er sich den Kopf darüber, wie sein eigener Leichnam derlei Fährnissen entzogen werden könne. So ließ Kabus einen Turm errichten, vierundvierzig Meter hoch und unbesteigbar. Das Innere des Gemäuers war ein einziger ungeheurer Kuppelraum, und dort, bestimmte der Fürst, solle einmal sein Sarg hängen, in luftiger Höhe von fünfunddreißig Metern und an eisernen Ketten. 1006 war das Bauwerk vollendet, wie eine Inschrift verkündet.
Der Architekt hatte eine Meisterleistung vollbracht. Der Turm des Kabus ist das Imponierendste, was je aus Backsteinen errichtet wurde, und schon eine lächerlich ungenaue Abbildung reichte aus, den englischen Romantiker Lord Byron auf Persientrip zu schicken. Wer den Turm mit eigenen Augen gesehen hat, kann den poetischen Schwärmer verstehen. Nur der Architekt des Ganzen hatte nicht viel davon. Als der Bau vollendet war, ließ ihn Kabus umbringen.
Sechs Jahre später wurde dem Kabus eine frische Knabenleiche gebracht. Obwohl sie noch nicht stank, freute sich der Fürst ausnehmend darüber, denn sie lag auf dem Bauch und sah appetitlich aus. Dergleichen hatte er an diesem Morgen erst einmal gehabt.
Nachdem Kabus als frommer Muslim sein Mittagsgebet verrichtet hatte, ließ er sich auf der Leiche nieder. Die aber wurde plötzlich spring-lebendig und hatte einen Dolch unter ihrem Bauch. Minuten später war Kabus eine Leiche.
Und von seinem sicheren Grab hatte Kabus auch nichts. Zwar soll er tatsächlich in seinem Turm aufgehängt worden sein und sogar in einem gläsernen Sarg, doch heute ist das Gewölbe leer.
Viele Islams und auch Kommunisten
Das Reich des Islam war zu jenem Zeitpunkt schon vollends unübersichtlich geworden. Auch die damaligen Historiker konnten keinen Überblick bekommen, obwohl auch sie in einem Turm residierten. Er war zu Bagdad errichtet worden, als Ehrenzeichen der Geschichtswissenschaften, und als eines der wenigen Bauwerke der Stadt schneeweiß getüncht. Im Volksmund hieß das Gebäude deshalb Elfenbeinturm, und obwohl es nicht mehr steht, gilt es noch immer als standesgemäßer Wohnsitz von Gelehrten.
Was um den Elfenbeinturm herum geschah, konnte auch von diesem aus nur als verworren wahrgenommen werden. Irgendwann wurde den türkischen Beschützern Samarra zu langweilig, und so verfrachteten sie den Kalifen zurück nach Bagdad. Von der ganzen Herrlichkeit des Kalifats war nur eine Art letzter Instanz in theologischen Fragen geblieben, etwa vergleichbar der Stellung des Papstes in der heutigen Politik, doch ohne dessen durchaus reale wirtschaftliche Macht. Die Kalifen waren in jeder Beziehung Kostgänger ihrer Beschützer, und um die Jahrtausendwende stritten sich die bekannten Bujiden mit einem neuen Türkenstamm, den Seldschuken, darüber, wer nun zu Recht den Beherrscher der Gläubigen entmündigen dürfe. Die Seldschuken setzten sich durch, und von nun an gab es über diese Frage nur noch Auseinandersetzungen unter den Seldschuken.
In Ägypten aber war eine Sippe an die Macht gelangt, die von sich behauptete, via Fatima direkt von Mohammed abzustammen und sich daher Fatimiden nannte. Der stolze Stammbaum war ein ausgemachter Schwindel. Der wahre Stammvater hieß Maimun Kaddah und war Perser. Aus der Lehre Zoroasters hatte er sich für den Privatgebrauch eine interessante Philosophie gemacht: Gut und Böse seien zwei gleich starke Prinzipien, und der rechte Lebensweg verlaufe haarscharf zwischen beiden.
Allzu gute Menschen müssten daher ebenso ausgiebig Schlechtigkeiten begehen, um die Balance zu halten. Ähnlich hatten im Bereich christlicher Philosophie schon die Manichäer gedacht, die berühmtesten aller Ketzer, und noch in unserem Jahrhundert fand Maimum Kaddahs Lehre in dem russischen Gottesmann Rasputin eine dämonische Wiederauferstehung.
Nach diesem Prinzip begaben sich Maimuns Söhne in die Politik. Zunächst zur Schia. Abdallah Ben Maimun entschied sich für eine besondere Variante dieser schon längst ebenfalls in Parteien zerfallene Partei: Die Siebener-Schia.
Die Schüten hatten schon bald begriffen, dass sie von den leiblichen Erben Mohammeds auch nicht mehr zu erwarten hatten als von den Kalifen, und so war das ursprünglich realpolitische Ziel schon lange in mystische Ferne gerückt. Kein Schiit glaubte mehr daran, dass es unter einem Imam des Hauses Ali auf der Welt besser würde. Derlei Hoffnung konnte nur noch von einem "Imam der Zeit" kommen, dem Mahdi, dem Erlöser, der irgendwo im Überirdischen hauste und eines Tages auf die Erde herabsteigen würde. Da der Hauptzweig des Hauses Ali allmählich degenerierte, war es nur eine Frage der Zeit, wann sich die gesamte Schia zu dieser Ansicht entschließe. In der siebten Generation verstarb ein Knabe namens Ismael, und von dem behaupteten nun viele Schiiten, er sei in die Verborgenheit eingegangen und werde einst als Mahdi wiederkommen. Damit waren sie aller irdischen Verpflichtungen der Sippe gegenüber entbunden. Die Mehrzahl der Schia aber zählte geduldig die Generationen weiter und hörte erst bei Imam Nr. 12 auf, der 874 unmittelbar nach seinem Vater und in zartestem Alter gen Himmel fuhr. Die Ismaeliten, auch Nizariten genannt, waren den Zwölfer-Schiiten somit etwa 130 Jahre voraus, und diese Zeit hatten sie auch zu zahllosen mystischen Spekulationen verwendet.
In diesen Rahmen passte Maimuns Lehre haargenau, ließ sie doch in jeder Beziehung privater Mystik freien Raum. Ein Urenkel Maimuns aber bewies, dass diese im besten Sinn des Wortes amoralische Philosophie mit geringen Abwandlungen durchaus auch die Grundlage für nicht mystische Denksysteme bilden kann und wurde der Chefideologe der ersten islamischen Kommunisten.
Die Mehrzahl der Sippe hielt davon nichts. Über den Umweg der
Religion betrieben sie nackte Machtpolitik, und der siebten Generation nach Maimun gelang es, Ägypten in Besitz zu nehmen. Kaum hatten sie das geschafft, nannten sie sich stolz Kalifen, und somit gab es bereits zwei religiöse Chefs im Islam. Das Beispiel machte Schule, und bald nannten sich die Fürsten Spaniens ebenfalls Kalifen, und um das Jahr 1000 gab es bald ebenso viele Kalifen wie Fürsten.
Der Kalif von Kairo aber war der erfolgreichste und bald für das Abendland wesentlich wichtiger als sein Kollege zu Bagdad. Unter den Fatimiden bekam Europa noch einmal die geistige Überlegenheit Arabiens anschaulich zu spüren - mehr als ein Jahrhundert lang bestimmten fatimidische Künstler den Stil des Mittelalters. War der Islam auch militärisch an allen Fronten im Rückzug begriffen, kulturell erreichte er eine beispiellose Expansion. Bis nach Schweden gelangten die kostbaren Gläser aus Ägypten, und zum wertvollsten Schatz der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches zählten massive Gefäße aus Bergkristall, meisterlich verarbeitet von fatimidischen Steinschneidern. Zwar hatten die Normannen den Muslims Sizilien weggenommen, doch auf islamische Künstler konnten auch sie nicht verzichten. Zum Glück für die Nachwelt: Während in Ägypten von der Pracht der Fatimiden nichts übrig blieb, hat sich durch Sizilien so viel erhalten, dass wir uns schattenhaft die einmalige Kunstfertigkeit jener Zeit vorstellen können. Noch heute leuchten vom kompliziertesten Tropfsteingewölbe der Palastkapelle in Palermo die auf Goldgrund gemalten Heiligenbilder islamischer Maler, aus deren Nachahmungen unsere mittelalterlichen Altare entstanden. Und ein einsames Meisterwerk der Textilkunst raubt heute noch Besuchern der weltlichen Schatzkammer in Wien den Atem: Ein großer, halbkreisförmiger Mantel aus scharlachroter Seide. Zwei Löwen erlegen darauf je ein Kamel, aus reinem Gold und zahllosen Perlen gestickt. Auf der Randborte wird Insch Allah, so Gott will - Allah Segen für den Träger des Gewandes erbeten. Wenn Allah seine Gläubigen lieb hatte, wird er sich allerdings gehütet haben, den frommen Wunsch zu erfüllen - das Prachtstück diente als Krönungsmantel der deutschen Kaiser, und die haben ja ihr gehöriges Maß zum Untergang islamischer Größe beigetragen.
Einiges besorgten auch die Fatimiden selbst. Der Glanz seines Reiches stieg dem Kalif Hakim so zu Kopf, dass er sich ernsthaft für den leibhaftigen Allah hielt.
Die Gläubigen aber hielten ihn nicht dafür und brachten ihn um.
Immerhin kann man aus dieser Episode ersehen, wie weit es mit der Lehre Mohammeds gekommen war. Der Islam war in mindestens ebenso viele Sekten und Religionen zerfallen wie das Christentum, und die bunten Seitentriebe dieser Religionen glichen einander oft verblüffend. Auch eine Art Hippie-Bewegung gab es unter den Gläubigen Mohammeds. Zahllose Muslims beschlossen, Allah zuliebe strikten Konsumverzicht zu üben und vom einfachen Leben aus der Gnade Gottes zu schwärmen. Ein härenes Gewand genügte ihnen, und danach wurden sie Sufis genannt. Auch diese Glaubensgemeinschaft blieb nicht ungeteilt. Manche Sufis glaubten, stille Größe und Konsumverzicht reiche nicht aus. Die wahre Seligkeit liege in lautem Entzücken, verbunden mit Bettelei. Sie nannten sich Derwische, und ihr Gesang war so markerschütternd laut, dass er als Geheul sprichwörtlich wurde.
Die interessanteste Gruppierung in dieser Vielfalt wird allerdings von Historikern gerne verschwiegen: Die Karmaten. Das waren nämlich ausgesprochene Kommunisten. Möglicherweise haben auch sie als Mystiker angefangen, denn ihr Begründer Achmed Ben Eschaass zählte zu den Anhängern der Lehre Maimuns und dürfte auch dessen Enkel gewesen sein. Nach anderen Quellen war er nur ein Schüler des Enkels - auf jeden Fall aber dachte er das Gedankengerüst radikal weiter. Gut und böse waren für ihn nur Maßeinheiten einer jeweiligen gesellschaftlichen Übereinkunft, und die beschloss er aufzukündigen. Sein Ziel war nicht mehr das Paradies im Jenseits, sondern eines hier und möglichst gleich. Es läge nur an den Menschen, sich die Erde zum Paradies zu machen, und als Rezept empfahl er: Abschaffung des Privateigentums, Überführung der Produktionsmittel an die Produzenten, Zusammenschluss der Bevölkerung zu Kommunen und ganz allgemein die klassenlose Gesellschaft.
Unter der Landbevölkerung des südlichen Irak fanden die Karmaten begeistert Zulauf, und Hamdan Karmat konnte 890 tatsächlich ein beträchtliches Territorium für die Seinen erobern. Kufa, Basra, die gesamte Euphratmündung, die Westküste des Persischen Golfs und auch das heutige Kuwait blieben etliche hundert Jahre kommunistisch, und daran konnte keine der zahllosen gegen die Karmaten losgeschickten Armeen etwas ändern.
Die roten Fahnen der Karmaten würden ein Magnet für die unterdrückte Landbevölkerung und Sklaven, und sie flüchteten in Scharen in den Staat, der in den Hofberichten jener Zeit regelmäßig als "Unding", "Rote Zone" oder gar "dieses Gebilde" bezeichnet wurde.
Allerdings unternahmen die Karmaten auch Ausflüge. 930 besuchten sie Mekka und nahmen als Souvenir den Schwarzen Stein der Kaaba mit. Durch den Islam ging ein Aufschrei, doch der Stein kam deshalb nicht wieder. Das Zentralkomitee der Karmaten hatte ihn in der Landkommune al-Ahsa sicher verwahrt, und keine Armee konnte ihn von dort zurückholen. Nach langen Verhandlungen wurde 951 ein Vertrag geschlossen und vom Zentralkomitee, 51 Fürsten, 127 Generälen sowie 3 Kalifen unterzeichnet. Der Schwarze Stein kam nach Mekka zurück, doch das Territorium der Karmaten sollte als unabhängiger Staat anerkannt werden.
Bis 1504 konnte sich das erste funktionierende Staatswesen der Kommunisten halten. Wir wissen nur wenig darüber. Die spärlichen Texte, die erhalten blieben, ähneln überraschend den Worten des Vorsitzenden Mao, und auch die Landkommunen der Volksrepublik China sind nicht anders organisiert, als es die Dörfer der Karmaten waren. Lange Zeit nannten sich die Karmaten auch Baath, und unter diesem Namen erlebte karmatisches Gedankengut in unserem Jahrhundert vor allem in Syrien und im Irak eine glanzvolle Renaissance. Dass sich der Einfluss der Sowjetunion im Nahen Osten wohl immer in Grenzen halten wird, danken wir somit den Karmaten, denn zu Recht betonen Syrer und Irakis immer wieder, sie wüssten aus eigener Erfahrung, was Sozialismus ist, und das schon ein Jahrtausend länger als ihre Kollegen in Russland.
Europa aber nahm von alldem nur wahr, dass der Islam als Machtfaktor zerfiel. Einige hundert Jahre lang waren die christlichen Länder von Muslims höchstens als unterentwickelte Halbkolonien behandelt worden. Nun rüsteten Europas Staaten zum Gegenschlag, zur großen Plünderung des Islam. Abenteurer machten sich auf, die Leiche der Weltmacht zu fleddern, und selbstverständlich im Namen der Religion. So erhielt das erste Abenteuer des Abendlandes in Sachen Kolonialismus den frommen Namen Kreuzzüge.
|
|
Killer in Gottes Namen
|
|
|
Assassinen reden anders
Einer meiner Schulfreunde hat es ziemlich weitgebracht. Er wurde ein echter Abenteurer Kreuzfahrer nannte er sich selbst -, und nach wilden Wanderjahren am Rande der Legalität und oft auch darüber hinaus hat es ihn nach Marokko verschlagen. Dort lebt er heute noch, und ich fürchte, nicht unbedingt von sauberen Geschäften. Immerhin verdanke ich ihm einen der aufregendsten Nachmittage meines Lebens.
Das war vor etlichen Jahren in der Altstadt von Tanger. Mein Freund hatte mich kreuz und quer durch das Gassengewirr der Altstadt geführt, und nun standen wir in einer beklemmend engen Gasse vor einem Loch mit einer verwaschenen Decke davor. Du wolltest doch immer was erleben, meinte er und schob mich durch den Vorhang.
Ein wüsteres Lokal habe ich nie wieder gesehen. Hier schienen schon Generationen gesessen zu haben, und irgendwann dürften sie dann festgewachsen, verfault und schließlich festgetreten worden sein. Mitten in der schmutztapezierten Höhle jedoch stand ein vor Sauberkeit leuchtender Messingtisch, darauf bunte Gläser mit Pfefferminztee, eine Schüssel mit weißen, krümeligen Keksen und eine gewaltige Wasserpfeife. Es roch umwerfend, und der Raum war so eingenebelt, dass ich lange brauchte, bis ich einige Männer mit verwegenen Profilen wahrnahm. Zusammengesunken hockten sie in verwaschenen Lumpen um den Tisch. Manche schienen meinen Freund zu kennen. Sie grüßten ihn mit einem müden Kopfnicken, und dann schwiegen sie weiter. Aus dem Qualm quäkte ein Kassettenrecorder leise arabische Musik, und der Wirt brachte uns unaufgefordert Tee.
Manchmal kam einer durch den Vorhang und tastete sich an den Tisch. Dann brachte der Wirt ein neues Teeglas, und nach einer Weile begann der Ankömmling zu sprechen, ziemlich wenig, doch das klang wie ein Singsang. Daraufhin sagte jeder der anderen etwas, in derselben Tonlage, und das Ganze klang wie eine gespenstische Auktion.
Mein Freund übersetzte: "Ein Farbfernseher, nagelneu, aus Übersee." "Großvater" "Hausknecht" "Kameltreiber" "Junger Knecht".
Es War eine Auktion in mittelalterlicher Währung. Die Personen bedeuteten jeweils eine Summe, die früher ein Mensch auf dem Sklavenmarkt eingebracht haben mochte.
Der Farbfernseher war zweifellos nicht auf legale Weise zu dieser Ehre gekommen. Höchstwahrscheinlich hatte der Prestigekasten die Villa eines Reichen in dem farbfernsehlosen Land geziert - Robin Hood auf islamisch. Viele andere Dinge wurden auf diese Weise im Lauf der nächsten Stunde versteigert, vom Trockenrasierer bis zum Automotor, aber auch rätselhafte, wie "Eine blaue Lampe aus dem Vierten Himmel" und "Eine Rose, noch nicht voll erblüht". Natürlich fragte ich meinen Freund, was das bedeute, doch der schwieg sich aus. Später, auf der Gasse, sagte er, in welcher Gesellschaft wir uns befunden hatten, und da wurde mir nachträglich etwas unheimlich: "Assassins".
Das Wort ist arabisch und bedeutet "Haschischesser". Mein Freund aber sprach es französisch aus, und da heißt es: Meuchelmörder, auch blutrünstiger Massenmörder.
Assassin trifft die gruseligste Kombination im Horrorkabinett unserer Vorstellungskraft - Rauschgift plus Mord. Vor einigen Jahren ging das Wort um die Welt, als der Hippie Charles Manson mit seiner Familie in Hollywood grauenvolle Morde inszenierte, und doch war der "Satan von Kalifornien" ein harmloser Junge, verglichen mit seinem Vorbild Hasan ibn Sabbah. Der lebte zwar vor neunhundert Jahren, doch die Welt kennt ihn heute noch als "Der Alte vom Berge".
Der spannendste Krimi der Geschichte
Marco Polo berichtet: Der Alte vom Berge war, wie das Volk, das er beherrschte, ein treuer Anhänger der mohammedanischen Lehre. In seinen Wunschträumen suchte er ein Mittel, um aus seinen Untertanen kühne Kämpfer und Mörder zu machen, so dass er töten konnte, wen er wollte, und man ihn überall fürchten würde.
Er bewohnte ein edles Tal zwischen zwei sehr hohen Bergen. Dort hatte er den schönsten Garten angelegt, den man je gesehen hat. Es gab darin die schönsten Pflanzen, Blumen und Früchte der Welt und alle Baumsorten, die er ausfindig machen konnte. Er ließ Häuser und Paläste bauen, die schönsten der Erde, ganz vergoldet, mit Juwelen geschmückt und Vorhängen aus Seide. Vor diesen Palästen ließ er viele schöne Springbrunnen errichten, aus denen Wein, Honig, Milch und reines Wasser flossen.
Dort wohnten die schönsten Mädchen und Frauen, die alle Instrumente zu spielen verstanden, melodisch sangen und um die Brunnen tanzten. Vor allem waren sie mehr als alle anderen Damen der Welt dazu erzogen, den Männern alle erdenkbaren Zärtlichkeiten und Liebkosungen zu erweisen. Es gab dort Putz, Essen, Bettzeug und alle wünschenswerten Dinge in großen Mengen. Man durfte von keinen lästigen Dingen sprechen, und die Zeit sollte mit nichts anderem verbracht werden als mit Spielen, Belustigungen und Liebe. So tummelten sich diese mit wunderbaren Seidenschleiern und Gold geschmückten Damen zu jeder Tageszeit in den Gärten und Palästen, während die sie bedienenden Frauen eingeschlossen waren und nie im Freien zu sehen.
Der Alte ließ unter seinen Mannen den Glauben verbreiten, dieser Garten sei das Paradies, und die Sarazenen dieses Landes glaubten fest daran. Sie glaubten auch, dass der Alte ein Prophet sei und ins Paradies bringen konnte, wen er wollte.
Nun ließ er in seinen Garten nur diejenigen, die er zu seinen Vasallen und Assassinen machen wollte. Am Eingang des Tales und dieses Gartens befand sich eine stark befestigte Burg, die niemanden auf der Welt zu fürchten hatte, und der einzige Zugang zum Garten war ein Geheimweg, der mit äußerster Sorgfalt überwacht wurde.
Der Alte behielt alle männlichen Bewohner dieser Gegend zwischen zwölf und zwanzig Jahren an seinem Hofe, zumindest diejenigen, die einmal das Waffenhandwerk ergreifen sollten. Wenn nun der alte Meister den Wunsch hatte, einen ihm feindlichen großen Herrn aus dem Weg zu räumen, ließ er vier, zehn oder zwanzig dieser jungen Menschen in sein Paradies befördern. Sie wurden mit Hilfe gewisser Getränke in einen Schlaf versetzt, der drei Tage und drei Nächte dauerte, und während dieses Schlafs wurden sie in den Garten getragen.
Wenn die jungen Leute in diesem märchenhaften Garten erwachten und all die in der Prophezeiung von Mohammed aufgezählten Herrlichkeiten erblickten, glaubten sie wirklich, im Paradies zu sein. Den ganzen Tag schäkerten die ,schönen Frauen und Mädchen mit ihnen, sangen, tanzten, liebkosten sie und setzten ihnen die schönsten Speisen und Getränke vor. Schon berauscht von soviel Vergnügungen und den Bächen von Milch und Wein, sahen sie außerdem alle ihre Wünsche und Gelüste von den Damen befriedigt.
Alle Träume wurden ihnen sofort er füllt, und nie mehr hätten sie von diesen Garten verlassen. Der Alte aber ließ den jungen Männern erneut die gewissen Getränke reichen und sie während ihres Schlafes wiederum in seinen Palast tragen, der sich außerhalb des Gartens befand. Wenn die jungen Leute dann aufwachten, waren sie höchst erstaunt und enttäuscht. Vor dem Alten vom Berge aber knieten sie nieder und hielten ihn für einen großen Propheten.
Der Alte fragte sie, woher sie kämen, und in ihrer naiven Art antworteten sie: Aus dem Paradies. In Gegenwart aller wiederholten sie, dass dieses Paradies genauso sei, wie Mohammed es ihren Vorfahren versprochen hätte, wie glücklich man dort wäre und wie gerne sie dahin zurückkehren möchten. Die anderen, die von diesem Paradies sprechen hörten, ohne es selbst gesehen zu haben, wurden von dem Wunsch ergriffen, so schnell wie möglich dorthin zu gelangen, und ersehnten einen baldigen Tod. Doch der Alte sagte: "Meine Söhne, gemäss der Lehre des Propheten werden nur die ins Paradies kommen, die für den Glauben gekämpft haben. Leistet mir also Gehorsam, und ihr werdet diese Gnade erwerben."
So brachte der Alte sein Volk dazu, sterben zu wollen. Wem er befahl, sich in seinem Namen in Todesgefahr zu begeben, schätzte sich also glücklich, das Paradies verdienen zu dürfen.
Wollte nun der Alte vom Berge einen mächtigen Herrn umbringen lassen, stellte er seine Assassinen auf die Probe, um die Besten herauszufinden. Er schickte einige von denen, die im Paradies gewesen waren, an einen nicht allzu weit entfernten Ort mit dem Auftrag, einen bestimmten Mann zu töten. Sie begaben sich nach den Befehlen des Meisters sofort dorthin. Viele wurden gefangengenommen und ermordet, nachdem sie den Mann getötet hatten, aber sie wünschten sich ja den Tod, um schneller ins Paradies zu kommen.
Diejenigen, die entkamen und zu ihrem Meister zurück kehrten, berichteten, wie sie den Auftrag ausgeführt hatten. Der Alte äußerte seine Freude darüber und feierte sie. Doch wusste er schon vorher, wer sich am mutigsten verhalten hatte - jeder der jungen Männer war von einem Geheimboten überwacht worden, um festzustellen, wer der Kühnste und Geschickteste unter ihnen war, einen Menschen zu töten.
Auf diese Weise entkam niemand dem sicheren Tod, wenn der Alte vom Berge es beschlossen hatte.
Es kam zwar vor, dass die ersten Abgesandten getötet wurden, bevor sie ihr Ziel erreichten, doch der Alte schickte dann so lange andere dorthin, bis sein Feind ermordet war. Daher sandten ihm Fürsten und Könige Geschenke, um sich gut mit ihm zu stellen und nicht ermordet zu werden. Soweit Marco Polo, und diese Geschichte war wohl die einzige, die von seinen Zeitgenossen uneingeschränkt geglaubt wurde.
Sonst hielten die meisten Venezianer den Abenteurer und Kaufmann für einen hemmungslosen Aufschneider - die Existenz der Assassinen aber hatten manche ihrer Familien schon am eigenen Leib erfahren. Und ganz nebenbei bewirkte Marco Polos Bericht, dass seitdem in Europa eine Droge verteufelt wurde, die zwar in dem Bericht nicht direkt genannt wird, von der aber der unheimliche Geheimbund seinen Namen bekam: Haschisch.
Haschisch heißt auf Arabisch "der Fröhlichkeitsmacher", und diese Fröhlichkeit wird aus Hanf gewonnen. Botanisch heißt die Pflanze Cannabissativa, wird zu den Ölpflanzen gerechnet und wächst zweigeschlechtlich. Die schütteren männlichen Stauden liefern Fasern für Seile und Taue, die fast zwei Meter hoch wachsenden weiblichen den Stoff für Träume. Ihre Blätter heißen Ganja, Gandscha, Khif oder Marihuana, der Extrakt jedoch Haschisch. Für seine Gewinnung werden die Knospen knapp vor der Blüte mit kleinen Lederlappen gerieben. Blütenstaub und Harz bleiben am Leder kleben und werden mit einem dünnen Knochenschaber in kleine Töpfe gestrichen. Die Masse riecht betäubend, klebt und ist zunächst zäh wie Honig. Nach einigen Stunden verfärbt sie sich schwarzbraun oder schwarz-grünlich, wird hart und ist dann Haschisch geworden.
In der Türkei, Syrien, im Libanon, in Ägypten und Nordafrika wird nur der Blütenstaub abgesteift und mit primitiven Bügeleisen zu krümeligem, grünem bis rotbraunem Haschisch gepresst, doch eine mühselige Arbeit ist Haschischgewinnung auch auf diese vereinfachte Weise: Mindestens siebenhundert Pflanzen und vierzehn Arbeitsstunden sind für ein Kilogramm der Droge nötig. Dennoch ist diese Mühsal im Orient beliebt - ein Kilogramm Haschisch bringt dem Hersteller etwa dreißig Mark, und das ist schon sehr viel Geld.
Auf den Schmuggelwegen nach Europa erlebt das Zeug eine mindestens hundertfache Wertsteigerung, denn es enthält ein Alkaloid, das Chemiker Tetra-hydro-cannabinol oder THC nennen. Das bewirkt eine verstärkte Sauerstoffaufnahme des Blutes, etwa einem ausgiebigen Waldspaziergang vergleichbar, und lässt dadurch das Nervensystem sensibler reagieren. Bei größeren Dosen erhöht sich auch der Blutdruck, und starke Mengen ab etwa ein Gramm lassen ,das Hirn heißlaufen, wie die Araber sagen sie bewirken Halluzinationen. Innerlich unsichere Menschen verfallen dann leicht in Panik. Jahrzehntelange Untersuchungen der Royal Academy in England haben allerdings bewiesen, dass auch langer mäßiger Haschischgenuss vergleichsweise geringere Schäden bewirkt als Alkoholmissbrauch.
Ein in Asien geschätzter Vorteil der Droge kann jedoch dem Abendländer zum Verhängnis werden: Haschisch verursacht keinen Kater. Nun aber ist in unseren Breitengraden Rausch ein Urlaub von der Gesellschaft. Man trinkt, "um abzuschalten", darf angeheitert Dinge sagen und tun, die einem Nüchternen nie verziehen würden, und würde diese Narrenfreiheit wohl über Gebühr strapazieren, käme nicht am nächsten Morgen der Kater samt schlechtem Gewissen.
Haschisch kann mit derlei Nachwehen nicht aufwarten, und dadurch wird es in unserer Gesellschaft gefährlich. Anscheinend herrscht in unseren Breitengraden keine allzu große Bereitschaft, freiwillig in den Alltag zurückzukehren. Viele aus der Beat-Generation sind daher mit Haschisch "ausgeflippt" - sie dehnten den Urlaub von der Gesellschaft so lange aus, bis sie den Kontakt mit der Wirklichkeit verloren. Im Orient herrscht in dieser Beziehung größere Selbstdisziplin, und asiatische Cannabis-Raucher hatten aus diesem Grund für Hippies immer nur Verachtung übrig. Hierzulande aber wird in Diskussionen über Hanf immer das letzte Argument bleiben, dass der sonst durchaus harmlose Stoff, wie der Hamburger Psychiater Bürger-Prinz formulierte, leicht zur "Todesdroge für die Leistungsgesellschaft" wird.
Ein weiteres Argument gegen Haschisch lieferte das mittelalterliche Christentum. Da Mohammed Wein verbot und Hanf tolerierte, musste die Pflanze zwangsläufig unheimlich werden. Eigenartiger weise wurde nie die Frage geklärt, ob das Zeug nun des Teufels oder Gottes sei.
Zwar gehörte Hanf zu den Standardzutaten aller Hexenküchen, andererseits aber konnte der Teufel im süddeutschen Raum keinem Mädchen was zuleide tun, sobald es sich vor dem verführerischen Bösen in ein Hanffeld flüchtete. Noch in meiner Jugendzeit pflanzten viele Bauern um ihren Hof Hanf, als eisernen Vorhang vor dem Satan. Die Pflanzen allerdings wurden durchaus profan genutzt: Getrocknete Blätter wurden als "Armeleut-Knaster" in Pfeifen gestopft und aus den Spitzen der Pflanzen ein Tee gegen Brustkrankheiten gebraut.
Auch im Orient wird Haschisch medizinisch genutzt. Afghanische Apotheken führen noch heute schmerzstillende Haschisch - Salben, und Firdausi berichtet von einem Kaiserschnitt an einer Königin, bei dem Haschisch zur Lokalanästhesie verwendet wurde. Dabei allerdings wird genau zwischen Haschisch verschiedener Herkunftsorte gewählt - ähnlich wie beim Wein bestimmen Klima und Boden den THC-Gehalt der Pflanzen. Beispielsweise würde ich niemandem empfehlen, aus persischem Hanf einen Tee gegen Atemnot zu brauen - mir selbst hat er einmal die Luft verschlagen, als ich die Spuren der Assassinen suchte.
Von der Kaspensee führt eine breite Strasse in zahllosen Windungen über das Elbursgebirge nach Teheran. Sie ist uralt und war einst ein Zubringer der Seidenstrasse. Ihr Asphalt ist neu, denn heute flitzen über sie die Reichen Teherans zu ihren Wochenendhäusern. Daher rollen auch die Busse des gewöhnlichen Volkes ungewöhnlich sanft von der Kaspensee nach Süden, und schon nach kurzer Fahrt und etwa 50 Kilometern ist die erste Passhöhe erreicht. Eine atemberaubende Mondlandschaft im Norden liegen hinter einem Dunstschleier die üppigen Ufergärten, hier aber ist der Himmel unbarmherzig klar, und die Sonne hat schon vor Jahrtausenden das letzte Grün aus den Felsen geglüht. Im Schatten einer Felsklippe duckt sich eine Jahrhundert alte Karawanserei mit einem chromglänzenden, nagelneuen Cola-Automaten. Hier tankte ich noch einmal westliche Zivilisation. Acht Kilometer weiter setzte mich der Fahrer bei einer kleinen Brücke ab, und dann wanderte ich mit meinem Schlafsack den Fluss Puli-Rud hoch.
Der Fluss ist ein winziges Bächlein und eher die Demarkationslinie zwischen Bauerland und Gebirgswüste.
Links warten einige halbvertrocknete Felder auf Regen, rechts aber steigen steile Felsen hoch, und da wächst nur etwas graubraunes Gras mit einigen winzigen, verschrumpelten Hanfpflänzchen.
Ich war etwa drei Stunden gewandert und in die Nähe einiger winziger Lehmhütten gekommen. Plötzlich stand ein Bauer hinter mir, und ich erschrak fürchterlich. Schon in Ramsar hatte man mich gewarnt, mit den Leuten dieser Gegend sei nicht gut Kirschen essen. Aber abgesehen davon, dass hier gar keine wuchsen, beginnt im Orient das Böse immer gleich hinter dem eigenen Dorf. Immerhin jedoch war das Gesicht des Bauern noch zerklüfteter und verschlossener als das Gebirge, und mir war bänglich, bis er endlich schmunzelte und der Bann gebrochen war.
Keiner von uns verstand die Sprache des anderen, und so unter hielten wir uns mit Händen und Füssen. Schließlich zerrte er mich fast auf eine Decke unter dem Vordach seiner Hütte - ich war also auf Gedeih und Verderb sein Gast.
Mein Gastgeber zerkrümelte einige Hanfblättchen und verrührte sie in einem kleinen Tonnapf mit faszinierender Ausdauer und etwas Wasser zu einer Paste. Dann molk er umständlich eine halbverhungerte Ziege, mischte die Paste mit Milch und bot mir das Ganze an. Im Dunkel des Hauses mussten Frauen sein, denn ich hörte ihr Kichern, während ich auf das Gebirge sah.
Das Tal, aus dem das Flüsschen kam, wurde von zwei gewaltigen, rotbraunen Felszinnen bewacht. Nach einer Weile begannen sie zu glühen, wurden zu Gold und schienen schließlich zu brennen. In dem Tal aber sah ich eine Smaragdader - leuchtendes Grün, mitten in dieser ausgedörrten Erde.
Mein Gesicht muss gestrahlt haben, denn mein Gastgeber sah von seinem Strickstrumpf auf, beobachtete mich aufmerksam und schien seine diebische Freude dran zu haben.
Ich starrte weiter auf die Felsen. Ganz oben, kaum vom Gestein zu unterscheiden, waren Mauerreste. Überall, so weit mein Auge reichte. Hier muss einmal eine gigantische Festungsanlage gewesen sein, und nach allem, was ich gelesen hatte, Alamut, das Schloss des Alten vom Berge.
"Alamut"? fragte ich und merkte, dass mir das Sprechen schwer fiel. Mein Gastgeber sah ebenfalls auf die Mauern und nickte. "Alamut", wiederholte er, und: "Nizari".
Nizari nannten sie sich selbst, die Assassinen. Ich saß am Fuß ihrer sagenhaften Burg. Alamut brannte.
Die Felsen brannten, und als ich die Augen schloss, brannte mein Hirn. Ich sah den brennenden Dornbusch des Moses und die Flammenschrift an der Palastwand Nebukadnezars, von der Daniel berichtet. Ich sah Burbak, auf dem Mohammed in den Himmel fuhr, und plötzlich wurde mir speiübel. Wie lange diese Angstphase dauerte, weiß ich nicht. Irgendwann jedenfalls wurde ich entsetzlich müde, rollte meinen Schlafsack aus und war Sekunden später eingeschlafen.
Nicht viel anders wird es den Jüngern des Alten vom Berge gegangen sein. Für sie war Haschisch der Schlüssel zum künstlichen Paradies, doch allzu künstlich wird man sich das Paradies nicht vorstellen dürfen. Marco Polo musste seinen staunenden Zeitgenossen eine Hollywoodkulisse aufbauen, doch in der Wüste reicht bereits ein kleines Fleckchen Grün zum Paradies.
Alamut war vor allem ein strategisch wichtiger Platz. Der Kasri-Rud war eine der bedeutendsten Festungen des Seldschukenreichs, eine "Perle in der Krone Melekschahs", und galt von alters her als absolut uneinnehmbar. Ihr Kommandant lachte daher schallend, als im Herbst des Jahres 1090 Hassan ibn Sabbah mit etwa dreihundert Mann vor den gewaltigen Mauern erschien und ihn aufforderte, die Burg sofort ihm und dem Fatimiden-Kalifen zu Kairo zu übergeben. Der Kommandant war ein treuer Gefolgsherr der Seldschuken und dachte nicht daran, die ihm anvertraute Festung den Erbfeinden seiner Herrscherfamilie auszuliefern. So schrieb er nur einen Brief an Nizam ol-Mülk, den allmächtigen Großwesir seines Herrn: Hassan ist hier mit einer Handvoll unbedeutender Hunde aufgetaucht. Sein Gefolge sind ausschließlich Landstreicher und Deserteure aus Euren glorreichen Truppen. Der Brief wurde mit Eilboten befördert, doch als er bei Nizam ankam, steckte der Kopf des Festungskommandanten bereits auf der höchsten Zinne von Alamut. Hassan hatte auch in der Festungsmannschaft Gefolgsleute gehabt. Sie öffneten in der Nacht das Burgtor, und damit hatten die Assassinen in der Weltgeschichte ihr Debut gegeben.
Hassan ibn Sabbah ist wohl die rätselhafteste Persönlichkeit in der Geschichte des Islam. Die meisten Historiker schildern ihn als leibhaftigen Satan, und das ist kein Wunder, denn ihre Brotgeber standen auf seinen berühmten Listen. Doch auch ihnen fiel es schwer, die absolute Bösartigkeit des Alten vom Berge handfest zu beweisen - was über Hassan an Tatsachen berichtet wird, lässt sich kaum gegen ihn verwenden.
Seine Zeit war der Höhepunkt der Seldschukenherrschaft. Das wilde, türkische Reitervolk beherrschte den Kalifen, Persien und ziemlich den gesamten Nahen Osten. Der wahre Herrscher aber hieß Nizam ol-Mülk auf dem Posten des Großwesirs. Er war Perser, stammte aus Tus und blieb seiner Heimatstadt lebenslänglich unübersehbar verbunden. Wer es auf Erden zu was bringen will, als weise und ehrenwert gelten möchte, muss nur aus Tus stammen und Schüler des großen Moaffik gewesen sein, spottete Omar Kajjam.
Omar wusste, was er sagte. Auch er stammte aus Tus und war ein Schüler Moaffiks, der als wandelndes Lexikon galt. Der erste Schüler Moaffiks war der Grossbauernsohn Nizam, und unter seiner unverschleierten Protektion machten nun alle weiteren steile Karrieren durch. Omar beispielsweise hatte es zum Hofmathematiker gebracht. In dieser Eigenschaft berechnete er den noch heute in Persien gültigen Kalender mit Jahresanfang am 21. März und fand Lösungsmöglichkeiten für Gleichungen dritten Grades auf geometrischem Weg. Einen ihm angetragenen Ministerposten allerdings lehnte er ab. Mit einer beachtlichen Pension zog er sich ins Privatleben zurück und verfasste zahllose Vierzeiler, die ihn als "Omar der Zeilmacher" unsterblich machten und auch schon von seinen Zeitgenossen als Frivolitäten begeistert verschlungen wurden:
"Kaaba und Tempel dienen nur der Knechtung,
und Christenglocken läuten zur Entrechtung. Moschee, Koran und Rosenkranz und Kreuz
sie haben nur für die, die dran verdienen, Reiz."
Nizam war 1019 geboren und gehörte zur ersten Schülergeneration Moaffiks.
Hassan ibn Sabbah war höchstwahrscheinlich Jahrgang 1040 und gehörte somit zu den letzten Lehrlingen des berühmten Meisters. Karriere aber machte auch er: Bereits 1070 taucht er in den Gehaltslisten der Seldschuken als Beg auf, als Hofmeister, mit einem steuerfreien Monatseinkommen von 12.000 Mark. Daraus können wir schließen, dass Hassan nicht von schlechten Eltern war, wie gerne behauptet wird - nur Söhne von Großgrundbesitzern oder Generälen konnten einen derartigen Posten erhalten. Ein Jahr später hatte es Hassan ibn Sabbah bereits zum Finanzminister gebracht.
Zu diesem Zeitpunkt kam es zwischen den beiden Schülern Moaffiks bereits zu Spannungen. Nizam fürchtete um seinen Einfluss, da sich Hassan - laut Dewjetschah, dem Hofchronisten unter der Larve tugendhafter Ehrlichkeit beliebt machte. Wie dies geschah, berichtet Nizam ol-Mülk in seinen eigenen Memoiren: Eines Tages wünschte der Sultan so schnell wie möglich eine Tonne Marmor aus Isfahan. Zufällig gingen gerade zwei Karawanen dorthin, eine mit vier und eine mit sechs Kamelen, um selbst je zehn Zentner Marmor zu holen. Da jedes Kamel vier Zentner tragen kann, waren die Karawanen nicht ausgelastet, und so bestellte der Sultan bei ihnen den Marmor für den doppelten Frachtpreis und ein Zusatzgeschenk. Daraufhin kam der Marmor sehr schnell, und der Sultan gab mir tausend Dukaten zur Verteilung. Ich gab 600 dem Besitzer der sechs und 400 dem der vier Kamele. Da sagte Hassan, die Teilung sei ungerecht, da dem Besitzer der sechs Kamele siebenhundert Dukaten gebührten. Der Sultan lachte, doch Hassan rechnete vor: "Die Fracht zerfällt in 3 Teile von je 13 1/3 Zentnern. Auf jedes Teil entfallen 3 1/3 Kamele. Vier Kamele sind in drei Teilen zehnmal, sechs Kamele aber vierzigmal enthalten." - "Erkläre dich deutlicher", sagte der Sultan. Da sagte Hassan: "Zehn Kamele haben vierzig Zentner getragen und die Last eines Kamels ist vier Zentner. Daher haben vier Kamele sechzehn Zentner getragen, von denen zehn Zentner Eigenbedarf abzuziehen ist. Nur der Überschuss gehört dem Sultan, und von dem trug daher die eine Karawane sechs Zentner, die andere aber vierzehn." Hassan hatte recht, und das musste auch Nizam zugeben. Wirklich ärgerlich aber wurde die Sache, als der Haushaltsplan für das Jahr 1072 erstellt werden sollte. Der Großwesir veranschlagte für die Arbeit sechs Wochen, als sich Hassan anbot, dasselbe in vierzig Tagen zu erledigen und den Auftrag erhielt.
Nizam war das gar nicht recht, bestand doch ein Grossteil seines ungeheuren Einkommens aus unterschlagenen Steuergeldern.
Dennoch äußerte er lauthals seine Bewunderung, als Hassan das Budget schon nach neununddreißig Tagen präsentieren konnte.
Dann aber meinte er, er würde nur zu gern die Unterlagen zu einigen Detailposten sehen. Sofort schickte Hassan seinen Sekretär in die Staatskanzlei.
Der Sultan war bereits etwas ungeduldig, als der Sekretär endlich wieder in der Tür des Kabinettsaals erschien, besser gesagt, sich schon an dessen Schwelle zu Boden warf. Sein Gewand war zerrissen, auf sein Haupt hatte er Asche gestreut, und stotternd meldete er, dass in der Staatskanzlei eingebrochen wurde. Geld und Wertpapiere seien nicht verschwunden, aber sämtliche Unterlagen...
Nizam ol-Mülk brach als erster das peinliche Schweigen: "Wer kann denn an so etwas Interesse haben? Doch nur Gauner, die sich Zahlen aus den Fingern saugen, da sie in so kurzer Zeit gar nicht alle Akten studieren können."
Am Abend war Stadtgespräch, dass Hassan ibn Sabbah mit Schimpf und Schande aus dem Thronsaal geprügelt wurde.
Wenig später tauchte der gestürzte Minister in Isfahan auf und nahm dort bei einem reichen Kaufmann Quartier. Dort schimpfte er so laut auf Sultan und Wesir, dass ihn der Gastgeber für geisteskrank hielt und ihm nur mild gewürzte, eisgekühlte Speisen vorsetzen ließ.
Hassan schimpfte weiter, und eines Tages entschloss sich der Gastgeber, mit Hassan ein ernstes Wort zu reden: "Das Eis, von dem du gerade gegessen hast, wurde von Eilboten aus dem Kaukasus gebracht. Ich musste sie mit Gold bezahlen. Du aber sorgst mit deiner Zunge dafür, dass der Goldstrom versiegt."
Wortlos stülpte Hassan den Eisbecher in das Gesicht seines Gastgebers und verließ das Haus. Der aber schrieb alles ganz genau an seinen Großwesir und fügte hinzu: Möglicherweise wird der Irre seinen Körper nach Ägypten bewegen. Und dort saßen die Fatimiden. Augenblicklich regierte Mustansir, der vor allem dadurch Geschichte machte, dass er absolut nicht sterben wollte. Länger hielt sich kein Herrscher des Islam auf dem Thron, ganze neunundfünfzig Jahre, von 1035 bis 1094.
Er war ein gütiger, alter Herr, und Hassan genoss seine Gastfreundschaft ausgiebig.
Siebzehn Jahre lang studierte er die Geschichte der Schia, aber auch die Ideologie der Karmaten, und dann wurde Hassan ibn Sabbah ungeduldig, dass er noch immer nichts für die Unsterblichkeit getan habe.
Nizar, der älteste Sohn des Kalifen, fühlte ähnlich. Als Kronprinz und ewiger Thronanwärter war er fast sechzig geworden, und nun überkam ihn in eine Art Torschlusspanik der Alptraum, sein Alter könne ihn möglicherweise überleben. Im Januar 1089 unterhielt er sich lange mit Hassan darüber, und der bestieg kurz darauf die Kanzel der Grossen Moschee zu Kairo, verkündete eine Revolution für Nizar - und wurde auf der Stelle verhaftet.
Kurz darauf trafen sich die beiden Verschwörer im Kerker wie der. Auch Nizar war in Ketten gelegt, doch waren die des Kalifensohnes - noblesse oblige mit Samt verkleidet.
Der alte Kalif nahm den Putschversuch nicht einmal sonderlich übel. Er verzichtete darauf, seinen rebellischen Sohn blenden zu lassen, was eigentlich bei derlei Anlässen üblich war und garantierte, den Betreffenden auf ewig von den Schaltstellen der Macht fernzuhalten. Auch Hassan wurde kein Haar gekrümmt. Zwar wurde er des Landes verwiesen, doch mit einem großen Geldbetrag, um Truppen zu heuern und sich auf dem Feld der Ehre würdig gegen Feinde zu bewähren. Natürlich wusste der gütige Fatimiden-Kalif, wo die saßen, und war daher nicht erstaunt, als ihm die Geschichte von Alamut berichtet wurde.
Aus allen Wolken aber fiel Nizam ol-Mülk. Er tobte, dass sein Geheimdienst nicht mitbekommen hatte, wie Hassan in aller Stille eine kleine Armee warb, und ließ dessen Chef sofort köpfen. Privat schmerzte ihn außerdem, dass auch sein Leibarzt Abdelmalik ibn Tutusch zu Hassan gewechselt hatte, denn Tutusch war der berühmteste Drogenspezialist der damaligen Welt. Da sich aber Hassan in Alamut still verhielt und nur von vorüberziehenden Karawanen ein kleines Wegegeld nahm, vergaß Nizam die Sache bald wieder.
Der Großwesir hatte wichtigere Feinde, und sein gefährlichster war eine Frau. Sie hieß Turkjan Chatun und war die Favoritin des Sultan. Mit Nizam hatte sie sich angelegt, als der andere Vorstellungen über die Thronfolge hatte als sie.
Nun brütete Chatun Rache und suchte nach dunklen Flecken auf der weißen Weste des Wesirs.
Auf Anhieb fand sie zwölf, Nizams Söhne, die zufällig alle Minister waren und das gesamte Kabinett ihres Papa bildeten. Chatun meinte, das grenze denn doch an Protektionswirtschaft, und bearbeitete damit ihren Gatten und Sultan so lange, bis dieser das erste Mal in seinem Leben wagte, gegen den Großwesir aufzumucken.
"Wenn du fortfährst", sagte Melekschah zu Nizam, und musste jedes Wort von einem Zettel ablesen, den Chatun geschrieben hatte, "wenn du fortfährst, dich mit deinen Söhnen in die Macht zu teilen, werde ich den Turban von deinem Haupt nehmen".
Nizam war schon 75 Jahre alt und seit 33 Jahren Großwesir. Einen derartigen Ton wollte er nun gar nicht erst einreißen lassen. Kühl sagte er seinem Sultan: "Mein Turban und deine Krone sind einander so sehr verbunden, dass der eine nicht ohne die andere abgenommen werden kann". Und verließ den Raum.
Der Satz war zweideutig; er konnte als demütige Fügung verstanden werden und als Putschdrohung. Melekschah ließ es darauf ankommen. Kaum hatte Nizam den Raum verlassen, erklärte ihn der Sultan für abgesetzt und ernannte zum neuen Wesir den Privatsekretär seiner geliebten Chatun.
Soweit sind sich alle Chronisten einig. Über den weiteren Verlauf des Nachmittags aber streiten die Gelehrten. Nizam sei demütig und untröstlich gewesen, meint Chuandemir und zitiert, was der Wesir über die Vergänglichkeit irdischen Glanzes philosophiert habe. Mirchuand meint, Nizam habe einfach abgewartet, bis der allerhöchste Zorn verflogen sei und er wieder in Gnaden aufgenommen werde. Güside schließlich berichtet, Nizam habe sich zur Moschee begeben, um dort selbst die Chutba auf seinen Namen lesen zu lassen und damit den Staatsstreich einzuleiten. Recht haben könnten alle drei, denn Nizam war ein vielseitiger Mann.
Auf jeden Fall begab er sich am Nachmittag dieses 17. Oktober 1092 in seiner vergoldeten Sänfte zur Freitagsmoschee. Vor deren Toren drängten sich die Gläubigen dichter als sonst, und nicht einmal durch massiven Schlagstock-Einsatz konnten Nizams Leibwächter genügend Distanz zwischen Herrn und Volk wahren. Immer mehr drängten an die Sänfte. Für einen Augenblick verschwand sie sogar in einem Menschenknäuel, und plötzlich wurden gellende Schreie laut.
Sekunden später war der weite Platz menschenleer. Nur an den Ausgängen zu den Basargassen gab es noch einige Handgemenge, und dort lagen auch Tote: Drei Leibwächter und eine Handvoll Unbekannte. Vor dem Portal der Moschee aber stand die goldene Sänfte. In ihr saß Nizam ol-Mülk, in würdiger Haltung, wie sämtliche Chronisten vermerken, und so zerhackt, dass niemand die genaue Zahl der Dolchstiche feststellen konnte.
Am selben Abend noch gab der Hof bekannt, Gefolgsleute des Verräters Hassan ibn Sabbah hätten den gestürzten Wesir so übel zugerichtet, und tatsächlich kursierte im Basar wenige Tage später ein Flugzettel Hassans, in dem er die Verantwortung für das Attentat übernahm, aus privaten Rachegründen. War dem so, hätte ihn die Dame Chatun umarmen müssen, denn sie hatte von der ganzen Sache den Vorteil.
Fünfundzwanzig Tage später, am 11. November, starb dann überraschend der Sultan Melekschah, und wieder soll Hassan daran schuld getragen haben. Zwar sprechen die Hofchroniken von einem Jagdunfall, doch in Konstantinopel schrieb die Kaisertochter Anna Komnena in ihr Tagebuch, als sei sie dabei gewesen: 32 Assassinen hätten den Sultan zur Strecke gebracht, Auftrags dessen eigenen Bruders, eines gewissen Tutusch. Einen solchen Bruder aber hatte Melekschah nicht. So hieß nur der Arzt Sabbahs, und hätte der wirklich den Sultan vergiftet, wäre dies der einzige Giftmord in der langen Geschichte der Assassinen gewesen.
Überhaupt ist äußerst zweifelhaft, ob Hassan ibn Sabbah diese zwei prominentesten Todesfälle, die ihm stets angelastet werden, wirklich inszeniert hat. Sicher ist nur, dass in ihm von nun an die Polizei der Seldschuken den Staatsfeind Nr. 1 gefunden hatte. Wer sich zur Sekte der Ismaeliten bekannte, zu der sich ja Hassan rechnete, war sofort ein gemeingefährlicher Terrorist, und von nun an verbreitete die Staatspolizei in immer neuen Gruselgeschichten den Ruhm der Assassinen.
Zunächst allerdings hießen sie Batiniden. Haschahijum, "Haschisch-fresser", wurden sie erst einen Monat später genannt. Da nämlich fing die Polizei fünf bedenkliche Gestalten, die in ihren Taschen Haschisch hatten und im Kopf wirres Zeug den Anfang der Legende vom Alten vom Berge. Die fünf waren geradezu fanatisch geständig, und wöchentlich erhielten die Neuigkeitenschreiber des Basars, die Journalisten jener Zeit, Vernehmungsprotokolle vom Chef des seldschukischen Verfassungsschutzes.
"Wir werden alle hochgestellten Persönlichkeiten umbringen", hieß es darin und: "Wir erwarten uns dafür das Paradies".
Wer Sympathisanten Hassans der Polizei melden konnte, erhielt hohes Kopfgeld zugesichert. Den fünf bekennungsfreudigen Attentätern aber wurde seltsamerweise nie der Prozess gemacht. Waren die Türken am Ende "Türken", wie es im Journalistenjargon heißt, Schauspieler im Dienste des Polizeiministers? Auf jeden Fall lieferten ihre Aussagen einen Staatsfeind, dem man wirklich alles in die Schuhe schieben konnte. Auch die Inflation, die das Seldschukenreich schüttelte. Im Dezember 1092 wurde die Umsatzsteuer im Land um zehn Prozent erhöht - zum Zwecke besserer Polizeiausbildung und der allgemeinen Sicherheit. In Isfahan kam es daraufhin zu einem Basaraufstand, der blutig niedergeschlagen wurde und an dem natürlich die Assassinen ebenso schuld waren wie an dem langwierigen Bürgerkrieg, den nach dem plötzlichen Tod Melekschahs dessen Söhne untereinander austrugen.
Allerdings wurden die Assassinen in jener Zeit auch wirklich aktiv. Am 5. Dezember besetzten sie in einem Handstreich Schahdürr, die wichtigste Festung vor der Stadt Isfahan. Einen Monat später hatten sie auch die anderen Forts an den Handelsstrassen erobert, und die Hauptstadt der Seldschuken jederzeit von der abschneiden. Zwei Monate später kontrollierten sie dreiundfünfzig Festungen, quer durch das Reich. Die nördlichste Assassinenburg lang bei Täbris, die südlichste eine Wegstunde vor Damaskus.
Für die hohen Herrschaften des Reiches aber begann eine Zeit der nackten Angst. "Unser Leben ist weniger wert als das eines Kupferschmieds, jammerte Otus, der Statthalter von Aserbeidschan. Er hatte einen kurzen Brief Hassans erhalten: Am 3. März um 17 Uhr wirst du ermordet. Otus verschanzte sich daraufhin mit seinen Leibgardisten im Thronsaal. Pünktlich zur angegebenen Stunde zückten vierzig altgediente von ihnen die Dolche.
Bis zum Mai 793 mussten in Isfahan 28 Minister ausgetauscht werden, und keiner blieb länger als zwei Wochen im Amt und am Leben. Ein Großwesir, der letzte überlebende Sohn Nizams, befahl daraufhin, sein gesamtes Personal dürfe nur noch mit Schamlätzchen bekleidet vor ihm erscheinen.
In dieser seltsamen Tracht führten wenige Tage später Offiziere ihrem Herrn neue Pferde vor. Ein edler Hengst bäumte sich auf. Sein Zureiter kraulte dem Tier beruhigend die Mähne, zog die Hand aus dem Rosshaar, hielt darin plötzlich einen Dolch, und dem Wesir war nicht mehr zu helfen.
Assassinen waren überall, und von der Bevölkerung wurden sie zumindest wohlwollend toleriert. Im Christentum wird Untertanentreue stets zu den Tugenden gerechnet im Orient jedoch hat dieses edle Wort zumindest den zweifelhaften Beigeschmack von Opportunismus. Europäer haben nie begreifen können, dass Orientalen auch von ihrem eigenen Staat meist ein ausgesprochenes Feindbild haben und ihn nie als ihren "Beschützer" ansehen, sondern - wenn schon auf der Ebene dieses Bildes - höchstens als räuberischen Zuhälter. Die eigene Sippe, der eigene Stamm gewährt besseren Schutz als der Staat, und mit dieser Einstellung sind auch schon viele Konflikte mit der Obrigkeit vorprogrammiert. Aus diesem Grund nützten auch die immer höheren Belohnungen nichts, die von der Polizei für die Denunziation von Assassinen ausgesetzt wurden - über hundert Jahre lang wurde kein einziger gemeldet.
Andererseits setzten Hassans Jünger auch massiven Terror ein.
Feinde und Verräter aus den eigenen Reihen wurden gnadenlos zu Tode gefoltert.
Im März des Jahres 1109 hörte eine neugierige Frau zu Isfahan Stöhnen in ihrem Nachbarhaus. Sie alarmierte die Polizei, und eine eigens gebildete Sondereinheit drang in der Nacht in das geheimnisvolle Haus ein.
In seinem Vorraum hockten vier Wächter und leisteten so erbittert Widerstand, dass nur einer lebend in die Hände der Polizei fiel. Im zweiten Raum war eine Falltür, darunter ein Labyrinth von Kellergängen.
Der Anblick ließ selbst persische Polizisten erschauern: Über neunzig Leichen wurden gezählt, halbverwest, zerhackt, geschunden. Auch die Wände waren mit Toten tapeziert - hier fanden die Polizisten 51 verschollene Kollegen. Sie waren mit Pfeilen an die Wand genagelt, einige an den Beinen aufgehängt, und alle stanken entsetzlich. Die Mörderhöhle muss gut zehn Jahre lang in Betrieb gewesen sein.
Vier Tage lang hielt die Polizei das Haus besetzt, und wer in seine Nähe kam, wurde ohne Kommentar erschlagen.
Am fünften wollte der Polizeipräsident der Informantin einen Besuch abstatten. Die Frau erwartete den hohen Gast an der Küchenschwelle.
In ihrer Zunge stak ein Dolch mit der Aufschrift: Schweigen ist Gold.
Nachwuchssorgen hatten die Assassinen nie. Aus allen Regionen des Islam kamen Burschen und junge Männer vor ihre Burgen und bewarben sich um Aufnahme. Hassan ibn Sabbah war die Hoffnung aller mit dem herrschenden System Unzufriedener. Seine Sympathisanten saßen an allen Schalthebeln des Staates, und manche schafften den Marsch durch die Institutionen bis zur Spitze - auch zwei Großwesire wurden als Assassinen enttarnt.
Hassans Programm war auch einfach genug zu verstehen und hieß im Volk "dawa gadida", zu deutsch etwa "reine Lehre":
Kein Mensch darf gegen seinen Willen beherrscht werden. Es gilt nur der Zusammenschluss unter freiwillig anerkannten Führern. Wer unter anderen Bedingungen Macht ausübt, ist dem Tod verfallen.
Das derzeitige Staatsleben ist menschenunwürdig. Erst die Ausrottung aller Machthaber und dann der Machtgier wird auf Erden paradiesische Zustände ermöglichen. Wer dafür sein Leben opfert, kommt ins Paradies.
Die künftige Gesellschaft wird kein Privateigentum kennen, sondern in freier Liebe und mit Gemeineigentum leben. Einen Vorschuss auf das Paradies kann der Gläubige von Zeit zu Zeit durch feierliche Kommunion von Haschisch nehmen.
Umgesetzt wurde das edle Programm aber auch von den Assassinen nur sehr teilweise. Ihr eigenes Gemeinwesen ähnelte vielmehr einem Orden mit streng hierarchischem Aufbau. Nach dem Schema, das heute Staatsanwälte für kriminelle Vereinigungen anwenden, waren auch schon die Assassinen organisiert.
Ihre Basis bildeten die "Sympathisanten". Sie stellten ihre Wohnungen Aktivisten zur Verfügung, halfen bei der Beschaffung von Papieren und Informationen, fallweise auch mit etwas Geld. Zu Hassans Zeiten zählten dazu sämtliche Ismaeliten.
Aktivisten hießen "Fidai", Todesengel. Sie bereiteten die Anschläge vor und führten sie nach strengen Regeln aus.
Vom Zeitpunkt der Befehlsannahme an hatten sie sich strikt des Haschischgenusses zu enthalten. "Haschisch macht sanftmütig. Der Dolch trifft dann nicht, da das Herz zu Zärtlichkeiten neigt", hatte Hassans Leibarzt erkannt, und daher ist die auch manchmal von ernsthaften Wissenschaftlern vertretene These, die Assassinen hätten im Haschischrausch gemordet, falsch. Falsch ist auch, dass es die Todesengel bei ihren Unternehmen auf ihren eigenen Tod angelegt hätten. Zu unserem Erfolg gehört, nicht ergriffen zu werden, hatte Hassan formuliert, ähnlich wie einige Jahrhundert später Ulrike Meinhof. Die berühmten Beispiele selbstmörderischer Tollkühnheit ereigneten sich daher meist nur in völlig ausweglosen Situationen.
Erfolgreiche, unerkannt gebliebene Todesengel avancierten zu "Ohren". Sie beobachteten die Ausführung der Attentate und erstatteten Bericht an das jeweilige Organisationskomitee.
Das hieß "Hand" und bestand aus altgedienten Ohren. In jeder Assassinenburg saß eine Hand, in sämtlichen größeren Städten "Finger" als Unterabteilungen. Die Hände suchten aus den Sympathisanten die Todesengel aus, entwarfen mit den Ohren die Einsatzpläne und erstatteten schließlich den Brüdern Bericht.
Die Brüder waren der "harte Kern". Sie bewohnten abgesonderte Bereiche in den Burgen, und in ihrer Gesellschaft verweilen zu dürfen, zählte zu den Wonnen des Paradieses. Sie waren erfahrene Händler, viele von ihnen aber auch anerkannte Wissenschaftler und feinsinnige Dichter. Wer zu ihnen zählen durfte, bestimmten sie selbst durch Abstimmung, und sie waren wohl der exklusivste und elitärste Verein im gesamten Islam.
Alle Assassinen aber sollten einander in Liebe zugetan sein, und
das war durchaus handfest gemeint. Im Lauf ihrer Geschichte stellten die edlen Bürger Mohammeds Moralvorstellungen geradezu auf den Kopf: Beischlaf, ob mit Männlein oder Weiblein, galt als gottgefälliges Werk; das Betrachten der Geschlechtsorgane nicht als Sünde, sondern als Zeichen von Lebensfreude; übermäßiges Waschen wurde als Zeichen von Verklemmtheit angesehen; und der Oralverkehr, dem Propheten ein Gräuel, hatte denselben Sakramentscharakter wie das Knabbern weißer Haschischplätzchen.
Sie waren die Hostien der Assassinen und werden heute noch im vorderen Orient nach Hassans Methode zubereitet : "Man nehme 2 Pfund frischen Hanf sowie gut 1 Pfund Butter und koche dieses langsam und mit reichlich Wasser sechs Stunden lang.
Man schöpfe die Butter nach Abkühlen der Brühe vorsichtig ab und backe damit kleine blasse Kekse. Sie werden unschuldig aussehen, haben jedoch eine umwerfende Wirkung.
Ob Hassan ibn Sabbah selbst Haschischplätzchen geknabbert hat, ist mehr als zweifelhaft. Umstritten ist auch, ob er den berühmten Garten anlegen ließ, obgleich schon wahrscheinlicher. Unter Hassan wurde Alamut, "das Adlernest", durchaus komfortabel ausgebaut, gleichzeitig aber auch zur Musterfestung des Zeitalters abgesichert. In den Felsen ließ der Alte vom Berge ungeheure Vorratskeller hauen. Allein der Getreidespeicher war einhundertfünfzig Meter lang, dreißig Meter breit und acht Meter hoch. Zweihundertfünfzig Jahre später lagerten darin noch 30 Tonnen Weizen aus Hassans Zeiten, und kein einziges Korn war verrottet. Zeitgenossen hielten das für reines Wunderwerk, und auf jeden Fall können wir daraus auf ein erstklassiges Belüftungssystem schließen und dass Hassan sich bei seinen Bauten hervorragender Fachleute bediente. Neben dem Getreidespeicher lang eine Zisterne, gefüllt mit 4.000 Kubikmetern Honig, und eine weitere, in der später Wein gelagert wurde, was Hassan bestimmt ein Gräuel gewesen wäre.
Denn Hassan ibn Sabbah war ein unerbittlicher Moralist, über dies auch ein Asket und gewiss eine der erstaunlichsten Charaktertypen der Geschichte. Mag sein, dass seine langen, unsteten Wanderjahre in ihm die Sehnsucht nach einem festen Platz übergroß werden ließen - als er Alamut besetzt hatte, verließ er die Festung nie wieder. Nicht einmal die Bauten, die er auf Alamut errichten ließ, besah er: Von 1090 bis zu seinem Tod 1124 war sein ganzer Lebensraum ein Turmzimmer von vier mal fünf Metern. Der Alte vom Berge muss ein schrecklicher Puritaner gewesen sein. Nicht einmal auf Aussicht legte er Wert die Fenster lagen knapp unter der Decke der Kammer, drei Meter hoch. Die gesamte Einrichtung bestand aus einer Wasserkanne mit Waschschüssel und Becher, einem Deckeleimer für die Notdurft und einem erbärmlich dünnen Kotzen, auf dem Hassan schlief und betete. Die Wände waren weiß gekalkt, und nur ein kleiner, schwarzer Punkt markierte die Gebetsrichtung Mekka.
Soviel Luxus Hassan seinen Leuten auch gönnte - sich selbst setzte er auf Isolationshaft und duldete in seiner Nähe weder Musik noch Gelächter. Selbst bei schneidender Kälte blieb sein Raum ungeheizt, blieben die Fenster unverglast, und noch als Vierundachtzigjähriger las, schrieb und diktierte er, nur von Gebeten unterbrochen, von vier Uhr morgens bis ein Uhr nachts. Nachweislich verließ er seine Turmkammer erst als Leiche. Ein Chronist schreibt: "Er saß in seinem öden Loch wie eine furchtbare Spinne, und er hielt alle Fäden in seiner Hand. Er sah und hörte nichts und wusste doch alles, auch die kleinste Regung in fernen Ländern".
Das mag vielleicht etwas übertrieben sein, aber tatsächlich wurden die Assassinen ein Staat im Staat und waren besser organisiert als dieser. Ein Reich aber wollte Hassan auf keinen Fall daraus werden lassen. Er hatte vier Söhne von seiner lang verstorbenen Ehefrau. Historiker berichten, dass er sie zärtlich liebte, und daran ist nicht zu zweifeln. Als jedoch gegen Ende seines Lebens öffentlich diskutiert wurde, Hassans Macht einmal an seine Söhne zu vererben, ließ er sie ohne Gefühlsregung hinrichten. Wir sind nicht gegen die Tyrannen mit Erbrecht aufgestanden, um dasselbe zu tun, war sein einziger Kommentar, und dass es ihm damit ernst war, bewies er ja auf diese schreckliche Weise.
Nach allem, was wir von Hassan wissen, hoffte er, seine Assassinen würden nach seinem Tod die vollkommene Demokratie praktizieren. Doch dafür war weder die Zeit reif noch seine engsten Vertrauten. Nach Hassans Tod ernannten die Brüder einstimmig Hassans Sekretär Büsürgumid zum neuen " Alten vom Berge" und "Großmeister der Batiniden". Und er ging ernsthaft daran, aus dem Gemeinwesen eine Art Staat zu formen.
Dabei war er überaus erfolgreich. Mit zahlreichen Fürsten schloss er Verträge ab, und die erklärten gerne auch ein Stück eigenes Land zu ismaelitischem Territorium, wenn sie dafür nur ihres Lebens sicher waren. Andere zahlten den Batiniden aus demselben Grund hohe Tribute.
Als wirkungsvollstes Erpressungsmittel erfand Büsürgumid die heute noch sprichwörtlichen "schwarzen Listen". Zu seiner Zeit waren sie tatsächlich schwarz und mit weißer Tusche beschrieben. Daher fielen sie sofort an den Basaren auf, wo sie aushingen. Sie wurden aufmerksam studiert - wer seinen Namen darauf fand, konnte mit baldigstem Ableben rechnen, es sei denn...
Und so flossen gewaltige Summen nach Alamut.
Diese Praxis allerdings kostete den Orden die Sympathien des Mittelstandes. Um die hohen Brüder in Alamut ausreichend zu schmieren, saugten die Provinzfürsten ihre Untertanen bis aufs Blut aus. Die "Batinidensteuer" erwies sich als wirkungsvollere Propaganda als sämtliche Gräuelmeldungen.
"Batiniden" nannten sich die Brüder, weil sie im Koran zwischen den Zeilen auch noch einen "batin" entdeckt hatten, einen "inneren Sinn". Damit waren der Mystik Tür und Tor geöffnet, und die Ismaeliten wurden zu einer extremen Randgruppe des Islam, im Bereich der christlichen Sekten etwa den Mormonen vergleichbar. In den Korandeutungen der Assassinen ließen sämtliche bekannten Philosophien grüßen, und am meisten die Gnosis: die Welt im Spannungsfeld zwischen Gut und Böse. Zweifellos haben die Brüder da bei Maimun und den Karmaten getankt, doch während jene daraus eine Vorform des dialektischen Materialismus ableiteten, verschwammen die Schlussfolgerungen der Assassinen in ziemlich krauser Mystik, höchstens als Vorwand für nackte Machtpolitik zu gebrauchen.
Der verblichene Hassan muss bei dieser Entwicklung im Grab rotiert haben, und bereits 1126 hielt es Büsürgumid für geboten, die Entfernung vom Gedankengut des alten Alten auch räumlich zum Ausdruck zu bringen. Unweit von Alamut ließ er ein neues Schloss erbauen, nur etwas weniger massiv befestigt, aber von unglaublich luxuriösem Innenleben. Als Meimundiz, das "Schloss der Glücklichen", ist es berühmt geworden.
Büsürgumid konnte sich’s leisten, bei den Verteidigungsanlagen zu sparen. Gegen die Assassinen war mit Waffengewalt nicht an zukommen, und das sahen bald alle Fürsten ein. Die Seldschuken hatten Alamut von 1092 bis 1118 belagert, ergebnislos und mit großen Verlusten. Von 1130 bis 34 versuchten sie’s noch einmal und erreichten nur, dass der Generalstab infolge ständiger Mordanschläge laufend erneuert werden musste. Von da an beschränkten sich Auseinandersetzungen mit dem Staatsfeind auf den Konferenztisch. Büsürgumid hatte erreicht, dass seine Rebellen zu den ausländischen Mächten gezählt wurden wie Rom und Konstantinopel. Dementsprechend fühlte er sich wie ein Reichsgründer und vererbte bei seinem Tod im Jahr 1138 das Ganze unwidersprochen an seinen Sohn Mohammed.
Die Fatimiden in Ägypten allerdings grollten. Hassan war von ihnen durchaus nicht uneigennützig ausgerüstet worden. Sie hofften vielmehr, der alte Fuchs werde in Persien den Boden für eine fatimidische Machtübernahme vorbereiten. Daraus aber war nun nichts geworden, und spätestens mit Mohammed wurde aus den einst freundlichen Kontakten eisige Feindschaft. Interessant je doch wurden die Assassinen für eine neue Macht, die sich um diese Zeit im Nahen Osten breit machte: Die Christen. Sie hatten den Seldschuken so ziemlich die gesamte Mittelmeerküste entrissen, nannten sich Kreuzfahrer und betrieben nackte Kolonialpolitik.
Seltsamere Bundesgenossen hat wohl kaum ein gemeinsamer Gegner zusammengetrieben. Die Seldschuken erreichten - zugegebenermaßen sehr gegen ihren Willen -, dass sich der christliche Templerorden mit dem Orden der Assassinen schon fast innig befreundete, und dabei konnte jeder vom anderen viel lernen. Selbstverständlich spielten sich die meisten Kontakte auf höchster Geheimnisstufe ab, und so sind Historiker meistens auf Vermutungen angewiesen. Doch zahlreiche Kreuzritter rühmten ganz offen die grandiose Gastfreundschaft auf Alamut und Meimundiz und garnierten ihre Berichte mit Details, die sie nur durch persönlichen Augenschein erfahren konnten.
Manchmal stachen die Assassinen auch zu. 1152 wurde der "Graf von Tripolis" erstochen, ein wilder Christlicher Abenteurer. Angeblich nur, weil er Christ war. Den Vorteil des Mordes aber hatten eindeutig Christen, und so wurde die Bluttat schon bald und unwidersprochen als Freundschaftsdienst dem Templerorden gegenüber interpretiert. Die jahrhundertealte Streitfrage, ob Templer oder Assassinen die kriminellste Vereinigung der Geschichte sind, kann infolge Chancengleichheit beider Gruppen wohl nie beantwortet werden.
Den Assassinen zumindest wurde nach diesem Attentat nicht Abscheu zuteil, sondern vielmehr bewundernder Respekt. Ehrfürchtig titulierten Christenfürsten den Assassienchef " Alter vom Berge", wenn auch meist mit dezentem Schauder.
Die bemerkenswerteste Persönlichkeit auf Meimundiz war Hassan II., der Sohn und Erbe Mohammeds. 1162 wurde der Fünfunddreißigjährige Großmeister der Assassinen, und zu seinem 37. Geburtstag und Hassan ibn Sabbahs 40. Todestag lud er zahllose Getreue zu einem Picknick vor Alamut.
Es war ein grandioses Fest. Beinahe 200.000 Quadratmeter frisch grünender Rasenziegel bedeckten die kahle Erde vor der Festung, und darauf strahlten die schneeweißen Zelte der Assassinen mit den grellroten Bannern. Tausende Blumen dufteten, als Hassan in einem langen, weißen Gewand aus dem Tor der Festung schritt. Fünfhundert Silbertrompeten schmetterten, als Hassan feierlich den Anbeginn des Paradieses verkündete, die Geburtsstunde der ewigen Gesetzlosigkeit und die freie Vereinigung aller Menschen freien Willens. Und dann verkündete Hassan eine noch größere Sensation: Er selbst sei der verheißene Mahdi.
Nicht alle Assassinen teilten diese Meinung. Als der Rausch des Festes verflogen war, zerriss diese Streitfrage den Orden in zwei Parteien. Um weitere Diskussionen zu vermeiden, stieß zwei Jahre später ein Schwager des Messias einen Dolch in dessen Bauch. Eine Stunde später wählten die Brüder den neunzehnjährigen Sohn Hassans als Mohammed II. zu ihrem Großmeister.
Der Junge wusste nicht, wie ihm geschah, und auch nicht, wie viele seiner eigenen Verwandten in das Ende seines Vaters verwickelt waren. Sicherheitshalber ließ er alle umbringen, und das war vielleicht ganz gut, denn er blieb immerhin 44 Jahre lang unangefochten Alter vom Berge. Die Ideen seines Vaters schneiderte er auf seine eigene Größe zurecht, und auch dabei verfuhr er glücklich und wurde von sämtlichen Assassinen anerkannt. Vor allem aber dehnte er den Einfluss seines Ordens bis Europa aus.
In Venedig entpuppten sich viele Kaufleute, die als Kriegslieferanten der Kreuzfahrer reich geworden waren, als Assassinen. Der Privatsekretär des Babenbergerherzogs Leopold von Österreich und vier Herren aus Nürnberg wurden als Assassinen geköpft.
In Florenz wurde der Tochter des reichsten Bankiers im Bett der Kopf abgeschnitten. Der arabische Hausarzt wurde als Assassin enttarnt und verbrannt - das gruselige Motiv inspirierte Wilhelm Hauff zu seinem Märchen "Die abgehauene Hand".
Am meisten Aufsehen erregte jedoch eine Affäre, die sich 1192 zu Akko im Heiligen Land ereignete. Dort wurde ein gewisser Konrad von Montferrat zum "König von Jerusalem" gewählt.
Dem englischen König Richard Löwenherz passte das gar nicht, und er begann einen wilden Werbefeldzug gegen Konrad.
Der aber wurde eine Woche vor seiner Krönung von zwei als Mönchen verkleideten Assassinen erstochen. Für sämtliche Zeitgenossen war dies ein Mord auf Bestellung, zumal Richard Löwenherz am selben Tag zwei Millionen Mark bei der "Bank des Vertrauens" in Damaskus auf das Konto des Alten vom Berge einzahlen ließ.
Die Sache hatte ein Nachspiel. Bei der Rückkehr in das Abendland wurde Richard Löwenherz nahe Wien verhaftet und an den deutschen Kaiser ausgeliefert. Heinrich VI. wollte seinem königlichen Kollegen einen Kriegsverbrecherprozess machen, und Konrads Tod gehörte zu den Anklagepunkten. Da aber flatterte ein Brief des Alten vom Berge in das Reich: Es sei eine Unverschämtheit, ihm zu unterstellen, er hätte Konrad des Geldes wegen und im Namen eines christlichen Auftraggebers umlegen lassen. Obwohl nicht nur das, sondern auch die Echtheit des Schriftstücks erheblich angezweifelt wurde, war dass das Schlusswort der Geschichte.
Tatsächlich war zu diesem Zeitpunkt die Organisation der Fidai schon ziemlich verkommen. Die Todesengel stachen meist nur gegen Bares zu und verdienten sich ihr Zubrot auf dem Hehlermarkt, mit Erpressungen oder Falschspiel.
Die hohen Brüder in Alamut waren dagegen machtlos. Ihre Organisation begann auch vom Kopfe her zu stinken, und in Syrien machten sich auch schon einzelne "Hände" selbständig. Der langlebige Mohammed wurde vermutlich von seinem ungeduldigen Sohn und Erben vergiftet, und auch die letzten zwei Großmeister starben keinen natürlichen Tod.
Das Ansehen der Assassinen sank rapide, und die gläubigen Ismaeliten wollten mit den Fidai bald nichts mehr gemein haben. Die aber organisierten sich selbst zu Kleinunternehmen mit eindeutig krimineller Zielsetzung. In dieser Form haben Sie sich bis heute gehalten, und häufig vererbt sich das anrüchige Gewerbe von Vater auf Sohn. Die Fiddi, von denen ich einige in Tanger beobachten durfte, sind ebenso ihre Nachkommen wie die Daidschi in Persien, die derzeit Opiumhandel en gros betreiben, und die Fejji Arabiens, denen man heute noch Menschenhandel nachsagt.
1248 distanzierten sich die hohen Brüder von Alamut und Meimundiz feierlich von den Gaunerbanden.
Das Ende kam aus dem Osten. Dort war eine neue Weltmacht entstanden und expandierte ebenso schnell wie einst der Islam. 1253 zog der Mongolenkhan Hulagu einen weiten Belagerungsring um Alamut und Meimundiz. Zwei Jahre lang schien es, als würden die Mongolen ebenso erfolglos abziehen wie sämtliche Belagerer zuvor. Die Zivilbevölkerung der Umgegend hielt immer noch freiwillig den Kontakt zwischen Festung und Hinterland, und da konnten auch die Mongolen nicht gefährlich werden. Auch Platzangst hätten die Belagerten nie bekommen können - Alamut allein bedeckte zu jenem Zeitpunkt etwa sechs Quadratkilometer.
Bedenklich war nur, dass der Großmeister, Mohammed III., von all dem gar nichts mitbekam. Er war, gelinde gesagt, freundlich verblödet, oft wochenlang nicht einmal ansprechbar, und in seinen hellen Momenten interessierte er sich höchstens für das Weiden von Ziegen und einen gut gebauten Hirtenjungen. Dementsprechend war aus der Gesamtorganisation ein in Parteien zerfallener Haufen Intriganten geworden. Und das war tödlich.
An einem Sommertag des Jahres 1255 weidete der Großmeister der Assassinen am Fluss von Meimundiz seine Ziegen, als sein Geliebter mit einem Beil seinem Liebhaber das Haupt spaltete und den Assassinen den Todesstoss versetzte.
Denn Kwarschah, der nun Großmeister wurde, war ein hilfloser, idealistischer Junge und damit genau der falsche Mann für die Stunde. Die Bevölkerung, auf deren Unterstützung er angewiesen war, verließ ihn, und nun setzte Khan Hulagu zum Endkampf gegen die Sekte an.
Die Festungen der Assassinen hat er nicht erobert. Meimundiz wurde ihm kampflos übergeben, und ein Treppenwitz der Weltgeschichte wollte, dass hier tatsächlich ein schlechter Schriftsteller Geschichte machte. Rukneddin hieß er, war von den Seldschuken als untalentiert des Landes verwiesen worden und zu den Assassinen gestoßen, racheschnaubend und in der Hoffnung, anerkannt zu werden. Aber auch dort schätzte ihn Kwarschah, der kindliche Alte vom Berge, nur seiner Figur wegen, und das war Rukneddin zu wenig. Die Mongolen aber schienen wahre Ästheten zu sein, denn Hulagu erklärte, er sei vom dichterischen Werk Rukneddins begeistert und versprach, es in 15.000 Exemplaren für seine Truppen vervielfältigen zu lassen.
Daraufhin setzte Rukneddin seinen schönen Rücken ein, und Kwarschah übergab an einem Sommermorgen des Jahres 1257 Meimundiz den Mongolen.
Im Lager des Khans wurde der Großmeister ehrenvoll aufgenommen und zog von nun an mit den Mongolen vor die zahlreichen Assassinenburgen, um seine Mitbrüder zur Kapitulation aufzufordern. Alamuts Kommandant weigerte sich und handelte eigene Übergabebedingungen aus: Drei Tage lang durften seine Leute mit allen liebgewordenen Siebensachen abziehen, und am vierten besetzten die Mongolen das Adlernest.
Sieben Wochen brauchten die Mongolen, um alle Schätze abzutransportieren, die sich in 267 erfolgreichen Assassinenjahren angesammelt hatten. Die berühmte Bibliothek aber schenkten sie Rukneddin. Der legte zehn Koranbände zur Seite und drei mit eigenen Werken, die er den Brüdern geschenkt hatte und die ungelesen in einem Regal verstaubten. Den Rest ließ er verbrennen, fast eine Million Bücher, durchwegs unersetzbare Handschriften.
Kwarschah wurde ein begeisterter Bewunderer der Mongolen. Solange er Festungskommandanten der Ismaeliten zur kampflosen Kapitulation überreden konnte, wurde er von ihnen auch gut behandelt, und da war ihm egal, was mit seinen Glaubensgenossen geschah. Der lange gegen die Assassinen aufgestaute Hass entlud sich nun in allen Ismaeliten. Eine gnadenlose Verfolgung setzte ein - allein 1257 wurden rund 80.000 Ismaeliten erschlagen - und dementsprechend folgte eine Massenflucht. Zahlreiche Gläubige konnten sich nach Indien retten, viele flohen nach Afrika, und ihr letzter Großmeister hatte nur einen dringenden Wunsch: Er bat, ins tiefe Asien ziehen zu dürfen, um dort dem Großkahn seine Aufwartung zu machen. Er durfte, und während der Reise wurde er an einem kleinen Flüsschen als lästiges. Anhängsel der Delegation mit Knüppeln erschlagen.
Die Nachkommen dieser Jammergestalt aber wurden auch in Zukunft von den Ismaeliten als Oberhaupt anerkannt. Einer von ihnen nahm schließlich einen mongolischen Titel an, und seither heißen die Erben der Assassinen Aga Khan. Unter diesem Namen hat sich die Sippe bis heute gehalten, und der augenblickliche Nachfolger des Alten vom Berge betätigt sich vorwiegend als Paradefigur des Jet-Set und Grundstücksspekulant an der Costa Smeralda im Mittelmeer.
Südlich davon, in Sizilien, organisierten etwa um 1.300 ehrbare Christen einen Nachfolgeverein der Fidai. Den Aufbau der Todesengel- Hierarchie übernahmen sie von Hassan ibn Sabbah, die Praktiken jedoch aus der üblen Endzeit des Ordens. Die Welt kennt diese Vereinigung als Maffia. Ihre erfolgreichste Zweigstelle ist in den USA, und sie beherrscht mittlerweile auch hierzulande den Handel mit Haschisch.
Alamut ist keine Reise wert. Hulagus Mongolen machten gleich nach der Plünderung die wichtigsten Befestigungsanlagen dem Erdboden gleich und hinterließen eine kleine Garnison in einer schwachen Festung. Achtzehn Jahre nach dem Ende des Ordens, 1275, konnten vierzig Assassinen die legendäre Burg noch einmal erobern und das rote Banner auf ihre Zinnen pflanzen. Doch nach nur drei Wochen wurde das Adlernest endgültig zerstört. Generationen von Schatzsuchern haben seitdem die historischen Trümmer durchwühlt und fast nichts gefunden. Eine silberne Wasserpfeife liegt samt einem kleinen Kupferdöschen für Haschisch im Metropolitan Museum in New York, gefunden in der einstigen Jauchengrube von Meimundiz, einige Kilometer weiter. Ein Tonteller mit bunten Kriegern aus Alamut wird in Paris verwahrt, und viel mehr ist von den Assassinen nicht geblieben.
Herzklopfen hatte ich allerdings, als ich zu der sagenhaften Burg hochstieg. Teilweise lag es an dem unheimlichen Gebräu meines Gastgebers vom Vorabend. Zum Abschied erzählte er mir mit vielen kehligen "Hulagus" und wilden Gesten, dass sein Dorf an genau der Stelle lag, wo einst der Mongolenkhan seine Zelte aufgeschlagen hatte. Der Weg nach Alamut dauerte von dort nur zwei bequeme Wegstunden.
An einem klaren Frühlingsmorgen suchte ich das Paradies des Alten vom Berge. Von den Ringmauern stehen noch die Fundamente, durchwegs sechs Meter stark. Über vier muss man klettern, und dahinter liegt ein riesiges Trümmerfeld, aus dem ab und zu sorgfältig behauene Steine ragen. Nach einer Stunde hatte ich auch das künstliche Paradies gefunden, von dem Marco Polo berichtete: Ein kleines Plateau in dem zerklüfteten Gelände, eindeutig künstlich angelegt und von Schutthaufen gesäumt. Mit einiger Phantasie kann man sich den Garten vorstellen, und ein kleiner, längst vertrockneter Kanal ist auch noch zu sehen. Das Paradies war ungefähr halb so groß wie ein Fußballplatz.
|
|
Die Christen kommen
|
|
|
Der Aufbruch Europas
Ursache der Kreuzzüge war, dass die christlichen Ritter Mitteleuropas nicht mehr mit ansehen konnten, wie ihre Glaubensgenossen im Heiligen Land von den Muslims unterdrückt und gequält wurden. Das wird heute noch in den meisten Schulen gelehrt und ist mit Sicherheit falsch. Falsch allerdings wäre auch, nach einem Anlass für dieses größte Abenteuer des jungen Abendlandes zu suchen. Schon der erste Kreuzzug hatte nicht ein auslösendes Moment, sondern gleich viele.
Mit Zukunftsplanung hat sicherlich kein abendländischer Fürst des frühen Mittelalters seine Zeit vertrödelt. Karl der Grosse hatte aus den zahllosen germanischen Stammesfürstentümern ein Reich geschaffen, das etwa der heutigen (1978) EWG entsprach und ebenso einheitlich war. Karl träumte noch von einer Neuauflage des Imperium Romanum, doch nach seinem Tod zerfiel das gewaltsam zusammengeschweißte Gebilde rasch zu einem "Europa der Vaterländer", und mit schöner Ausdauer stritten sich deutsche und französische Könige darum, wer in dem wirtschaftlichen Großraum der Erste sei. Eine knifflige Frage, denn im deutschen Raum. lagen die größeren Reserven damals gefragter Rohstoffe, und Frankreich hatte die bessere Verarbeitungsindustrie. Das änderte sich erst unter einem tüchtigen Sachsen, der als Otto der Grosse in die Geschichtsbücher einging und als Erfinder des sprichwörtlichen und international berüchtigten "deutschen Fleißes" gelten kann. Ottos Siege gegen die Ungarn haben meist den Blick verstellt auf die wirtschaftlichen Aktivitäten des Sachsenkaisers, die im Grunde wesentlich bedeutender waren. Er bemühte sich um die Autarkie seines Landes, und die von ihm gegründeten Klöster waren eigentlich stets Manufakturen, Vorposten industrieller Fertigung. Dass der deutsche Raum in seiner Zeit eine erste wirtschaftliche Blüte erlebte, hat ihm den großen Beinamen eingetragen, denn davon hatten seine Untertanen mehr als von den Siegen auf Schlachtfeldern. Von Dauer aber war Ottos Wirtschaftswunder nicht. Sehr bald sorgte eine Falschmeldung für Stagnation: Für das Jahr 1000 war der Weltuntergang angesagt, und da selbst der Papst daran glaubte, wurde dass Gerücht auch für sämtliche Christen Gewissheit. Wozu aber sollte man sich noch anstrengen, wenn ohnehin anno tausend alles für das Jüngste Gericht war?
Fast hätte daher der Weltuntergang in Europa tatsächlich statt gefunden. In dem Schicksalsjahr wurde nur etwa ein Zwanzigstel aller Felder bestellt, und allein im norddeutschen Raum verhungerten an die 20.000 Menschen. Für den Papst aber trug die verhängnisvolle Falschmeldung reiche Früchte: Da Irrationalität stets der schönste Nährboden des Christentums war, barsten die Kirchen vor Gläubigen, und das Wort des Papstes galt wieder mehr als das des Kaisers. Das war wohl auch der Zweck des Ganzen, denn bei den deutsch-französischen Querelen war der Mann Gottes arg in den Hintergrund geraten und samt seinem Kirchenstaat zu einem Spielball der wirtschaftlichen Großmächte geworden.
Der Aufschwung nach dem Weltuntergang dauerte seine Zeit. Erst um 1070 hatte Deutschland Wieder den Lebensstandard er reicht, den der große Otto den Seinen schon nach fünfjähriger Regierung hatte bieten können. Damit begannen die Konflikte mit dem Papst von neuem. In Büchern wird dieses Ereignis als "Investiturstreit" bezeichnet - es ging um die Vorherrschaft in Europa. Unter dem Schlagwort "Erneuerung der Kirche" wollte der Nachfolger Petri zu Rom auch die weltliche Richtlinienkompetenz für den gesamten Einflussbereich des Christentums an sich reißen, und seine Chancen waren nicht einmal schlecht. Christliche Untertanen sind durch die Bibel sowohl Kaiser als Kirche zur Loyalität verpflichtet, und Kraftproben zwischen diesen beiden Mächten waren immer Zerreißproben für den Staat. Das Superspiel zwischen weltlicher und geistlicher Macht wurde nie entschieden. Martin Luther war nur eine Figur darin, der Dreißigjährige Krieg eine katastrophale Episode, Bismarcks Kulturkampf ein zweifelhaftes Unentschieden. Im Jahr 1077 hatte der Papst dabei vorübergehend den längeren Atem. Deutschlands Analphabeten fühlten sich der Kirche mehr verbunden als dem Kaiser, Deutschlands Fürsten wollten aus dieser Situation privates Kapital schlagen, und so musste Deutschlands Kaiser bei seinem berühmten Canossagang zunächst einmal klein beigeben.
Damit war die Sache natürlich keineswegs ausgestanden. Kurz darauf schon bannte der Papst wieder den Kaiser und den König von Frankreich gleich mit, doch diesmal krochen die aus der Kirche verstoßenen Fürsten weder zu Canossa noch anderswo zu Kreuz sie hatten die innenpolitische Ruhepause geschickt zu einer Stärkung ihrer Positionen genützt.
Nun grübelten die Prälaten zu Rom darüber, wie sie mit einer geschickten Machtdemonstration beweisen könnten, dass der Papst unter der ritterlichen Führungsschicht doch die größte Anhängerschaft habe.
Hinzu kamen die verwickelten Beziehungen zu Konstantinopel, dem "Reich der Romäer" oder "Romania", wie es in Mitteleuropa hieß. Sowohl der Kaiser als auch Frankreichs König unterhielten gute diplomatische Beziehungen zu der vergreisenden Supermacht. Um dieses zu beweisen, hatten sie sogar Töchter der diversen Kaiser Konstantinopels geheiratet. So musste sich auch der Papst um ein freundschaftliches Verhältnis mit dem "zweiten Rom" bemühen, und als Ansatzpunkt ergab sich, dass Konstantinopel stets Hilfstruppen gegen die Muslims brauchte.
Außerdem hatten sich Europas Feudaladlige so fleißig vermehrt, dass eine weitere Erbteilung der Rittergüter aus ihnen zwangsläufig Kleinbauern gemacht hätte. Die Herren Frankreichs und Deutschlands waren tatsächlich ein Volk ohne Raum, und diesen Zustand gedachte der Papst weise zu nutzen.
Als gezielte Provokation reiste Papst Urban II. auf französisches Hoheitsgebiet, ließ sich dort wie ein Landesvater huldigen, und zog schließlich am 26. November 1095 zu Clermont eine grandiose Schau ab. Genialer wurde politische Massenhysterie nie wieder angeheizt, und Hitlers Propagandaminister Goebbels soll die Rede des Papstes studiert haben, ehe er in den Berliner Sportpalast ging und für seinen totalen Krieg ein heulendes Ja einholte. Auch der Papst rief zum totalen Krieg auf, und sämtliche spontane Reaktionen waren für diese Massenveranstaltung bis in Detail geplant, einschließlich der nicht enden wollenden "Deus le volt - Gott will es" - Rufe, die nun durch ganz Europa brausten. Gott wollte den Krieg gegen die Heiden, die christliche Pilger so schamlos quälten und ganz nebenbei mit ihren Luxusgütern auch schuld daran waren, dass Europas Zahlungsbilanz trotz aller wirtschaftlichen Kraftakte stets negativ blieb.
Die Gräuelmeldungen waren erfunden - nach Jerusalem hatte sich im Lauf des letzten Jahrhunderts ein beachtlicher Tourismus entwickelt, und die Pilger wurden meist nur bei den Visa zur Kasse gebeten. Das andere aber stimmte, und vor allem lag im Südosten Lebensraum... Zahllose Ritter hefteten sich kleine Tuchkreuze ans Gewand und beschlossen, sich irdische Güter im Heiligen Land zu holen.
Womit der Papst nicht gerechnet hatte war, dass auch unter der nichtadligen Bevölkerung Kinder geboren wurden und auch da mittlerweile größere Kapazitäten entstanden waren, als das Land und die Wirtschaft verkraften konnten. Obwohl es der Papst und somit auch Gott nicht wollte, brachen die Armen als erste ins Heilige Land auf, begleitet von zahllosen Nutten, Zuhältern und sonstigen Gaunern. Ihr Held war ein verlauster und verdrehter Einsiedler namens Peter von Amiens, und das Kapital für ihre Reise bezogen die guten Christen aus den Judengemeinden Europas, die sie - Gott will es - brutal plünderten. Damit kamen sie immerhin bis Kleinasien, und dort wurden sie dann ohne viel Mühe von seldschukischen Truppen erledigt.
Auch moderne Geschichtsbücher registrieren diesen proletarischen Exodus höchstens als nullten Kreuzzug. Der erste und würdig, als solcher bezeichnet zu werden, war ein hochadeliges Unternehmen und brach einige Wochen später auf, im Jahr 1096. Raimund von Toulouse war einer der Anführer, und einer seiner Nachkommen hat als Henri Toulouse-Lautrec mit seinem Zeichenstift Pariser Chansonetten und Halbweltdamen unsterblich gemacht. Ahnherr Raimund holte sich im Nahen Osten die Syphilis, immerhin aber auch ein beachtliches Stück Mittelmeerküste, die Grafschaft Tripolis. Erfolgreicher noch war sein Landsmann Gottfried von Bouillon. Seine Divisionen erstürmten am 15. Juli 1099 nach fünfwöchiger Belagerung die Heilige Stadt Jerusalem.
Bereits der erste Gala-Auftritt europäischer Mächte im Nahen Osten war beispiellos. Die islamischen Eroberer waren gewiss nie zimperlich gewesen, doch selbst ihre brutalsten Haudegen entsetzten sich darüber, wie die christlichen Ritter in Palästina hausten. Für die Kriegsführung des Islam galt als eisernes Prinzip, auch in Schlachten Menschenleben tunlichst zu schonen, und daher wurden auch die gewaltigsten Massenaufmärsche meist nur durch Zwei- und Gruppenkämpfe entschieden. Siegreich war, wer den gegnerischen Anführer gefangen nehmen oder töten konnte, und flüchtende Gegner niederer Ränge zu erschlagen, galt als ehrenrührig. Meist wurde nur großangelegtes Kidnapping betrieben, und die Kriegsbeute war eigentlich Lösegeld. Selbst für die Plünderung eroberter Städte galten feste Regeln.
Schließlich sollte nur neuer Wirtschaftsraum gewonnen werden, und Toleranz anderen Religionen gegenüber gehörte zur eisernen Praxis des Islam.
Die Christen aber ließen sich auf derlei Feinheiten gar nicht erst ein. Gottfrieds Tagesbefehl bei der Eroberung Jerusalems lautete wörtlich: Pardon wird nicht gegeben, Gefangene werden keine gemacht, und dieser grauenvolle Spruch gehört ja seitdem zum Standardrepertoire abendländischer Brutalität.
Jerusalem, die Heilige Stadt, in der der sanfte Jude Jesus starb, wurde achtzehn Stunden lang von den Streitern Christi geplündert. Dabei wurden über 35.000 Zivilisten erschlagen, darunter etwa 12.000 Frauen und mehr als 6.000 Kinder. 5.400 Juden wurden in ihrer Hauptsynagoge bei lebendigem Leib verbrannt. Nicht einmal ein Fünftel der Bevölkerung Jerusalems überlebte das Massaker.
Beim anschließenden Gottesdienst am Heiligen Grab wurde das eroberte Land feierlich der Hoheit des Papstes unterstellt und Gottfried zum "Beschützer des Heiligen Grabes" ernannt. Er blieb es nicht lange. Schon ein Jahr später taufte sein Bruder Baudouin sich und das Territorium neu: Er wurde der erste "König von Jerusalem".
Im Volksmund Europas aber wurde das Gebiet Outremer genannt, Außenposten, und als erste Kolonie christlicher Mächte angesehen.
Outremer begann an der heute türkischen Mittelmeerküste als schmaler Streifen mit dem Namen Königreich. Das syrische Küstenland war als Fürstentum Antiochia eingetragen, und das syrisch-irakische Hinterland firmierte als Grafschaft Edessa. Der südlich anschließende Küstenstreifen war die Grafschaft Tripolis, und dann begann mit Beirut das Königreich Jerusalem. Es umfasste den Süden des Libanon, vor allem aber die neuralgischen Punkte der heutigen Weltpolitik: die Golan-Höhen, einen Zipfel von Jordanien, das heutige Israel, den Gaza-Streifen und den Golf von Akaba.
Zu den Zeiten der Kreuzfahrer war das Gebiet ziemlich Juden frei. Die Juden, die dort mit Arabern in friedlicher Koexistenz lebten, wurden von den Christen erschlagen. Vor der Eroberung war Palästina ein blühendes Wirtschaftsgebiet. Syrisches Glas zählte zu den Markenartikeln der Welt, und um Jerusalem hatten sich Textilfabriken bereits auf die Herstellung von Massenkonfektion spezialisiert.
Etwa 80 % aller Betriebe wurden im ersten Blutrausch der Kreuzfahrer dem Erdboden gleichgemacht, vor allem die Textilfabriken, an deren Zerstörung den flandrischen Tuchwebern so viel lag. Später allerdings wurden die islamischen Facharbeiter am Leben gelassen und nur als Leibeigene betrachtet. Der Außenhandel mit Europa brachte den Kolonialherren Palästinas immerhin pro Jahr an die siebzig Millionen Mark ein. Noch mehr aber verdienten die Kaufleute Venedigs als Zwischenhändler, und sie waren auch die besseren Rechner: Für sechs Kilo Edelsteine beispielsweise erwarb eine venezianische Firma von einem Kreuzfahrer-Fürsten ein Sortiment von dreihundert syrischen Glasarbeitern. Die wurden schnell außer Landes gebracht - denn auch die Edelsteine waren syrisches Glas und auf der kleinen Insel Murano vor Venedig interniert. Von da an bestimmte die Lagunenstadt den Markt dieser ebenso kostbaren wie zerbrechlichen Waren.
Den Muslims war der Kreuzfahrerstaat ebenso ein Pfahl im Fleisch wie der heutige Staat Israel. Interessanter weise werden die beiden von arabischen Historikern immer wieder verglichen, und nicht ganz zu Unrecht. Beide Staatsgründungen erfolgten gegen die angestammte Bevölkerung, wobei vor den Kreuzzügen allerdings mehr Christen in Palästina lebten als Juden im Jahr 1947. Auch der Zionismus Theodor Herzls unterscheidet sich nicht sehr von Philosophien der Kreuzfahrerzeit. Eine Pikanterie ist geradezu die frappierende Ähnlichkeit bei der Propaganda. Zahllose Kreuzritter wunderten sich, dass im Gelobten Land Menschen wohnten, und Herzl musste sich von einem verblüfften Zionisten fragen lassen: Aber Sie haben uns ja gar nicht gesagt, dass dort Araber wohnen. Dann tun wir ja ein Unrecht. Den Fürsten Europas kamen die Kreuzzüge durchaus gelegen, wenn sie auch nicht ihre Idee waren, sondern die des Papstes. Auf diese Weise wanderte der soziale Sprengstoff junger Adliger ohne Erbrecht freiwillig aus dem Land, und ganz nebenbei wurde noch eine Kolonie erworben. Aus denselben Gründen unterstützte Kaiser Wilhelm II. auch die Zionisten wärmstens - er war absolut kein Freund der Juden und wollte sie gern aus Deutschland raus haben, und ganz nebenbei träumten Seine Majestät von einer deutschen Kolonie Palästina.
Daraus wurde bekanntlich nichts, und nach dem Ausscheiden Deutschlands infolge des verlorenen Ersten Weltkriegs übernahmen die USA beim großen Spiel um den internationalen Einfluss die Unterstützung und den nebenbei entstehenden Nutzeffekt des Zionismus. Damit mussten sie in Gegensatz zu den Engländern geraten, die Palästina als ihr Schutzgebiet ansahen. Daher verhielten sich die USA auffallend lange neutral und wurden erst durch den japanischen Überfall auf Pearl Harbour entschiedene Bündnisgenossen der Briten gegen Hitler. Die Israelis aber mussten sich ihren Staat erst gegen die Engländer erkämpfen und dann gegen die Araber, obwohl die USA von England als Gegenleistung für General Eisenhowers "Kreuzzug in Europa" wenigstens eine Tolerierung des Zionismus gefordert hatten.
Das Problemknäuel heutiger Weltpolitik hat im Kreuzfahrerstaat sein würdiges Vorbild. Aus eigener Kraft war das Königreich Jerusalem nicht lebensfähig - allein der Rüstungsetat überstieg bereits wesentlich das Bruttosozialprodukt, und bald schon waren die Politiker in Jerusalem dringlich auf eine Schutzmacht angewiesen. Um diese Ehre stritten nun Kaiser, Papst und der jeweilige König von Frankreich. Der Papst schied infolge Zahlungsunwilligkeit bald aus - der Heilige Stuhl sah nicht ein, dass er für die Ehre, Schutzherr des Heiligen Landes zu sein, auch Kosten tragen solle und meinte, dies sei Sache gläubiger Christen in anderen Ländern. Damit waren Deutschland und Frankreich gemeint, und zeitweise mischte auch schon Englands König Richard Löwenherz mit. Sämtliche Kreuzzüge dienten von nun an nur der Einflusssicherung einer der Großmächte. Kaiser Friedrich Barbarossa plante schon als betagter Herr, Jerusalem zum hundertjährigen Jubiläum der Kreuzzüge in eine deutsche Stadt zu verwandeln, ertrank jedoch bereits unterwegs am 10. Juni 1190 in einem kleinen anatolischen Flüsschen. Daraufhin kam es unter den mit marschierten Alliierten zu bösen Streitereien, wobei sich Englands christlicher Richard ja gründlich mit den Assassinen einließ.
Der Anlass zu diesem ganzen Wirbel aber lag diesmal nicht nur in christlich - internen Machtkämpfen: Die ägyptischen Herrscher hatten den Kreuzfahrerstaat nie anerkannt, und ihr genialer Sultan Saladin eroberte 1187 ohne sonderliche Mühen das gesamte Königreich Jerusalem. Der Muslim erwies sich als wesentlich kultivierterer Sieger denn alle Christen. Er jagte die Kreuzritter nicht einmal aus dem Land, sondern gab sich damit zufrieden, dass sie von nun an arabischer Oberhoheit unterstellt waren.
Der Papst konnte sich diese Großzügigkeit nur als Anfall von Gehirnerweichung bei einem Esel erklären; ein christlicher Chronist aber vermerkte schlicht: Eyn so edlen hern wert in unserm lant keyner finden. Auch die christlichen Ritter im Heiligen Land waren nicht so edel und auf keinen Fall vertragstreu. Und so war es nur eine Frage kurzer Zeit, dass die Vertreibung der Kreuzfahrer aus dem Nahen Osten eine unumgängliche Notwendigkeit islamischer Politik wurde.
Die Mächte Europas konnten ihren Vorposten im Nahen Osten dabei nicht helfen. Der Zivilisations-, Kultur- und Wirtschaftsrückstand war dem Islam gegenüber zu groß. Rüstungstechnisch waren die Christen den Muslims hoffnungslos unterlegen, und ihre stärkste Waffe war der schreckliche Ruf gnadenloser Brutalität. Nur noch eine Macht stand im Ruf, ebenso skrupellos zu sein, eine unglaublich junge Macht, soeben in den Steppen Zentralasiens entstanden die Mongolen.
Sie waren ein Nomadenvolk und galten Jahrhunderte lang nicht gefährlicher als andere auch. Ihre Weidegründe lagen nördlich der chinesischen Grenze, und ihr Zubrot verdienten sie als Spediteure chinesischer Waren auf der alten Seidenstrasse, manchmal auch durch kleine Räubereien in Außenhandelsstationen.
Dann jedoch wurde Chinas Polizei meist schnell mit ihnen fertig, denn die Mongolenstämme waren klein und untereinander zerstritten.
Um 1194 gelang es einem dieser kleinen Stammeshäuptlinge, etliche Stämme unter seinem Kommando zu vereinigen. Er hieß Temudschin, war zwischen 1155 und 1167 geboren und hatte eine harte Kindheit hinter sich. Als freischaffendem Räuber war ihm der Erfolg versagt geblieben, doch er hatte die geniale Gabe, andere davon zu überzeugen, dass Einigkeit stark macht. Kaum hatte er das geschafft, nannte er sich Dschingis Khan, und nach einem bösen, neunjährigen Bürgerkrieg hatte er tatsächlich sämtliche Mongolenstämme unter seinem Kommando vereinigt. Nun fiel der Nomadenfürst über China her. Nordchina konnte er nur unter schweren Verlusten erobern. Nach einer lächerlichen Palastrevolution in Peking aber fiel ihm 1215 das gesamte Riesenreich nahezu kampflos in die Hände.
Dschingis Khan hatte sich nämlich eine anschauliche Methode ausgedacht, Widerstandswillige in Furcht und Schrecken zu versetzen: Wurde eine Stadt im Kampf genommen, ließ der Herrscher Türme bauen. Die Mongolentürme waren nicht sonderlich hoch und boten auch keinerlei architektonischen Reiz. Sie wirkten vielmehr durch schlichte Zurschaustellung ihres Baumaterials, den Steinen der Festungsmauern und den abgeschlagenen Schädeln ihrer männlichen Bewohner.
Für das Verkehrssystem jener Zeit spricht, dass in Europa bereits 1216 ausführliche Berichte über Dschingis Khan kursierten und sogar Zeichnungen seiner Türme. Was die Mongolen im fernen China anrichteten, imponierte vor allem dem Papst, denn viele Mongolen waren auch gute Christen. Dschingis Khan tolerierte alle Religionen und kümmerte sich um keine, und sein persönlicher Harem war auch eine imponierende Sammlung aller Glauben jener Zeit. Da gab es Hindu- Frauen, Taoisten-, Konfuzianer- und Muslim- Mädchen, aber auch zahllose christliche Schönheiten. Der Papst schloss daraus, auch der Khan sei Christ. 1217 schickte er eine Delegation von zwölf Priestern mit einer Botschaft los: Das Oberhaupt aller Christen geruhe, den Khan grüßen zu lassen und warte innig, auch von ihm als Schirmherr der Welt anerkannt zu werden. Dafür sei der Papst gerne bereit, ihm China als Lehen zu überlassen. Außerdem aber würde sich der Papst sehr freuen, wenn der Khan gefälligkeitshalber einen Krieg gegen die islamischen Länder begänne.
Dschingis Khans Reaktion war gemischt. Die päpstliche Anrede geliebter Sohn wurmte ihn. Ob der Papst etwa seine geliebte Mutter ehelicher Untreue bezichtigen wolle? China als päpstliches Lehen zu betrachten, ging ebenfalls über sein Begriffsvermögen. Und dass er Christ sein solle, erstaunte ihn. Zwar marschierten in seinem Heer gut zweihundert Bischöfe der nestorianischen Glaubensgemeinschaft, doch hatte der Khan bislang keine Zeit gefunden, sich mit Religion zu befassen. - Er holte dies übrigens schnell nach und ließ Theologen und Philosophen aller Couleurs vor seinen Thron holen. Das Christentum fand in sämtlichen Schattierungen seine Gnade. Obwohl ihr Prophet auf schimpfliche Weise verstorben ist, lässt sich ihr Glauben gut für unsere Zwecke gebrauchen, notierte er. Der Taoismus Lao Tses allerdings erregte seine Empörung. Entsetzt hörte der Khan, man solle wirken, wie das Tao wirkt - durch Nichtstun, und ließ so fort diese Wehrkraftzersetzung verbieten.
Die Antwort Dschingis Khans an den Papst entsprach daher nicht ganz den Erwartungen. Sie besagte nur, dass alle Mongolen glühende Bewunderer Roms und seiner Kultur seien - was ganz den Tatsachen entsprach, denn das Mongolenheer nannte sich selbst "Ordo" , nach dem lateinischen Wort für "Ordnung" und "Truppe", und erst die Praxis der Mongolen ließ aus diesem ordentlichen Begriff das deutsche Wort "Horde" werden. Und: Hinsichtlich der Politik islamischen Ländern gegenüber herrsche zwischen ihm und dem Papst volle Übereinstimmung.
Den ersten Schritt zum totalen Krieg hatte Dschingis Khan bereits getan. Ebenfalls im Jahr 1217 schloss er mit dem islamischen Schah von Samarkand einen Freundschaftsvertrag und Nichtangriffspakt. Auf dieser Grundlage konnte der Krieg zwei Jahre später beginnen. 1220 verwüsteten die Mongolen Samarkand, und im Lauf des folgenden Jahres wälzten sich ihre Horden quer durch Nordpersien und Afghanistan, überquerten den Hindukusch und kamen bis an den Indus.
Eine derartige Kriegsführung hatte die Welt noch nicht erlebt. Die "Fußspur Dschingis Khans" war stets fünfzehn Kilometer breit. Sämtliche Bewässerungssysteme wurden zerstört, die Felder abgebrannt und verschwenderisch mit Salz bestreut, um sie unfruchtbar zu machen. Städte, die auf dem Weg lagen, konnten später nicht mehr gefunden werden. Gegen diese Technik der "verbrannten Erde" waren die islamischen Armeen machtlos. Bis 1224 wurden die idyllischen Landschaften Nordpersiens und Afghanistans in jene Wüsten verwandelt, die sie heute noch sind. Dann befahl der Khan seine Truppen überraschend in die Mongolei zurück. Der Halbmond schien noch einmal davongekommen.
Drei Jahren später starb Dschingis Khan, und seine Erben legten eine Atempause ein. Mongolische Aktivitäten spielten sich vorwiegend in China ab, und so wäre es auch geblieben, hätten nicht der Papst und Frankreichs Könige beinahe alljährlich üppige Gesandtschaften in das Bretterdorf Karakorum geschickt, die Residenz der Khane. Die christliche Ostpolitik zielte natürlich gegen den Islam, doch die als Werbegeschenke mitgebrachten Warenproben erweckten ein ganz allgemeines Interesse der Mongolen am Westen. 1236 beschloss Batu, ein Enkel Dschingis Khans, sich einmal in Europa umzusehen. Sein Ausflug dauerte sechs Jahre.
Vier Jahre davon durchstreifte Batu das weite Russland, und 1241 erreichten die Mongolen in breiter Front Mitteleuropa. Ungarns König Bela, der sich den ungebetenen Gästen entgegenstellen wollte, wurde bis an die Adria gejagt. Am 9. April wurde zu Liegnitz in Schlesien ein deutsch-polnisches Ritterheer bis auf den letzten Mann erschlagen, und kurz nach der Weinlese veranstalteten die Mongolen in den Vororten Wiens eine im wahrsten Sinn des Wortes feurige Heurigentour. Eigentlich wollten sie auch das heilige Rom besuchen, doch im Dezember erfuhr Batu, dass in Karakorum der Großkhan verstorben sei. Bei den nun zwangsläufig ausbrechenden Rivalitäten um die Thronfolge wollte er natürlich mitmischen, und so zog er mit seinen Armeen schleunig in das tiefe Asien zurück.
Dass die christlichen Mächte aus diesem blutigen Zwischenspiel gelernt hätten, kann nicht behauptet werden. Vielmehr schickte der Papst seinen fähigsten, Diplomaten in das Mongolenland. Er hieß Giovanni de Piano del Carpini, weilte von 1245-47 in Karakorum und schaffte es, einen infernalischen Pakt auszuhandeln: Der Papst verpflichtete sich, sämtliche ihm unterstehenden Priester in islamischen Ländern den Mongolen zu unterstellen, als Agenten in der Feindaufklärung. Katholische Mönche würden mongolischen Truppen die Tore islamischer Städte heimlich öffnen und im übrigen Land Pfadfinderdienste leisten. Das Risiko der Gottesmänner war dabei sehr gering - trotz aller Kreuzfahrerei genossen römische Katholiken in den Ländern des Islam diplomatische Immunität, und ihre Post wurde prinzipiell nicht geöffnet.
Konstantinopel spielte in diesem Intrigenspiel bereits keine Rolle mehr. Christliche Kreuzfahrer hatten der alten Weltstadt bereits im April 1204 den Todesstoss versetzt. Eigentlich war dieser "4. Kreuzzug" gegen Ägypten gerichtet, doch die Venezianer dachten nicht daran, ihre ausgezeichneten Geschäftsverbindungen dorthin deswegen aufs Spiel zu setzen. Geschickt dirigierte der uralte, einäugige Doge Dandolo die christliche Armee gegen die erbittertste Konkurrenz der Lagunenstadt, und Konstantinopel hat sich von der dreitägigen Plünderung durch die Katholiken nie wieder erholt. Das Verhältnis zwischen Papst und Venedig soll sich deshalb etwas abgekühlt haben. Bei dem Komplott zwischen Papst und Mongolenkhan jedoch vertrugen sich kirchliche und die Handels-Macht wieder aufs innigste.
Der Papst hatte nur den Diplomaten gestellt seine Spesen aber trug Venedig. Das gemeinsame Ziel war die Vernichtung Bagdads, für den Papst die Hochburg der Heiden, für Venedig die letzte überragende Konkurrenz im internationalen Handel.
Die Arbeit aber sollten die Mongolen tun, und zu diesem Zweck brach Dschingis Khans Enkel Hulagu im Jahr 1252 mit einer ungeheuren Armee gegen den Islam auf.
Die mongolische Form der Kriegserklärung hieß "Freundschafts- und Nichtangriffspakt". Wer sich weigerte, einen solchen mit dein Khan abzuschließen, durfte als Feind sofort mit dem totalen Krieg rechnen. Wer einen unterschrieb, musste zunächst einmal mongolische Berater ins Land lassen und außerdem seine Truppen auf ein vereinbartes Friedensmaß reduzieren. Von da ab jagte ein Ultimatum das andere, und wenn ihr Opfer auch nur einen Augenblick zögerte, sich in sein Schicksal zu fügen, gab es natürlich Krieg.
Zur Ehre der Assassinen muss gesagt werden; dass ihr schmähliches Ende noch vergleichsweise heldenhaft war. Sie hatten als einzige keinen Freundschaftsvertrag abgeschlossen.
Gegen die Assassinen jedoch hatte der Kalif von Bagdad einen Freundschaftsvertrag unterzeichnet, und das Verhängnis des Islam war seltsamer weise, dass der Kalif in jener Zeit wieder was zu sagen hatte.
Lange Zeit waren die Kalifen nur Schattenfiguren am Rande der Politik gewesen. Die Seldschuken-Sultane hielten alle Macht in ihren Händen. Doch um 1212 begann ihre Militärdiktatur aufzuweichen. Geschickt sammelten die Kalifen wieder viele der ihnen entrissenen Richtlinienkompetenzen, und zwanzig Jahre später war der Kalif wirklich der Herr Bagdads. Es schien, als würde in kleinerem Rahmen der Glanz des Kalifats Wiederauferstehung feiern. Der Kalif bestimmte wieder Großwesir und Kabinett, und die Seldschuken-Sultane waren nur weisungsgebundene Militärkommandanten.
Nun aber regierte zu Bagdad Kalif Mustasim Billah, und der beschloss, sich auf den frischen Lorbeeren auszuruhen. Er war ein dünnbärtiges, dickes Männchen und krankhaft geizig.
Von Wirtschaft verstand er gar nichts - das Gold, das sein Großpapa und Papa unter die Leute brachten, um die Konjunktur anzukurbeln, ließ er schleunigst wieder aus dem Verkehr ziehen. Den Außenhandel brachte er durch lähmende Zwischenzölle beinahe zum Stillstand - Venedigs Handelsdelegierter ärgerte sich beispielsweise maßlos darüber, dass der Kalif den Durchgangszoll für schwarzen Pfeffer um 160 % anheben ließ und somit auf das Siebzehnfache des ursprünglichen Warenwerts. Seine Armee aber ließ er aus Ersparnisgründen auf 60.000 Reiter reduzieren, auf nicht einmal ein Zehntel der mongolischen Streitkräfte.
Für diese Politik hatte Mustasim Billah einen idealen Großwesir gefunden, Ibn Alkami. Der war Mitte der dreißig und zuvor Neuigkeitenschreiber in der Staatskanzlei gewesen, also Journalist. Eigenen Angaben nach fühlte er sich eigentlich zum Lyriker berufen, Und so lesen sich auch seine Erlässe. Ibn Alkamis größte Sorge war, Gesetze in kunstvoll verschlungene Verse zu kleiden. Manchmal enthielten sie Vernünftiges. Zum Beispiel machte er seinen Frieden mit der Schia, indem er den Nachkommen Alis das Scherifamt erblich überließ. Manchmal waren sie schlicht unpraktisch wie seine Verordnungen zum Hofprotokoll. Dabei wurde die Begrüßung des Kalifen zu einer drei Stunden dauernden Strapaze, worauf für die eigentlichen Sachgespräche nur jeweils zwei Minuten zur Verfügung standen. Erforderte die Sache einen längeren Vortrag, mussten sämtliche Zeremonien wiederholt werden, ehe wieder eine Zweiminuten-Portion Sachlichkeit möglich war.
Der Kalif vertraute Ibn Alkami blindlings. Der Wesir füllte seine Schatzkammern bis zum Bersten, und daher schlug Mustasim Billah alle Warnungen seiner anderen Berater in den Wind und sich selbst bedingungslos auf Ibn Alkamis Seite, der von friedlicher Koexistenz mit den Mongolen schwärmte, sie als Muster von Vertragstreue pries und - trotz aller schon gemachten Erfahrungen - als diszipliniertes, hochkultiviertes, dem Landmann freundliches Volk.
Was Ibn Alkami dazu bewog, wurde nie bekannt. Er saß an den Schaltstellen von Macht und Reichtum - was konnte er vom Khan erwarten? Bereits 1250 schickte er an Hulagu eine genaue Karte Bagdads samt Lagebeschreibung, natürlich kunstvoll gereimt. Von allen Verrätern der Geschichte war er auf jeden Fall der selbstloseste.
Er händigte Christlichen Agenten Standortverzeichnisse der Armee aus, genaue Truppenzahlen und sogar das Rezept für griechisches Feuer. Da er persönlich auch die Adresse des Khans auf die Papiere schrieb, wusste er, wohin die brisanten Sendungen gingen. Spätere Geschichtsschreiber meinten, er habe sich am Kalifen rächen wollen, weil der eines seiner Gedichte nicht gut fand. Aber ganz abgesehen davon, dass der Kalif alles gut fand, was von Ibn Alkami kam, hätte der Wesir seinen Kalif jederzeit und mühelos stürzen können. So bleibt die unwahrscheinlichste Erklärung die wahrscheinlichste: Dass der Judas des Islam den Verrat als schöne Kunst betrachtete und – l´art pour lart - um der Kunst willen ausübte, vielleicht auch, um ein bisschen unsterblich zu werden. Das hat er ja im Irak erreicht - noch heute steht an fast jeder Moschee, stets rechts vom Eingangstor. "Fluch dem, der nicht Ibn Alkami flucht".
Lange Zeit misstraute Hulagu dem Verräter. Sein Großvater Dschingis Khan hatte zweimal je 24.000 Mann gegen Bagdad anrücken lassen und sich dabei die einzigen Niederlagen seines langen Lebens geholt. Im Februar 1257 schickte jedoch Ibn Alkami die dreißig berühmtesten Astrologen Bagdads zu Hulagu, und sie lasen aus den Sternen den Untergang Bagdads. Diese Sterne veranlassten den Mongolen, ein böses Ultimatum an den Kalifen zu stellen: Sämtliche Minister, die den Mongolen nicht freundlich gesinnt waren (und deren Namen Hulagu aus den Briefen Ibn Alkamis kannte), sollten ihm sofort ausgeliefert werden. Der Kalif war dazu bereit, doch da drohte der Seldschuken-Kommandant mit Aufstand. Suleimanschah hielt dem Kalif sein Schwert vor den Bauch: "Wenn Eure Herrlichkeit das zulässt, werde ich Eure Herrlichkeit abstechen wie ein Kaninchen".
Im März des Jahres 1257 marschierten rund 600.000 Mongolen in das Zweistromland. 10.000 islamische Krieger sollten sie am oberen Tigrislauf aufhalten, doch Ibn Alkami radierte bei dem Erlass eine Null aus, und so zog der alte General Fetheddin mit tausend Mann den Mongolen entgegen. Zur größten Überraschung aller Beteiligten konnte er sogar die Vorhut schlagen und zwei Tage später sogar das Hauptheer zum Stillstand bringen. Auf dem Schlachtfeld ließ der greise Überraschungssieger sein Pferd mit Ketten anpflocken: "Hier bleiben wir, und wenn die Mongolen weiter wollen, dann nur über unsere Leichen".
In der folgenden Nacht durchstachen die Mongolen die Tigrisdämme. Fetheddin und die meisten seiner Soldaten ertranken in den lehmigen Fluten.
Von nun an wurde das Zweistromland systematisch verwüstet, das seit über viertausend Jahren funktionierende Bewässerungssystem zerstört und sogar der berühmte Turm von Babel. Mindestens zweitausend Jahre lang ragte das Riesengemäuer wie ein Gebirge aus der Ebene, doch die Mongolen leisteten ganze Arbeit - der babylonische Turm ist heute ein Wasserloch.
Am 22. Dezember zogen an die 500.000 Mongolen einen undurchdringlichen Belagerungsring um Bagdad. In der Stadt selbst waren nur etwa 15.000 Soldaten stationiert. Eine Entsatzarmee wurde am 16. und 17. Januar 1258 bis auf den letzten Mann aufgerieben, und von da an war die Lage in der Stadt hoffnungslos.
Nun versuchte der Kalif zu verhandeln. Ibn Alkami konnte ihm dabei nicht mehr helfen er befand sich seit der Unglücksschlacht als Berater im Lager Hulagus. Am 1. Februar begaben sich Suleimanschah, der oberste Kommandant, und vier Minister nach der Zusicherung freien Geleits in das Mongolenlager. Dort wurden sie freundlich empfangen, und, als sich die Verhandlungen nicht zu Hulagus Zufriedenheit entwickelten, erschlagen.
Am 9. Februar ließ Hulagu mit einem Pfeil seine Bedingungen in die belagerte Stadt schießen: Bei kampfloser Kapitulation innerhalb von 24 Stunden würde Bagdad geschont.
Am Morgen des 10. Februar öffnete sich das Nordtor Bagdads.
In Viererreihen zogen die Verteidiger aus der Stadt und warfen ihre Waffen vereinbarungsgemäß in den Stadtgraben. In Gruppen zu je zwanzig Mann zogen sie in mongolische Kriegsgefangenschaft und wurden noch am selben Nachmittag vereinbarungswidrig erschlagen.
Um zwölf Uhr verließ der Kalif mit 3.000 Beamten, Würdenträgern und seinem gesamten Hofstaat Bagdad. Nur sieben von ihnen Kalif Mustasim Billah, sein Bruder, seine zwei Söhne und drei Minister wurden vor Hulagu geführt, die übrigen wahrscheinlich sofort umgebracht. Hulagu bewirtete seine Gäste freundlich - schließlich sollten sie bei seinem Einzug in Bagdad mitwirken.
Für die Muslims war dieser Tag, der 11. Februar 1258, das Ende der herrlichen Welt. Zum Sonnenaufgang wurden die Befestigungsanlagen zerstört. Ein Chronist berichtet: Die Graben, tief wie die Betrachtungen der Weisheit, und die Mauern, hoch wie der Aufflug des Mutes, waren in einer Stunde dem Erdboden gleich.
Wie Ameisen zerwühlten die Mongolen die Befestigungen, und wie Heuschrecken fielen sie in die Stadt ein. Bereits an diesem ersten Tag wurden über 200.000 Zivilisten umgebracht. Khan Hulagu genoss das Blutbad als ästhetisches Spektakel. Der Tigris erhielt durch das Blut der Erschlagenen eine freundlich hellrote Farbe, schreibt er in seinen Memoiren, und am Abend ließ ich mir das Vergnügen nicht nehmen, langsam sein Ufer entlang zu reiten. Die brennenden Vororte und die Fackeln der Minarette waren von atemberaubender Schönheit. Nach drei Tagen der Plünderung waren sämtliche Soldaten der Mongolen reicher, als ihr Khan zuvor gewesen. Silbergeschirr wurde im Lager zum Preis von Zinn gehandelt und Goldgeschirre als Messing verkauft.
Am vierten Tag hielt Khan Hulagu seinen Einzug. Angeblich hatte er zuvor Angst vor einem Attentat, dem Kalifen aber erklärte er, als höflicher Machthaber habe er seinen Soldaten den Vortritt lassen wollen. Nun zog er mit fünfhundert Mann Gefolge zum Kalifenpalast, der ihm als persönliche Beute reserviert war.
Der Palast war fast drei Quadratkilometer groß und hieß Daresch Schedschred, Haus der Bäume. Im Vorhof des Thronsaales standen nämlich zwei Bäume vor einem Wasserbecken. Jeder war sechs Meter hoch, hatte achtzehn Äste aus Silber und zweitausend Blätter aus Gold. Auf dem einen saßen zwischen Edelsteinfrüchten viele Vögelchen aus Gold, mit Rubinen, Smaragden und Saphiren besetzt. Ein Uhrwerk ließ sie artig zwitschern. Khan Hulagu war fasziniert. Er rupfte einen Singvogel vom Baum und zerschlug ihn mit dem Schwert, um das Geheimnis seines Innenlebens zu ergründen. Als das Vögelchen daraufhin trotz barscher Befehle nicht mehr zwitschern wollte, war der Khan so enttäuscht, dass er den ganzen Baum fällen und einschmelzen ließ. Auch der zweite Baum fand nicht seine Gnade. Auf ihm saßen fünfzehn kleine Reiter aus Gold und Perlen. Sie schwangen, ebenfalls von einem Uhrwerk betrieben, ihre Schwerter gegen den Khan, und damit hatten sie ihr Leben verwirkt.
Nachdem sich Hulagu auf ähnliche Weise im gesamten Palast umgesehen hatte, wandte er sich freundlich an den Kalifen: "Immer schon habe ich nur das Beste über die islamische Gastfreundschaft gehört.
Zeig dich nun als guter Gastgeber und serviere uns das Beste aus deinem Keller". Der Khan meinte die Schatzkammer. Der Kalif hatte ihre Schlüssel vergessen und musste erst die Tür sprengen lassen. Es dämmerte bereits, als Kalif Mustasim Billah und sein Gast das Gewölbe betraten. Die aus zahllosen Märchen berühmte Schatzkammer war sechzig Meter lang, acht Meter breit und zwei Meter hoch. Die Wände waren weiß gekalkt und der Fußboden schlichter, gestampfter Lehm. Darin lagerten unter anderem 2.057 mit Edelsteinen übersäte Prunkgewänder, 5 Millionen Mark in Goldmünzen und 800 Kilo Schmuckstücke. Hulagu würdige die Pracht nur eines kurzen Blickes: "Das ist ein nettes Trinkgeld für meine Diener. Ich selbst; habe für derlei Kleinigkeiten nichts übrig. Aber nun schenk mir deinen Notgroschen". Zitternd zeigte der Kalif auf den Lehmboden. Vier Sklaven hackten ihn mit Spaten auf. Schon nach kurzer Zeit stießen sie auf ein kleines Gewölbe. Darin standen zwei riesige Kupferkessel, beinahe bis zum Rand mit Goldbarren gefüllt. Die wogen zusammen sechseinhalb Tonnen.
Spät am Abend revanchierte sich der Khan mit einer Gegeneinladung. Das Fest im Lager der Mongolen war überwältigend: Sämtliche Lagergassen waren mit Teppichen und Seidenbrokaten belegt, und das brennende Bagdad sorgte für stimmungsvolle Beleuchtung. Im Lager selbst glühten zahllose Scheiterhaufen, aufgeschichtet aus den Beständen der Bibliotheken. Der größte loderte vor dem Zelt Khan Hulagus - die zweieinhalb Millionen Handschriften aus der Bibliothek der Universität.
Für den Kalifen wurde ein besonderes Gericht aufgetragen: Vierzehn Schüsseln, gefüllt mit hochkarätigen Goldbarren. Es gab nichts anderes, und besorgt erkundigte sich Hulagu, ob sein Ehrengast etwa schlecht bei Appetit sei. Gequält meinte Mustasim Billah: "Gold kann man doch nicht essen". Hulagu staunte: "Ja, warum hast du es dann nicht unter die Leute gebracht wie ich das meine?"
Anschließend hielt Khan Hulagu noch einen langen Vortrag über Volkswirtschaft. Kalif Mustasim Billah hörte jedoch nicht zu. Er neigte sich gen Mekka und betete jene Sure, die schon Merwan in seiner letzten Stunde getröstet hatte: "O Gott, Herr über die Herrschaft, Du gibst die Herrschaft, wem Du willst, und Du nimmst die Herrschaft, von wem Du willst. Du erhöhst, wen Du willst, und erniedrigst, wen Du willst."
Den weisen Worten Hulagus nicht zu lauschen, war natürlich eine Beleidigung. Da der Khan geschworen hatte, den Kalifen vor jedem Schwert zu schützen, und auch einmal Wort halten wollte, wurde der Schatten Gottes auf Erden in einen Sack gesteckt und zu Tode geprügelt.
Die Stadt Bagdad aber wurde noch vierzig Tage lang geplündert.
Im August ließen die Mongolen eine Volkszählung vornehmen. Die letzte war fünf Jahre zuvor gewesen. Damals wohnten in Bagdad 973.741 freie Muslims und Frauen sowie rund 870.000 Sklaven und Sklavinnen. Im August des Jahres 1258 hausten zu Bagdad 972 Personen. Der Nahe Osten hat sich von dieser Katastrophe nie wieder er holt. Der "fruchtbare Halbmond" wurde zur Wüstenlandschaft mit Oasen, und auch heute beträgt im Irak die Gesamtbevölkerung nur ein Drittel der Bevölkerungszahl zur Zeit des Kalifats.
Der Osten ist tot, jubelte Frankreichs später heilig gesprochener König Ludwig, und die hohe Zeit des Westen gekommen. In gewisser Beziehung hatte er recht. Zwar blieb das Christliche Abendland noch lange Zeit im Schatten islamischer Kultur und vor allem das Rittertum, das sogar den Harem in den Frauengemächern der Burgen und die erotischen Spiele des Orient im Minnekult imitierte -, doch von nun an wurde die Geschichte der Alten Welt von Europa bestimmt. Der Gerechtigkeit halber muss allerdings gesagt werden, dass erst im neunzehnten Jahrhundert Imperialismus und Kapitalismus des Abendlandes ähnlich weltumspannend wurden, wie es die Macht des Islam ein Jahrtausend zuvor war.
Der Nahe Osten aber erlebte das Schicksal der Märchenprinzessin Sulminth, der arabischen Großmutter unseres Dornröschen. Ein böser Dämon aus dem Osten hatte dem Mädchen eine Nadel ins Herz gestoßen, und in todesartigem Schlaf ruhte Sulaminth wohl tausend Jahre auf einem seidenen Kissen. Ihr Palast zerfiel, und die Tiere der Wüste hüteten ihren Schlummer. Doch eines Tages trat aus der untergehenden Sonne ein Prinz. Er erschlug die treuen Tiere und küsste die Prinzessin auf dem Kissen. Sie erwachte und wurde seine glückliche Braut.
Die Wirklichkeit ist etwas prosaischer. Zwar kam der Prinz aus dem Westen und küsste sogar die Prinzessin. Doch hatte er Technik studiert und kein sonderliches Interesse für die Schöne. Was er wollte und brauchte, war ihr Kissen, denn das enthielt Öl.
Viele Jahrhunderte lang entwickelten sich die Beziehungen zwischen Morgen- und Abendland um einen Lieblingsausdruck der Diplomatie zu persiflieren auf einer gemeinsamen Basis tiefer Verständnislosigkeit. Die Muslims verziehen den Christen nicht, die wahren Nutznießer der Mongolenkatastrophe gewesen zu sein. Die Mächte des Abendlandes wiederum verloren nie ihre Angst vor der Macht des Islam. Das Mittelmeer, einst Marktplatz der Kulturen, wurde und blieb Grenze zweier sich immer weiter auseinanderlebenden Welten.
Auf den Trümmern des arabischen Weltreichs entstanden neue Großmächte, Persien entwickelte sich zu einem eigenen Staat, dessen Einfluss bis Indien reichte und heute vom Schah mit westlicher Rüstungshilfe wiederbelebt werden soll. Wichtiger für die Geschichte Europas aber wurde jahrhundertelang das osmanische Großreich der Türken. Es zielte nach Europa als Sultan Mohammed 1453 Konstantinopel eroberte und als Istanbul zu seiner Hauptstadt machte, träumte er von einer Neuauflage des byzantinischen Reichs unter dem Zeichen des Halbmonds. Seine Erben versuchten, den Traum zu verwirklichen: Im 17. Jahrhundert reichte ihre Macht von Ägypten bis Ungarn.
Für Frankreichs Ludwig XIV. beispielsweise, den "Sonnenkönig des Abendlandes", waren die Türken "eine respektable Macht Europas" und sogar "ehrenwerte Bundesgenossen" im Kampf gegen die habsburgischen Kaiser des Heiligen Römischen Reichs. Frankreichs König fühlte sich von den Habsburgern Spaniens und Deutschlands ebenso in die Zange genommen wie die Habsburger sich von Franzosen und Türken, und die Untertanen übernahmen die taktischen Überlegungen ihrer Herrscher als Hass. Der hält sich bekanntlich länger als seine auslösenden politischen Gegebenheiten, und daher müssen im deutschsprachigen Raum auch heute noch Türken für das Großreich ihrer Vorväter bezahlen.
So wurde 1683 eine türkische Armee bei der Belagerung von Wien vernichtend geschlagen. Heute noch wird in österreichischen Geschichtsbüchern das Ereignis als "die Errettung des Abendlandes vor der Gefahr aus dem Osten" gefeiert. Und Prinz Eugen von Savoyen, der die Ländereien seiner Brotgeber so erfolgreich auf Kosten des Sultans vergrößerte, ist heute noch ein alpenländischer Volksheld.
Dabei taten die Mächte des Abend- und Morgenlandes stets das selbe. Aufbau und Prinzip des Osmanischen Reichs und des habsburgischen
k. u. k. Österreich - Ungarn gleichen sich wie ein Ei dem anderen. Beide waren multinationale Wirtschaftseinheiten, und beide gingen schließlich am Nationalismus in die Brüche. Doch das "Selbstbestimmungsrecht der Völker", dieses Lieblingsschlagwort des 19. Jahrhunderts, war nur ein freundlicher Vorwand für handfeste imperialistische Politik. Preußen und Österreich, die Vormächte Mitteleuropas im frühen 19. Jahrhundert, begrüßten begeistert den "griechischen Freiheitskampf" gegen die Türken, um schließlich dem befreiten griechischen Volk einen deutschen Fürsten als König vorsetzen zu können. Als dann der Nationalismus auch Österreich - Ungarn zu zerfressen begann – grotesker weise machte sich ausgerechnet Großbritannien zum "Sprecher aller unter Fremdherrschaft ächzenden Völker" -, rückten die einstigen Gegner eng zusammen: Gemeinsam marschierten Deutsche, Österreicher und Türken in den Ersten Weltkrieg.
Die Deutschen und Österreicher machten diese ideologische Kehrtwendung ihrer Herrscher nicht mit. Für sie blieben die Türken ein unkultiviertes Asiatenvolk und Istanbul nach den Worten Helmuth von Moltkes "das stehende Lager eines Tartarenstammes". Als nach dem Ersten Weltkrieg Kemal Atatürk aus der klein gewordenen Türkei einen modernen Staat europäischer Prägung schuf und westliches Kultur- und Zivilisationsgut bis hin zum Alphabet übernahm, erntete er im deutschen Sprachraum nur Spott als "Kümmeltürke". Das Wort hat sich gehalten, obwohl heute kaum einer weiß, dass es einst einem genialen Staatsmann galt es wurde zum Synonym jener Primitivität, die Muslims seit Jahrhunderten nachgesagt wird, Codewort einer Borniertheit, die selbst den Fleiß türkischer Arbeiter an deutschen Fliessbändern verächtlich sieht.
Das Verstehen können zwischen Christen und Muslims scheint irreparabel gestört. Die meisten Europäer haben sich hinter einem Gebirge von Vorurteilen verbarrikadiert, und die meisten Muslims schwanken zwischen Minderwertigkeitsgefühlen mit hemmungsloser Imitation des Westens oder engstirnig islamischem Chauvinismus. In einer Zeit, wo die Welt buchstäblich klein geworden ist, ein gefährlicher Zustand, doch Brücken, auf denen sich Orient und Okzident begegnen können, sind kaum in Sicht.
Natürlich müsste das Einander verstehen - Lernen auf der Schulbank beginnen, doch die Lehrpläne unserer Schulen betreiben auch heute noch hauptsächlich christlich - abendländische Nabelschau. Zwar leuchten Kinderaugen bei den Geschichten aus 1001 Nacht, bildet der Orient den goldleuchtenden Hintergrund zahlloser Märchen, doch das ernsthafte Interesse ist anscheinend nur bei Randgruppen unserer Gesellschaft vorhanden. Vor gut eineinhalb Jahrhunderten entstand an deutschen Universitäten als neuer Wissenschaftszweig die Orientalistik. Versponnene Bibliothekare wie Gustav Weil und romantische Schwärmer wie Josef Hammer - Purgstall übersetzten islamische Geschichtsbücher doch das zunächst große Interesse am Orient stagnierte bald. Noch heute sind Studenten der Islamistik hauptsächlich auf jene Werke angewiesen, die vor über hundert Jahre erschienen sind. Und volkstümlich wurde die Orientalistik nie. In Hamburgs öffentlichen Bücherhallen beispielsweise zählte ich 378 Bücher über Israel und ganze 18 über die arabische Welt.
Um die Mitte unseres Jahrhunderts geriet der Orient in das Blickfeld einer ganz anderen Gesellschaftsschicht: Das Morgenland wurde zum Traumziel aller abendländischen Gesellschaftsverweigerer. Zunächst nannten sie sich Existentialisten, später Beatniks und schließlich Hippies. Sie folgten dem uralten Trampelpfad der Pilger und fühlten sich durchaus als deren Nachfahren. In gewisser Beziehung waren sie das auch schon aus den Pilgern wurde das alpenländische Schimpfwort "Pülcher", die übelste Bezeichnung für Tagediebe. Als solche machten sich die Blumenkinder im Abend- und im Morgenland unbeliebt, und ich habe für sie nur insofern Verständnis, als ich selbst einmal nicht anders war und anders wohl nie den Orient kennensgelernt hätte. Frisch von der Schulbank trampte ich los, kam in den Nahen Osten und fiel aus allen Wolken.
Wie ich gelernt hatte, war das Abendland die Mutter aller Errungenschaften. Höchstens beim Zahlensystem und der Algebra wurde der arabische Vater zugegeben. Ein bisschen Karl May hatte ich auch gelesen, konnte mir also ein Bild vom täglichen Leben im wilden Kurdistan machen und hatte sogar eine Landkarte mit, um mich "da unten" nicht zwischen den Beduinen zu verlaufen. So zog ich los und stand plötzlich vor Herrlichkeiten, die ich mir nicht einmal nach den Märchen von 1001 Nacht hatte träumen lassen. Und wusste nichts.
Zu meinem Glück lernte ich islamische Gastfreundschaft kennen. In dieser Beziehung ist Europa noch heute unterentwickeltes Gebiet - die selbstverständliche Großzügigkeit, auch Wildfremde einzuladen und mit ihnen im wahrsten Sinn des Wortes Haus und Essen zu teilen, habe ich hierzulande noch nie erlebt. Ich wurde von Bauern aufgenommen, von Beamten, Viehhirten und einmal auch von einem Professor für islamische Geschichte. Bei Tee und den klebrigen Süßigkeiten der syrischen Küche erzählte er mir stundenlang Geschichten aus der Geschichte. Da gegen erschien mir, was ich von europäischer Geschichte wusste, ziemlich langweilig. Ja, das liegt wohl am Klima, scherzte mein Gastgeber.
Einmal aber wurde er ernst, als ich ihn bat, mir den Unterschied zwischen Bibel und Koran zu erklären: "Es mag durchaus sein, dass der Koran eine bessere Denkschule ist. Aus der Bibel lernen die Leute vor allem, an Wunder zu glauben. Da ist vieles absolut unlogisch, doch wer an Gott glaubt, muss es glauben. Mohammed kannte einiges vom Christentum. Vielleicht hat er sich deshalb bemüht, den Koran so logisch abzufassen wie nur möglich. Außerdem war er Kaufmann, und ein solcher Beruf verpflichtet doch in gewissem Maß zur Realität. Vor allem aber ist das Christentum eine Religion der Unterordnung. Das verpflichtet natürlich auch die Machthaber zu gewisser Verantwortlichkeit und in der christlichen Geschichte gibt es weniger aberwitzige Tyrannen als in der islamischen -, doch es bewirkt auch eine viel größere Identifizierung des Untertanen mit der Macht. So wild und verrückt die Geschichte des Islam auf der politischen Ebene erscheint, im täglichen Leben hinterließ sie nur wenige Spuren. Da gilt noch immer die Sippe, der Stamm. Der Bauer kümmert sich um den Staat nur, wenn seine Soldaten die Felder zertrampeln.
Sein Leben und Denken wird vom Koran bestimmt".
Schüchtern wandte ich ein: "Das ist bei der Bibel auch nicht viel anders".
"Aber doch mit einem kleinen Unterschied. Soviel ich weiß, spielen die kleinen Leute Mitteleuropas am liebsten mit Karten oder Würfeln, also mit Glück und Zufall. Bei uns spielen sie Schach".
Und zum Abschied sagte er: "Im übrigen aber machen wir doch die gleichen Dummheiten. Schade, dass dieses Gemeinsame so selten gesehen wird".
Jahre später lernte ich auf einer Party einen sehr eleganten Araber kennen. Er sprach hervorragendes Oxford - Englisch, schien fast im Smoking geboren, trank jedoch als gläubiger Muslim nur Alkoholfreies.
"Glauben Sie nicht, dass bald das islamische Zeitalter beginnt?" fragte er mich unvermittelt.
Ich Sah ihn verblüfft an. Zwar hatte ich schon Ähnliches gedacht, wenn ich Gastarbeiter sah, doch das war wohl nicht gemeint.
"Als dieses Jahrtausend begann, wurde die Weltpolitik von Muslims bestimmt. Ich bin fest davon überzeugt: Wenn es endet, werden wieder die Araber das Sagen haben."
"Aber das ist doch Geschichtsmystik". Er lachte. "Ich habe mich wohl missverständlich ausgedrückt. Nein, von mystischen Spekulationen halte ich nichts. Höchstens von einer: Dass nämlich erst das Bewusstsein von Macht die Möglichkeit gibt, sie auch auszuüben. Wer Aladins Wunderlampe hat und nicht weiß, wie er sie reiben muss, kann sie höchstens als Beleuchtungskörper benützen, während er zum Broterwerb anderen die Strasse kehrt".
Mit einer lässigen Handbewegung nahm er vom Tablett des Kellners ein neues Glas Cola.
"Natürlich haben wir nicht Aladins Wunderlampe. Aber wir haben das Öl und - in'sch' Allah - damit werden wir vielleicht noch einiges erreichen können".
Der Mann hieß Jamani, wurde mittlerweile Ölminister Saudi Arabiens und hat schon längst prominentere Gesprächspartner. Die Welt hat von ihm noch einiges zu erwarten. Ob auch ein neues islamisches Zeitalter, wage ich nicht zu vermuten. In'sch'Allah.
|
|
Zeitgenössische Berichte, Chroniken
Abu Ali Ahmed Miskawaih Kitab tagarib al-uman wata´aqib al-himan, engl.: "The Eclipse of the Abassid Caliphate", übers. von H. F. Amendroz & D. S. Margoliouth, 4 Bde., London 1920/21 (Hervorragendes Geschichtswerk, aus Hofprotokollen zusammengestellt, doch durchaus kritisch. Zahlreiche Dialoge der Kalifen sind wörtlich wiedergegeben.) Abu Dulaf Mis'ar, engl.: Travels in Iran", übers. von V. Minorsky, Kairo 1955 (Genauer Reisebericht aus dem heutigen Irak, um 950) Ali Tabari "Kitabu'l-Din wa'l-Daulat", Chronik, engl. übers. von A. Mingana, Manchester 1923 (Die berühmteste Chronik des 12 Jhs., obgleich in vielen Zahlenangaben nur mit Vorsicht zu geniessen. Tabari War Geschichtsprofessor in Bagdad und der bekannteste seiner Zunft.) AI-Makhari (Ahmed ibn Mohammed), engl.: "The History of the Mohammedan Dynasties in Spain", übers. von Pascual de Gayangos, London 1840 (Verfasst vom Hofgeschichtsschreiber der Omajaden in Spanien, enthält auch eine ausgezeichnete Vorgeschichte der Halbinsel.) Annales Regni Francorum. Qui dicuntur Annales Laurissenses Maiores et Einhardi. Hrsg. von G. H. Pertz, Hannover 1895 (In sehr einfachem Latein abgefasst, leider nicht übersetzt. Informiert übersichtlich über die fränkisch - islamischen Beziehungen.) As-Suli (Abu Bakr Muhammad Ben Yahya), franz. "Historie de la dynastie Abbaside", Algier1946 (Von einem Gegner der Abbasiden verfasst, mit zahlreichen Skandalgeschichten gewürzt.) Einhard (Eginhard) "Vita Caroli Magni Imperatoris", hrsg. von C. Halphen, Paris 1923 (Das Standardwerk des Hofgeschichtenschreibers Karls des Grossen, im berühmten Küchenmädchenlatein abgefasst. Harun al-Raschid wird stets als "Aaron" bezeichnet.) Eutychus, Patriarch von Alexandria "Annales", arab. Beirut, 1906-09, lat. übers. von Edward Pococke, Oxford 1656 (Ein leider sehr seltenes Werk. Mir war nur der erste Band zugänglich, doch der enthält eine pedantisch genaue Beschreibung der Eroberung von Alexandria und eine hervorragende Schilderung der Bibliothek.) Hamza ben al-Hasan al Isfahani "Kitab" ,lat., Leipzig 1844 2 Bde., leider nur ins Lateinische übersetzt, doch relativ leicht lesbar. Hamza Isfahani gilt als Großmeister der islamischen Geschichtsschreibung. Seine Chronik beginnt mit der Erschaffung der Welt und reicht bis Harun al-Raschid.) Ibn at-Tiqtaqa "al-Fahri", franz. übers. von Emile Amar, Paris 1910 (Sehr detaillierte Schilderung des Islam im 9. Jh., leider mit großen Lücken durch Verlust der Originalmanuskripte.) Ibn Isfandiar (Ibu Isfandiar) "Tarik-i Tabaristan", engl. übers. von E. G. Browne, London 1905 (An Tabari anknüpfend und ihn ergänzend, gleichzeitig eine Summe vieler verlorengegangener Chroniken.) Ibn Tagribirdi (Abul Mahasin Gamal ad-Din Yusuf), engl. "The Chronic", übers. von William Popper, 7 Bde., Berkeley 1909-29 (Enthält hervorragendes Material zu den internationalen Beziehungen des Islam und Protokolle zum Sturz des Kalifats.) "Jahrbücher des fränkischen Reiches unter Karl dem Grossen", hrsg. von S. Abel und B. Simon, 9 Bde., Leipzig 1866-83 (Etwas trocken zu lesen, doch eine Unzahl Details) Mas'udi Murujul 'l-Dhabab, franz.: "Les Prairies d'Or", übers. von Barbier de Maynard und Pavet de Conteille, 9 Bde., Paris 1861-77 (Das umfangreichste, aber auch schönste Geschichtswerk des Islam, fast wie ein Roman geschrieben,) Monumenta Germaniae Historica (Wissenschaftl. Reihe des 19. Jhs.) I., SS 112-123 "Annales Laurissenses Minores" I., SS 314-336 "Annales Mettenses" XVI., SS 491-499 "Annales Mosellani" (Die angegebenen Stellen enthalten Kommentare zur Aussenpolitik Karls des Grossen, u. a. auch die Geschichte des Elefanten.) Nizam ol-Mulk "Siyasatnama", deutsch: "Gedanken und Geschichten" (eigentl. Das Buch der Regierung"), übers. von Karl Emil Schabringer, Freiher von Schowingen, Freiburg 1960 (Das berühmte Werk des Grosswesirs und Gegenspielers der Assassinen, eine Art islamischer Macchiavelli.) Neuere Werke, Abhandlungen Aschbach, Josef: "Geschichte der Omajaden in Spanien", 2 Bde., Wien 1860 Björkmann, Walter: "Beiträge zur Geschichte der Staatskanzlei im islamischen Ägypten, Hamburg 1928
Buckler, F W.: "Harunu'l Rashid and Charles the Great", Cambridge/ Mass. 1931
Bury, J. B.: "A history of the Later Roman Empire from Arcadius to Irene", 2 Bde.,
London 1889
-, "A History of the Eastern Roman Empire from the Fall of Irene to the
Accession of Brasil 1.,", London 1912
Busse, Heribert: "Chalif und Grosskönig (Die Buyiden im Iraq)", Beirut 1969
Butler, A. J.: "The Treaty of Misr in Tabari", Oxford 1906
"Enzyklopädie des Islam" ,hrsg. von Theodorus Houstma, 5 Bde., Leiden/ Leipzig
1913-38. LeidenlParis 1960
Goeje, M. J. de: "Memoire sur les Carmathes du Bahrein et les Fatimides", Leiden
1886 (Immer noch bestes Werk über diese ersten Kommunisten)
Glubb Pascha, John B.: "The Empire of the Arabs", London 1963
Goldziher, I.: "Vorlesungen über den Islam", Heidelberg 1925
Hammer-Purgstall, Josef v.: "Geschichte des Assassinen", Stuttgart 1818
Über die Länderverwaltung unter dem Chalifate, Berlin 1835
Harnack, A.: "Die Beziehungen des fränkisch-italienischen zu dem byzantinischen Reich unter der Regierung Karls des Grossen und der späteren Kaiser karonlingischen Stammes". Göttingen 1880
Hartmann, M.: "Die Islamisch-Fränkischen Staatsverträge", Zeitschrift für Politik XI., SS 1-64, 1918
Hodgson, Marshall G. S. "The Order of Assassins", 's Gravenhage 1955 (Bestes Werk über die Assassinen.)
Kremer, Alfred v.: "Kulturgeschichte des Orients unter den Chalifen", 2 Bde., Wien 1875, Neudruck Aalen 1966 (Ein grossartiges Werk, in Detailreichtum und Genauigkeit nur den besten islamischen Chroniken vergleichbar.)
Kühnel, E.: "Islamische Kleinkunst", Berlin 1925
Langen, J.: "Geschichte der Römischen Kirche von Leo 1. bis Nikolaus 1.", Bonn 1885
Le Strange, Guy: "Baghdad during the Abbassid Caliphate from Contemporary Arabic
and Persian Sources", Oxford 1900
The Lands of Eastern Caliphate", Cambridge 1905
Mac Donald: "Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory", New
York1903
Miles, Georges C.: "Rare Islamic Coins", New York 1950
Müller, A.: "Der Islam im Morgen- und Abendland", Berlin 1885
Östrup, Johannes: "Catalog der arabischen Münzen in der königlichen Sammlung
Kopenhagen", Kopenhagen 1928
Die Mauren und Marokko", Kopenhagen 1930 (Als Numismatiker ist Östrup
hervorragend, als Hsitoriker äusserst tendenziös und ungenau.)
Oppenheim, Max Freiherr v.: "Die Beduinen", 3 Bde., Leipzig 1939-43, erneut
Wiesbaden 1952
Palmer, E. H.: "Haroun Alraschid", London 1881
Salmon, Georges: "L'Introduction topographique a'l histoire de Bagdadh", Paris 1904
Sprenger, Aloys: "Die Post- und Reiserouten des Orients", Nachdruck Amsterdam
1962
Strothmann R.: "Der Kultus der Zaiditen", Strassburg 1912 (Hervorragendes Werk
über die Schia.)
Stüwe, Friedrich: "Die Handelszüge der Araber unter den Abbasiden durch Afrika,
Asien und Osteuropa", Berlin 1836
Weil, Gustav: "Mohammed der Prophet, sein Leben und seine Lehre", Stuttgart 1843
Geschichte der Chalifen", 3 Bde., Mannheim1846-51 (Ein heftiger Gegner Hammer - Purgstalls und überaus gründlicher Vertreter akademischer Gelehrsamkeit drei Viertel seiner Werke sind Fussnoten!) Wellhausen, J.: "Das arabische Reich und sein Sturz", Leipzig 1906 Winter, J., und A Wünsche: "Geschichte der poetischen, kabbalistischen, historischen und neuzeitlichen Literatur der Juden", 3.Band,Berlin 1897 Wüstenfeld, Ferdinand: "Die Academien der Araber und ihre Lehrer", Göttingen 1837 Geschichte der arabischen Arzte und Naturforscher", Göttingen 1840
|

|

|
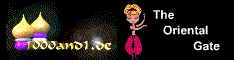
|

|